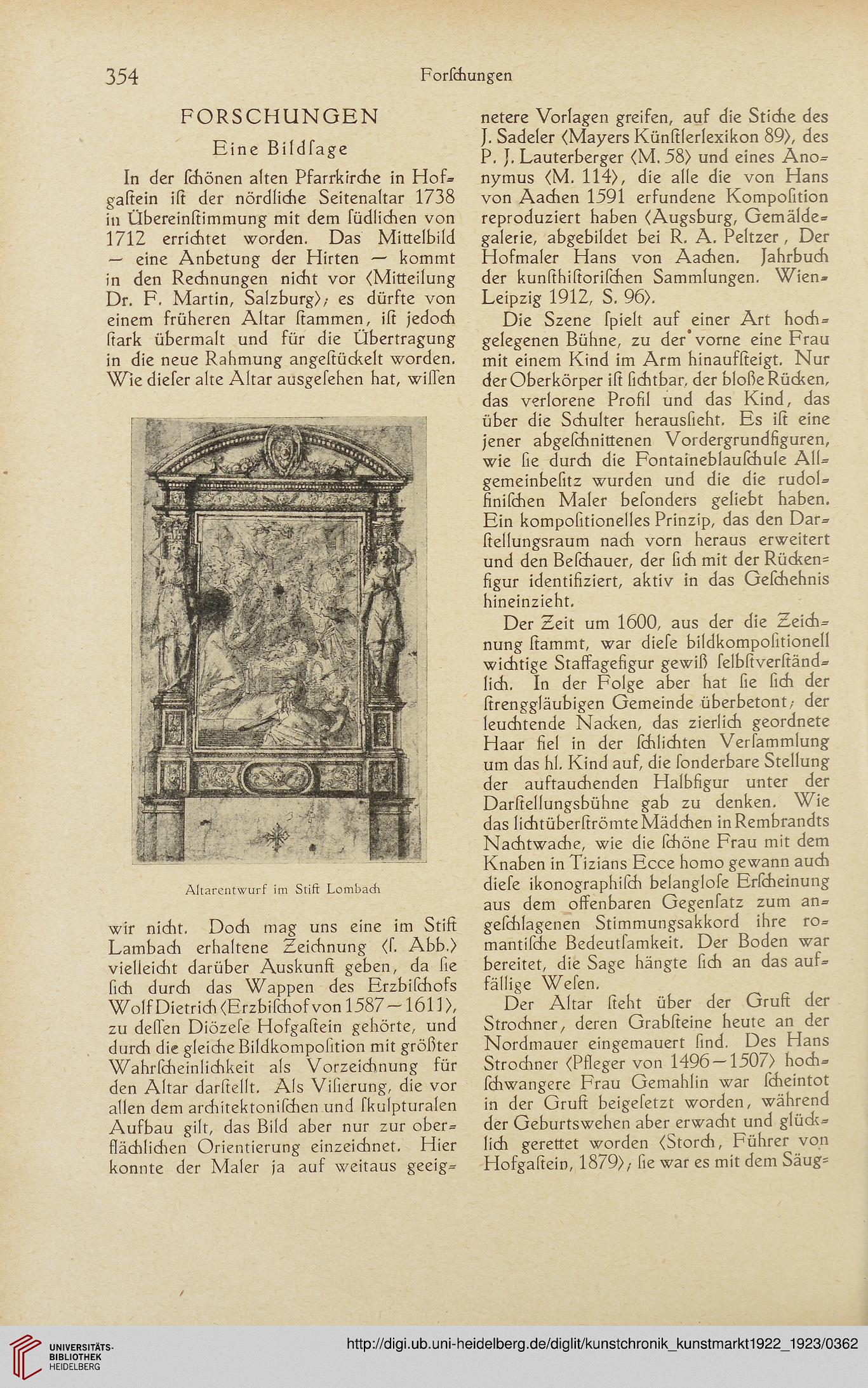354
Forfchungen
FORSCHUNGEN
Eine Bildfage
In der fchönen alten Pfarrkirche in Hof-
gaftein ift der nördliche Seitenaltar 1738
in Übereinftimmung mit dem leidlichen von
1712 errichtet worden. Das Mittelbild
— eine Anbetung der Hirten — kommt
in den Rechnungen nicht vor (Mitteilung
Dr. F. Martin, Salzburg),■ es dürfte von
einem früheren Altar ftammen, ift jedoch
fiark übermalt und für die Übertragung
in die neue Rahmung angeftückelt worden.
Wie diefer alte Altar ausgefehen hat, wißen
Altarentwurf im Stift Lombadi
wir nicht. Doch mag uns eine im Stift
Lambach erhaltene Zeichnung <f. Abb.)
vielleicht darüber Auskunft geben, da fie
fich durch das Wappen des Erzbifchofs
WolfDietrich (Erzbifchofvon 1587 —1611),
zu defl'en Diözele Hofgaftein gehörte, und
durch die gleiche Bildkompofition mit größter
Wahrfcheinlichkeit als Vorzeichnung für
den Altar darftellt. Als Vifierung, die vor
allen dem architektonifchen und fkulpturalen
Aufbau gilt, das Bild aber nur zur ober»
flächlidien Orientierung einzeichnet. Hier
konnte der Maler ja auf weitaus geeig-
netere Vorlagen greifen, auf die Stiche des
J. Sadeler (Mayers Künftlerlexikon 89), des
P. J. Lauterberger (M. 58) und eines Ano-
nymus (M. 114), die alle die von Hans
von Aachen 1591 erfundene Kompofition
reproduziert haben (Augsburg, Gemälde»
galerie, abgebildet bei R. A. Peltzer, Der
Hofmaler Hans von Aachen. Jahrbuch
der kunlthiftorifchen Sammlungen. Wien-
Leipzig 1912, S. 96).
Die Szene fpielt auf einer Art hoch»
gelegenen Bühne, zu der’vorne eine Frau
mit einem Kind im Arm hinauffteigt. Nur
der Oberkörper ift fichtbar, der bloße Rücken,
das verlorene Profil und das Kind, das
über die Schulter herausfieht. Es ift eine
jener abgefchnittenen Vordergrundfiguren,
wie fie durch die Fontaineblaulchule All»
gemeinbefitz wurden und die die rudol»
finifchen Maler befonders geliebt haben.
Ein kompofitionelles Prinzip, das den Dar»
ftellungsraum nach vorn heraus erweitert
und den Befchauer, der fich mit der Rücken-
figur identifiziert, aktiv in das Gefchehnis
hineinzieht.
Der Zeit um 1600, aus der die Zeich»
nung flammt, war diefe bildkompofitionell
wichtige Staffagefigur gewiß felbfiverftänd»
lieh. In der Folge aber hat fie fich der
ftrenggläubigen Gemeinde überbetont,- der
leuchtende Nacken, das zierlich geordnete
Haar fiel in der fchlichten Verfammlung
um das hl. Kind auf, die fonderbare Stellung
der auftauchenden Halbfigur unter der
Darfiellungsbühne gab zu denken. Wie
das lichtüberftrömte Mädchen in Rembrandts
Nachtwache, wie die fchöne Frau mit dem
Knaben in Tizians Ecce homo gewann auch
diefe ikonographifch belanglofe Erfcheinung
aus dem offenbaren Gegenfatz zum an»
gefchlagenen Stimmungsakkord ihre ro-
mantifche Bedeutfainkeit. Der Boden war
bereitet, die Sage hängte fich an das auf-
fällige Wefen.
Der Altar fleht über der Gruft der
Strochner, deren Grabfteine heute an der
Nordmauer eingemauert find. Des Hans
Strochner (Pfleger von 1496 —1507) hoch-
fchwangere Frau Gemahlin war fcheintot
in der Gruft beigefetzt worden, während
der Geburtswehen aber erwacht und glück-
lich gerettet worden (Storch, Führer von
Hofgaftein, 1879),- fie war es mit dem Säug=
Forfchungen
FORSCHUNGEN
Eine Bildfage
In der fchönen alten Pfarrkirche in Hof-
gaftein ift der nördliche Seitenaltar 1738
in Übereinftimmung mit dem leidlichen von
1712 errichtet worden. Das Mittelbild
— eine Anbetung der Hirten — kommt
in den Rechnungen nicht vor (Mitteilung
Dr. F. Martin, Salzburg),■ es dürfte von
einem früheren Altar ftammen, ift jedoch
fiark übermalt und für die Übertragung
in die neue Rahmung angeftückelt worden.
Wie diefer alte Altar ausgefehen hat, wißen
Altarentwurf im Stift Lombadi
wir nicht. Doch mag uns eine im Stift
Lambach erhaltene Zeichnung <f. Abb.)
vielleicht darüber Auskunft geben, da fie
fich durch das Wappen des Erzbifchofs
WolfDietrich (Erzbifchofvon 1587 —1611),
zu defl'en Diözele Hofgaftein gehörte, und
durch die gleiche Bildkompofition mit größter
Wahrfcheinlichkeit als Vorzeichnung für
den Altar darftellt. Als Vifierung, die vor
allen dem architektonifchen und fkulpturalen
Aufbau gilt, das Bild aber nur zur ober»
flächlidien Orientierung einzeichnet. Hier
konnte der Maler ja auf weitaus geeig-
netere Vorlagen greifen, auf die Stiche des
J. Sadeler (Mayers Künftlerlexikon 89), des
P. J. Lauterberger (M. 58) und eines Ano-
nymus (M. 114), die alle die von Hans
von Aachen 1591 erfundene Kompofition
reproduziert haben (Augsburg, Gemälde»
galerie, abgebildet bei R. A. Peltzer, Der
Hofmaler Hans von Aachen. Jahrbuch
der kunlthiftorifchen Sammlungen. Wien-
Leipzig 1912, S. 96).
Die Szene fpielt auf einer Art hoch»
gelegenen Bühne, zu der’vorne eine Frau
mit einem Kind im Arm hinauffteigt. Nur
der Oberkörper ift fichtbar, der bloße Rücken,
das verlorene Profil und das Kind, das
über die Schulter herausfieht. Es ift eine
jener abgefchnittenen Vordergrundfiguren,
wie fie durch die Fontaineblaulchule All»
gemeinbefitz wurden und die die rudol»
finifchen Maler befonders geliebt haben.
Ein kompofitionelles Prinzip, das den Dar»
ftellungsraum nach vorn heraus erweitert
und den Befchauer, der fich mit der Rücken-
figur identifiziert, aktiv in das Gefchehnis
hineinzieht.
Der Zeit um 1600, aus der die Zeich»
nung flammt, war diefe bildkompofitionell
wichtige Staffagefigur gewiß felbfiverftänd»
lieh. In der Folge aber hat fie fich der
ftrenggläubigen Gemeinde überbetont,- der
leuchtende Nacken, das zierlich geordnete
Haar fiel in der fchlichten Verfammlung
um das hl. Kind auf, die fonderbare Stellung
der auftauchenden Halbfigur unter der
Darfiellungsbühne gab zu denken. Wie
das lichtüberftrömte Mädchen in Rembrandts
Nachtwache, wie die fchöne Frau mit dem
Knaben in Tizians Ecce homo gewann auch
diefe ikonographifch belanglofe Erfcheinung
aus dem offenbaren Gegenfatz zum an»
gefchlagenen Stimmungsakkord ihre ro-
mantifche Bedeutfainkeit. Der Boden war
bereitet, die Sage hängte fich an das auf-
fällige Wefen.
Der Altar fleht über der Gruft der
Strochner, deren Grabfteine heute an der
Nordmauer eingemauert find. Des Hans
Strochner (Pfleger von 1496 —1507) hoch-
fchwangere Frau Gemahlin war fcheintot
in der Gruft beigefetzt worden, während
der Geburtswehen aber erwacht und glück-
lich gerettet worden (Storch, Führer von
Hofgaftein, 1879),- fie war es mit dem Säug=