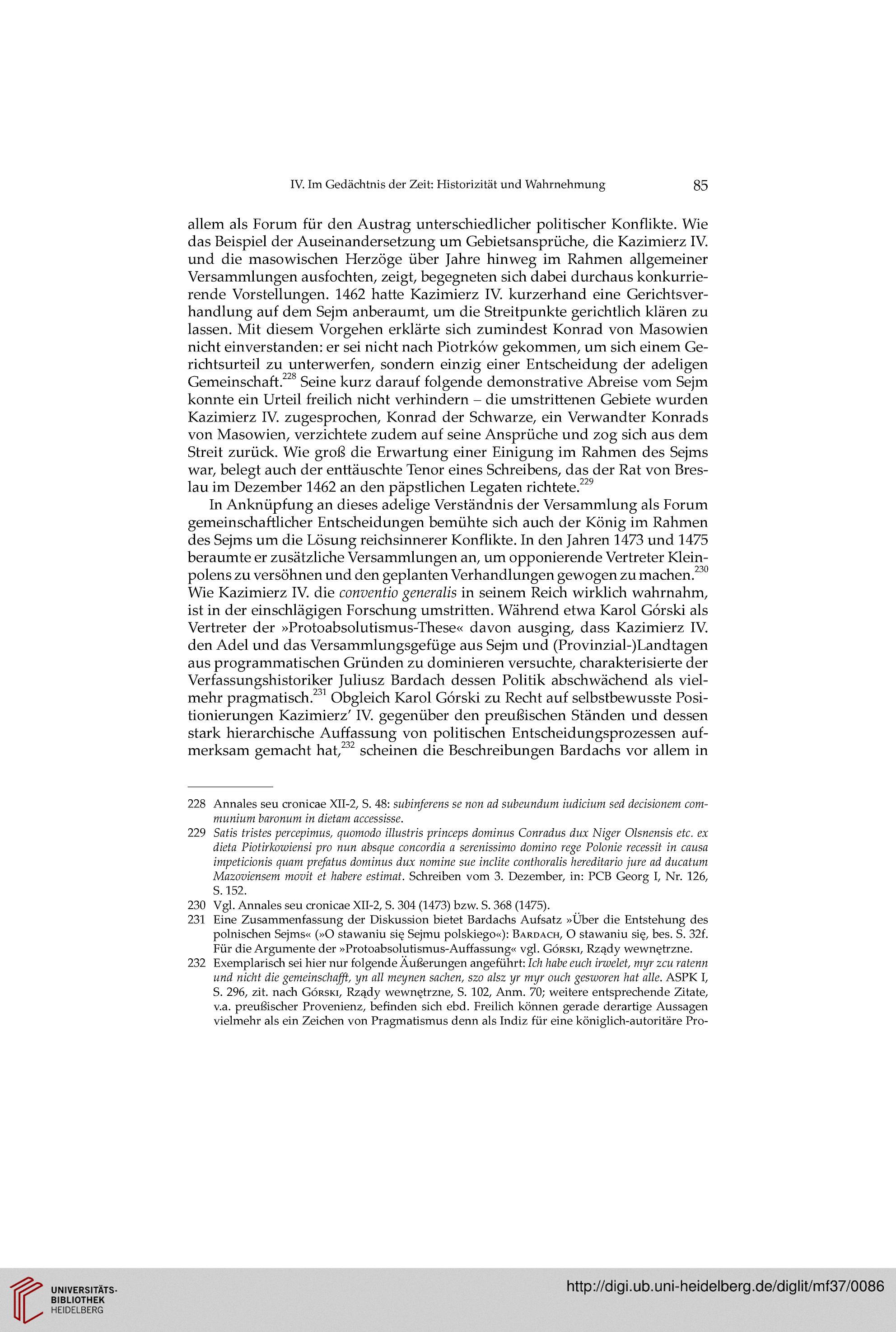IV. Im Gedächtnis der Zeit: Historizität und Wahrnehmung
85
allem als Forum für den Austrag unterschiedlicher politischer Konflikte. Wie
das Beispiel der Auseinandersetzung um Gebietsansprüche, die Kazimierz IV.
und die masowischen Herzoge über Jahre hinweg im Rahmen allgemeiner
Versammlungen ausfochten, zeigt, begegneten sich dabei durchaus konkurrie-
rende Vorstellungen. 1462 hatte Kazimierz IV. kurzerhand eine Gerichtsver-
handlung auf dem Sejm anberaumt, um die Streitpunkte gerichtlich klären zu
lassen. Mit diesem Vorgehen erklärte sich zumindest Konrad von Masowien
nicht einverstanden: er sei nicht nach Piotrköw gekommen, um sich einem Ge-
richtsurteil zu unterwerfen, sondern einzig einer Entscheidung der adeligen
Gemeinschaft.^ Seine kurz darauf folgende demonstrative Abreise vom Sejm
konnte ein Urteil freilich nicht verhindern - die umstrittenen Gebiete wurden
Kazimierz IV. zugesprochen, Konrad der Schwarze, ein Verwandter Konrads
von Masowien, verzichtete zudem auf seine Ansprüche und zog sich aus dem
Streit zurück. Wie groß die Erwartung einer Einigung im Rahmen des Sejms
war, belegt auch der enttäuschte Tenor eines Schreibens, das der Rat von Bres-
lau im Dezember 1462 an den päpstlichen Legaten richtete.^
In Anknüpfung an dieses adelige Verständnis der Versammlung als Forum
gemeinschaftlicher Entscheidungen bemühte sich auch der König im Rahmen
des Sejms um die Lösung reichsinnerer Konflikte. In den Jahren 1473 und 1475
beraumte er zusätzliche Versammlungen an, um opponierende Vertreter Klein-
polens zu versöhnen und den geplanten Verhandlungen gewogen zu machen.^"
Wie Kazimierz IV. die coTwenho gcncrdüs in seinem Reich wirklich wahrnahm,
ist in der einschlägigen Forschung umstritten. Während etwa Karol Görski als
Vertreter der »Protoabsolutismus-These« davon ausging, dass Kazimierz IV.
den Adel und das Versammlungsgefüge aus Sejm und (Provinzial-)Landtagen
aus programmatischen Gründen zu dominieren versuchte, charakterisierte der
Verfassungshistoriker Juliusz Bardach dessen Politik abschwächend als viel-
mehr pragmatisch.^ Obgleich Karol Görski zu Recht auf selbstbewusste Posi-
tionierungen Kazimierz' IV. gegenüber den preußischen Ständen und dessen
stark hierarchische Auffassung von politischen Entscheidungsprozessen auf-
merksam gemacht hat/^ scheinen die Beschreibungen Bardachs vor allem in
228 Annales seu cronicae XII-2, S. 48: SMdm/breMS so mm ad SMdoMMdMm mddmm sed dedsdwem com-
daroMMm m diefam accessisse.
229 Saü's tristes percepimMS, ^Momodo idMstris prmceps dommMS CowadMS dMX Niger OisweMsis de. ex
dieta Piotirdowiensi pro mm ads^Me comordia a serem'ssimo dommo rege Poiom'e reeessit m eaMsa
impetieionis (?Mam pre/ätMS dommMS dMX nomine sne melde coMldorad's dereditario jnre ad dneatnrn
MazotdeMsem mooit et dadere estiniat. Schreiben vom 3. Dezember, in: PCB Georg I, Nr. 126,
S.152.
230 Vgl. Annales seu cronicae XII-2, S. 304 (1473) bzw. S. 368 (1475).
231 Eine Zusammenfassung der Diskussion bietet Bardachs Aufsatz »Uber die Entstehung des
polnischen Sejms« (»O stawaniu si§ Sejmu polskiego«): BARDACH, O stawaniu si§, bes. S. 32f.
Für die Argumente der »Protoabsolutismus-Auffassung« vgl. GÖRSKi, Rzqdy wewn^trzne.
232 Exemplarisch sei hier nur folgende Äußerungen angeführt: led dadc ened irweiet, nu/r zen ratenn
nnd niedt die gemeinscda(jd, pn ad mei/nen saeden, szo aisz i/r nu/r OMcd gesworen dat ade. ASPK I,
S. 296, zit. nach GÖRSKi, Rzqdy wewn^trzne, S. 102, Anm. 70; weitere entsprechende Zitate,
v.a. preußischer Provenienz, befinden sich ebd. Freilich können gerade derartige Aussagen
vielmehr als ein Zeichen von Pragmatismus denn als Indiz für eine königlich-autoritäre Pro-
85
allem als Forum für den Austrag unterschiedlicher politischer Konflikte. Wie
das Beispiel der Auseinandersetzung um Gebietsansprüche, die Kazimierz IV.
und die masowischen Herzoge über Jahre hinweg im Rahmen allgemeiner
Versammlungen ausfochten, zeigt, begegneten sich dabei durchaus konkurrie-
rende Vorstellungen. 1462 hatte Kazimierz IV. kurzerhand eine Gerichtsver-
handlung auf dem Sejm anberaumt, um die Streitpunkte gerichtlich klären zu
lassen. Mit diesem Vorgehen erklärte sich zumindest Konrad von Masowien
nicht einverstanden: er sei nicht nach Piotrköw gekommen, um sich einem Ge-
richtsurteil zu unterwerfen, sondern einzig einer Entscheidung der adeligen
Gemeinschaft.^ Seine kurz darauf folgende demonstrative Abreise vom Sejm
konnte ein Urteil freilich nicht verhindern - die umstrittenen Gebiete wurden
Kazimierz IV. zugesprochen, Konrad der Schwarze, ein Verwandter Konrads
von Masowien, verzichtete zudem auf seine Ansprüche und zog sich aus dem
Streit zurück. Wie groß die Erwartung einer Einigung im Rahmen des Sejms
war, belegt auch der enttäuschte Tenor eines Schreibens, das der Rat von Bres-
lau im Dezember 1462 an den päpstlichen Legaten richtete.^
In Anknüpfung an dieses adelige Verständnis der Versammlung als Forum
gemeinschaftlicher Entscheidungen bemühte sich auch der König im Rahmen
des Sejms um die Lösung reichsinnerer Konflikte. In den Jahren 1473 und 1475
beraumte er zusätzliche Versammlungen an, um opponierende Vertreter Klein-
polens zu versöhnen und den geplanten Verhandlungen gewogen zu machen.^"
Wie Kazimierz IV. die coTwenho gcncrdüs in seinem Reich wirklich wahrnahm,
ist in der einschlägigen Forschung umstritten. Während etwa Karol Görski als
Vertreter der »Protoabsolutismus-These« davon ausging, dass Kazimierz IV.
den Adel und das Versammlungsgefüge aus Sejm und (Provinzial-)Landtagen
aus programmatischen Gründen zu dominieren versuchte, charakterisierte der
Verfassungshistoriker Juliusz Bardach dessen Politik abschwächend als viel-
mehr pragmatisch.^ Obgleich Karol Görski zu Recht auf selbstbewusste Posi-
tionierungen Kazimierz' IV. gegenüber den preußischen Ständen und dessen
stark hierarchische Auffassung von politischen Entscheidungsprozessen auf-
merksam gemacht hat/^ scheinen die Beschreibungen Bardachs vor allem in
228 Annales seu cronicae XII-2, S. 48: SMdm/breMS so mm ad SMdoMMdMm mddmm sed dedsdwem com-
daroMMm m diefam accessisse.
229 Saü's tristes percepimMS, ^Momodo idMstris prmceps dommMS CowadMS dMX Niger OisweMsis de. ex
dieta Piotirdowiensi pro mm ads^Me comordia a serem'ssimo dommo rege Poiom'e reeessit m eaMsa
impetieionis (?Mam pre/ätMS dommMS dMX nomine sne melde coMldorad's dereditario jnre ad dneatnrn
MazotdeMsem mooit et dadere estiniat. Schreiben vom 3. Dezember, in: PCB Georg I, Nr. 126,
S.152.
230 Vgl. Annales seu cronicae XII-2, S. 304 (1473) bzw. S. 368 (1475).
231 Eine Zusammenfassung der Diskussion bietet Bardachs Aufsatz »Uber die Entstehung des
polnischen Sejms« (»O stawaniu si§ Sejmu polskiego«): BARDACH, O stawaniu si§, bes. S. 32f.
Für die Argumente der »Protoabsolutismus-Auffassung« vgl. GÖRSKi, Rzqdy wewn^trzne.
232 Exemplarisch sei hier nur folgende Äußerungen angeführt: led dadc ened irweiet, nu/r zen ratenn
nnd niedt die gemeinscda(jd, pn ad mei/nen saeden, szo aisz i/r nu/r OMcd gesworen dat ade. ASPK I,
S. 296, zit. nach GÖRSKi, Rzqdy wewn^trzne, S. 102, Anm. 70; weitere entsprechende Zitate,
v.a. preußischer Provenienz, befinden sich ebd. Freilich können gerade derartige Aussagen
vielmehr als ein Zeichen von Pragmatismus denn als Indiz für eine königlich-autoritäre Pro-