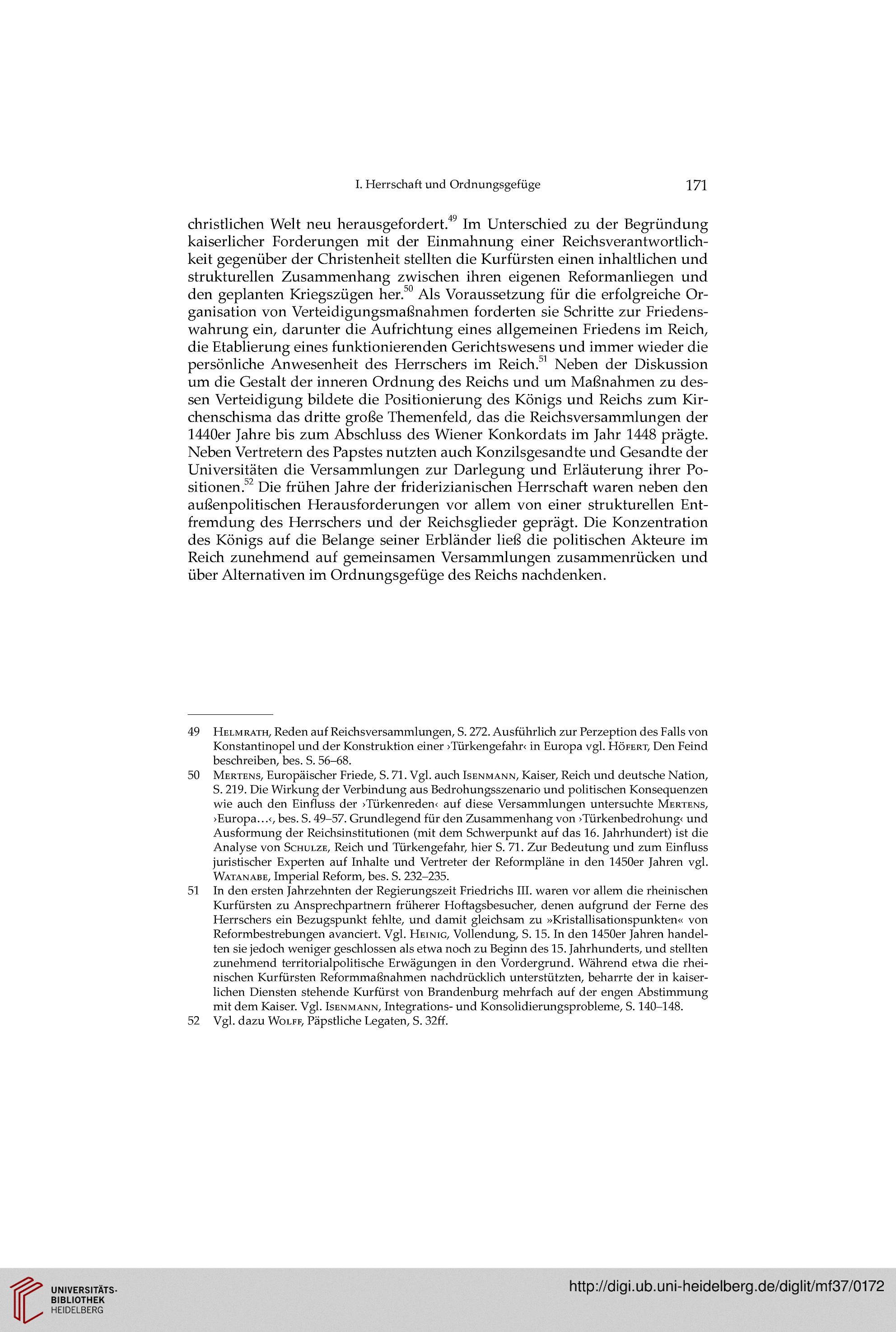I. Herrschaft und Ordnungsgefüge
171
christlichen Welt neu herausgefordert."" Im Unterschied zu der Begründung
kaiserlicher Forderungen mit der Einmahnung einer Reichsverantwortlich-
keit gegenüber der Christenheit stellten die Kurfürsten einen inhaltlichen und
strukturellen Zusammenhang zwischen ihren eigenen Reformanliegen und
den geplanten Kriegszügen her.''" Als Voraussetzung für die erfolgreiche Or-
ganisation von Verteidigungsmaßnahmen forderten sie Schritte zur Friedens-
wahrung ein, darunter die Aufrichtung eines allgemeinen Friedens im Reich,
die Etablierung eines funktionierenden Gerichtswesens und immer wieder die
persönliche Anwesenheit des Herrschers im Reicht Neben der Diskussion
um die Gestalt der inneren Ordnung des Reichs und um Maßnahmen zu des-
sen Verteidigung bildete die Positionierung des Königs und Reichs zum Kir-
chenschisma das dritte große Themenfeld, das die Reichsversammlungen der
1440er Jahre bis zum Abschluss des Wiener Konkordats im Jahr 1448 prägte.
Neben Vertretern des Papstes nutzten auch Konzilsgesandte und Gesandte der
Universitäten die Versammlungen zur Darlegung und Erläuterung ihrer Po-
sitionen.^ Die frühen Jahre der friderizianischen Herrschaft waren neben den
außenpolitischen Herausforderungen vor allem von einer strukturellen Ent-
fremdung des Herrschers und der Reichsglieder geprägt. Die Konzentration
des Königs auf die Belange seiner Erbländer ließ die politischen Akteure im
Reich zunehmend auf gemeinsamen Versammlungen zusammenrücken und
über Alternativen im Ordnungsgefüge des Reichs nachdenken.
49 HELMRATH, Reden auf Reichsversammlungen, S. 272. Ausführlich zur Perzeption des Falls von
Konstantinopel und der Konstruktion einer >Türkengefahr< in Europa vgl. HÖFERT, Den Feind
beschreiben, bes. S. 56-68.
50 MERTENS, Europäischer Friede, S. 71. Vgl. auch IsENMANN, Kaiser, Reich und deutsche Nation,
S. 219. Die Wirkung der Verbindung aus Bedrohungsszenario und politischen Konsequenzen
wie auch den Einfluss der >Türkenreden< auf diese Versammlungen untersuchte MERTENS,
>Europa.. .<, bes. S. 49-57. Grundlegend für den Zusammenhang von >Türkenbedrohung< und
Ausformung der Reichsinstitutionen (mit dem Schwerpunkt auf das 16. Jahrhundert) ist die
Analyse von SCHULZE, Reich und Türkengefahr, hier S. 71. Zur Bedeutung und zum Einfluss
juristischer Experten auf Inhalte und Vertreter der Reformpläne in den 1450er Jahren vgl.
WATANABE, Imperial Reform, bes. S. 232-235.
51 In den ersten Jahrzehnten der Regierungszeit Friedrichs III. waren vor allem die rheinischen
Kurfürsten zu Ansprechpartnern früherer Hoftagsbesucher, denen aufgrund der Ferne des
Herrschers ein Bezugspunkt fehlte, und damit gleichsam zu »Kristallisationspunkten« von
Reformbestrebungen avanciert. Vgl. HEiNiG, Vollendung, S. 15. In den 1450er Jahren handel-
ten sie jedoch weniger geschlossen als etwa noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts, und stellten
zunehmend territorialpolitische Erwägungen in den Vordergrund. Während etwa die rhei-
nischen Kurfürsten Reformmaßnahmen nachdrücklich unterstützten, beharrte der in kaiser-
lichen Diensten stehende Kurfürst von Brandenburg mehrfach auf der engen Abstimmung
mit dem Kaiser. Vgl. IsENMANN, Integrations- und Konsolidierungsprobleme, S. 140-148.
52 Vgl. dazu WoLFF, Päpstliche Legaten, S. 32ff.
171
christlichen Welt neu herausgefordert."" Im Unterschied zu der Begründung
kaiserlicher Forderungen mit der Einmahnung einer Reichsverantwortlich-
keit gegenüber der Christenheit stellten die Kurfürsten einen inhaltlichen und
strukturellen Zusammenhang zwischen ihren eigenen Reformanliegen und
den geplanten Kriegszügen her.''" Als Voraussetzung für die erfolgreiche Or-
ganisation von Verteidigungsmaßnahmen forderten sie Schritte zur Friedens-
wahrung ein, darunter die Aufrichtung eines allgemeinen Friedens im Reich,
die Etablierung eines funktionierenden Gerichtswesens und immer wieder die
persönliche Anwesenheit des Herrschers im Reicht Neben der Diskussion
um die Gestalt der inneren Ordnung des Reichs und um Maßnahmen zu des-
sen Verteidigung bildete die Positionierung des Königs und Reichs zum Kir-
chenschisma das dritte große Themenfeld, das die Reichsversammlungen der
1440er Jahre bis zum Abschluss des Wiener Konkordats im Jahr 1448 prägte.
Neben Vertretern des Papstes nutzten auch Konzilsgesandte und Gesandte der
Universitäten die Versammlungen zur Darlegung und Erläuterung ihrer Po-
sitionen.^ Die frühen Jahre der friderizianischen Herrschaft waren neben den
außenpolitischen Herausforderungen vor allem von einer strukturellen Ent-
fremdung des Herrschers und der Reichsglieder geprägt. Die Konzentration
des Königs auf die Belange seiner Erbländer ließ die politischen Akteure im
Reich zunehmend auf gemeinsamen Versammlungen zusammenrücken und
über Alternativen im Ordnungsgefüge des Reichs nachdenken.
49 HELMRATH, Reden auf Reichsversammlungen, S. 272. Ausführlich zur Perzeption des Falls von
Konstantinopel und der Konstruktion einer >Türkengefahr< in Europa vgl. HÖFERT, Den Feind
beschreiben, bes. S. 56-68.
50 MERTENS, Europäischer Friede, S. 71. Vgl. auch IsENMANN, Kaiser, Reich und deutsche Nation,
S. 219. Die Wirkung der Verbindung aus Bedrohungsszenario und politischen Konsequenzen
wie auch den Einfluss der >Türkenreden< auf diese Versammlungen untersuchte MERTENS,
>Europa.. .<, bes. S. 49-57. Grundlegend für den Zusammenhang von >Türkenbedrohung< und
Ausformung der Reichsinstitutionen (mit dem Schwerpunkt auf das 16. Jahrhundert) ist die
Analyse von SCHULZE, Reich und Türkengefahr, hier S. 71. Zur Bedeutung und zum Einfluss
juristischer Experten auf Inhalte und Vertreter der Reformpläne in den 1450er Jahren vgl.
WATANABE, Imperial Reform, bes. S. 232-235.
51 In den ersten Jahrzehnten der Regierungszeit Friedrichs III. waren vor allem die rheinischen
Kurfürsten zu Ansprechpartnern früherer Hoftagsbesucher, denen aufgrund der Ferne des
Herrschers ein Bezugspunkt fehlte, und damit gleichsam zu »Kristallisationspunkten« von
Reformbestrebungen avanciert. Vgl. HEiNiG, Vollendung, S. 15. In den 1450er Jahren handel-
ten sie jedoch weniger geschlossen als etwa noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts, und stellten
zunehmend territorialpolitische Erwägungen in den Vordergrund. Während etwa die rhei-
nischen Kurfürsten Reformmaßnahmen nachdrücklich unterstützten, beharrte der in kaiser-
lichen Diensten stehende Kurfürst von Brandenburg mehrfach auf der engen Abstimmung
mit dem Kaiser. Vgl. IsENMANN, Integrations- und Konsolidierungsprobleme, S. 140-148.
52 Vgl. dazu WoLFF, Päpstliche Legaten, S. 32ff.