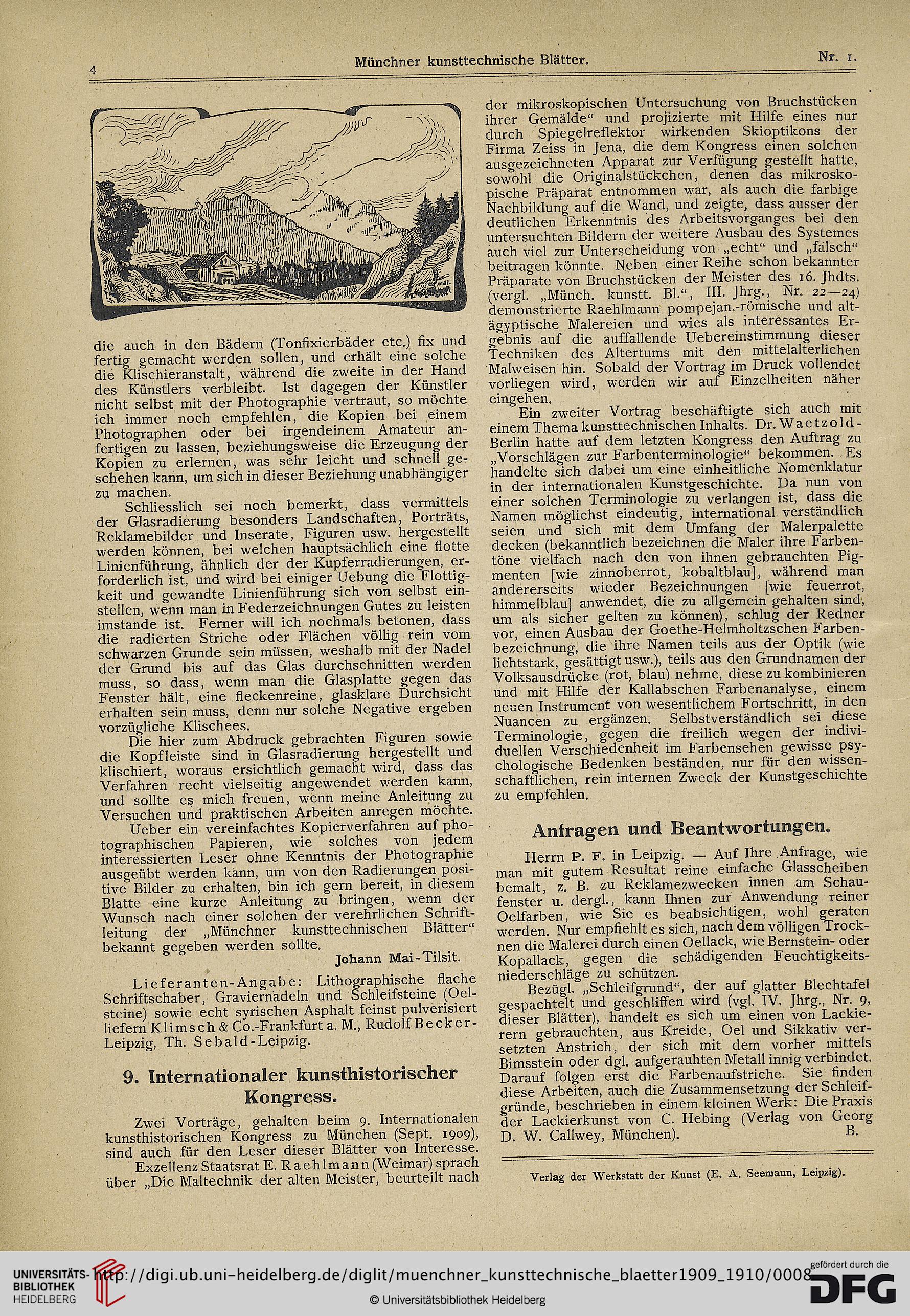4
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. t.
die auch in den Bädern (TonHxierbäder etc.) Hx und
fertig gemacht werden solien, und erhäit eine sotche
die Klischieranstalt, während die zweite in der Hand
des Künstiers verbleibt. Ist dagegen der Künstier
nicht seibst mit der Photographie vertraut, so möchte
ich immer noch empfehien, die Kopien bei einem
Photographen oder bei irgendeinem Amateur an-
fertigen zu lassen, beziehungsweise die Erzeugung der
Kopien zu eriernen, was sehr ieicht und schneit ge-
schehen kann, um sich in dieser Beziehung unabhängiger
zu machen.
Schiiessiich sei noch bemerkt, dass vermitteis
der Giasradierung besonders Landschaften, Porträts,
Rekiamebiider und Inserate, Figuren usw. hergesteiit
werden können, bei weichen hauptsächiich eine Hotte
Linienführung, ähnlich der der Kupferradierungen, er-
forderlich ist, und wird bei einiger Uebung die Flottig-
keit und gewandte Linienführung sich von selbst ein-
stellen, wenn man in Federzeichnungen Gutes zu leisten
imstande ist. Ferner will ich nochmals betonen, dass
die radierten Striche oder Flächen völlig rein vom
schwarzen Grunde sein müssen, weshalb mit der Nadel
der Grund bis auf das Glas durchschnitten werden
muss, so dass, wenn man die Glasplatte gegen das
Fenster hält, eine Heckenreine, glasklare Durchsicht
erhalten sein muss, denn nur solche Negative ergeben
vorzügliche Klischees.
Die hier zum Abdruck gebrachten Figuren sowie
die Kopfleiste sind in Glasradierung hergestellt und
klischiert, woraus ersichtlich gemacht wird, dass das
Verfahren recht vielseitig angewendet werden kann,
und sollte es mich freuen, wenn meine Anleitung zu
Versuchen und praktischen Arbeiten anregen möchte.
Ueber ein vereinfachtes Kopierverfahren auf pho-
tographischen Papieren, wie solches von jedem
interessierten Leser ohne Kenntnis der Photographie
ausgeübt werden kann, um von den Radierungen posi-
tive Bilder zu erhalten, bin ich gern bereit, in diesem
Blatte eine kurze Anleitung zu bringen, wenn der
Wunsch nach einer solchen der verehrlichen Schrift-
leitung der „Münchner kunsttechnischen Blätter"
bekannt gegeben werden sollte.
Johann Mai-Tilsit.
Lieferanten-Angabe: Lithographische Hache
Schriftschaber, Graviernadeln und Schleifsteine (Oel-
steine) sowie echt syrischen Asphalt feinst pulverisiert
liefern Klimsch & Co.-Frankfurt a. M., Rudolf Becker-
Leipzig, Th. Sebald-Leipzig.
9. internationaler kunsthistorischer
Kongress.
Zwei Vorträge, gehalten beim 9. Internationalen
kunsthistorischen Kongress zu München (Sept. 1909),
sind auch für den Leser dieser Blätter von Interesse.
Exzellenz Staatsrat E. Raeh 1 mann (Weimar) sprach
über „Die Maltechnik der alten Meister, beurteilt nach
der mikroskopischen Untersuchung von Bruchstücken
ihrer Gemälde" und projizierte mit Hilfe eines nur
durch Spiegelreflektor wirkenden Skioptikons der
Firma Zeiss in Jena, die dem Kongress einen solchen
ausgezeichneten Apparat zur Verfügung gestellt hatte,
sowohl die Originalstückchen, denen das mikrosko-
pische Präparat entnommen war, als auch die farbige
Nachbildung auf die Wand, und zeigte, dass ausser der
deutlichen Erkenntnis des Arbeitsvorganges bei den
untersuchten Bildern der weitere Ausbau des Systemes
auch viel zur Unterscheidung von „echt" und „falsch"
beitragen könnte. Neben einer Reihe schon bekannter
Präparate von Bruchstücken der Meister des t6. Jhdts.
(vergl. „Münch, kunstt. Bl.", III. Jhrg., Nr. 22—24)
demonstrierte Raehlmann pompejan.-römische und alt-
ägyptische Malereien und wies als interessantes Er-
gebnis auf die auffallende Uebereinstimmung dieser
Techniken des Altertums mit den mittelalterlichen
Malweisen hin. Sobald der Vortrag im Druck vollendet
vorliegen wird, werden wir auf Einzelheiten näher
eingehen.
Ein zweiter Vortrag beschäftigte sich auch mit
einem Thema kunsttechnischen Inhalts. Dr. Waetzold-
Berlin hatte auf dem letzten Kongress den Auftrag zu
„Vorschlägen zur Farbenterminologie" bekommen. Es
handelte sich dabei um eine einheitliche Nomenklatur
in der internationalen Kunstgeschichte. Da nun von
einer solchen Terminologie zu verlangen ist, dass die
Namen möglichst eindeutig, international verständlich
seien und sich mit dem Umfang der Malerpalette
decken (bekanntlich bezeichnen die Maler ihre Farben-
töne vielfach nach den von ihnen gebrauchten Pig-
menten [wie zinnoberrot, kobaltblau], während man
andererseits wieder Bezeichnungen [wie feuerrot,
himmelblau] anwendet, die zu allgemein gehalten sind,
um als sicher gelten zu können), schlug der Redner
vor, einen Ausbau der Goethe-Heimholtzschen Farben-
bezeichnung, die ihre Namen teils aus der Optik (wie
lichtstark, gesättigt usw.), teils aus den Grundnamen der
Volksausdrücke (rot, blau) nehme, diese zu kombinieren
und mit Hilfe der Kallabschen Farbenanalyse, einem
neuen Instrument von wesentlichem Fortschritt, in den
Nuancen zu ergänzen. Selbstverständlich sei diese
Terminologie, gegen die freilich wegen der indivi-
duellen Verschiedenheit im Farbensehen gewisse psy-
chologische Bedenken beständen, nur für den wissen-
schaftlichen, rein internen Zweck der Kunstgeschichte
zu empfehlen.
Anträgen und Beantwortungen.
Herrn P. F. in Leipzig. — Auf Ihre Anfrage, wie
man mit gutem Resultat reine einfache Glasscheiben
bemalt, z. B. zu Reklamezwecken innen am Schau-
fenster u. dergh, kann Ihnen zur Anwendung reiner
Oelfarben, wie Sie es beabsichtigen, wohl geraten
werden. Nur empñehlt es sich, nach dem völligen Trock-
nen die Malerei durch einen Oellack, wie Bernstein- oder
Kopallack, gegen die schädigenden Feuchtigkeits-
niederschläge zu schützen.
Bezügl. „Schleifgrund", der auf glatter Blechtafel
gespachtelt und geschliffen wird (vgl. IV. Jhrg., Nr. 9,
dieser Blätter), handelt es sich um einen von Lackie-
rern gebrauchten, aus Kreide, Oel und Sikkativ ver-
setzten Anstrich, der sich mit dem vorher mittels
Bimsstein oder dgl. aufgerauhten Metall innig verbindet.
Darauf folgen erst die Farbenaufstriche. Sie finden
diese Arbeiten, auch die Zusammensetzung der Schleif-
gründe, beschrieben in einem kleinen Werk: Die Praxis
der Lackierkunst von C. Hebing (Verlag von Georg
D. W. Callwey, München). B.
Verlag der Werkstatt der Kunst (E. A. Seemann, Leipzig).
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. t.
die auch in den Bädern (TonHxierbäder etc.) Hx und
fertig gemacht werden solien, und erhäit eine sotche
die Klischieranstalt, während die zweite in der Hand
des Künstiers verbleibt. Ist dagegen der Künstier
nicht seibst mit der Photographie vertraut, so möchte
ich immer noch empfehien, die Kopien bei einem
Photographen oder bei irgendeinem Amateur an-
fertigen zu lassen, beziehungsweise die Erzeugung der
Kopien zu eriernen, was sehr ieicht und schneit ge-
schehen kann, um sich in dieser Beziehung unabhängiger
zu machen.
Schiiessiich sei noch bemerkt, dass vermitteis
der Giasradierung besonders Landschaften, Porträts,
Rekiamebiider und Inserate, Figuren usw. hergesteiit
werden können, bei weichen hauptsächiich eine Hotte
Linienführung, ähnlich der der Kupferradierungen, er-
forderlich ist, und wird bei einiger Uebung die Flottig-
keit und gewandte Linienführung sich von selbst ein-
stellen, wenn man in Federzeichnungen Gutes zu leisten
imstande ist. Ferner will ich nochmals betonen, dass
die radierten Striche oder Flächen völlig rein vom
schwarzen Grunde sein müssen, weshalb mit der Nadel
der Grund bis auf das Glas durchschnitten werden
muss, so dass, wenn man die Glasplatte gegen das
Fenster hält, eine Heckenreine, glasklare Durchsicht
erhalten sein muss, denn nur solche Negative ergeben
vorzügliche Klischees.
Die hier zum Abdruck gebrachten Figuren sowie
die Kopfleiste sind in Glasradierung hergestellt und
klischiert, woraus ersichtlich gemacht wird, dass das
Verfahren recht vielseitig angewendet werden kann,
und sollte es mich freuen, wenn meine Anleitung zu
Versuchen und praktischen Arbeiten anregen möchte.
Ueber ein vereinfachtes Kopierverfahren auf pho-
tographischen Papieren, wie solches von jedem
interessierten Leser ohne Kenntnis der Photographie
ausgeübt werden kann, um von den Radierungen posi-
tive Bilder zu erhalten, bin ich gern bereit, in diesem
Blatte eine kurze Anleitung zu bringen, wenn der
Wunsch nach einer solchen der verehrlichen Schrift-
leitung der „Münchner kunsttechnischen Blätter"
bekannt gegeben werden sollte.
Johann Mai-Tilsit.
Lieferanten-Angabe: Lithographische Hache
Schriftschaber, Graviernadeln und Schleifsteine (Oel-
steine) sowie echt syrischen Asphalt feinst pulverisiert
liefern Klimsch & Co.-Frankfurt a. M., Rudolf Becker-
Leipzig, Th. Sebald-Leipzig.
9. internationaler kunsthistorischer
Kongress.
Zwei Vorträge, gehalten beim 9. Internationalen
kunsthistorischen Kongress zu München (Sept. 1909),
sind auch für den Leser dieser Blätter von Interesse.
Exzellenz Staatsrat E. Raeh 1 mann (Weimar) sprach
über „Die Maltechnik der alten Meister, beurteilt nach
der mikroskopischen Untersuchung von Bruchstücken
ihrer Gemälde" und projizierte mit Hilfe eines nur
durch Spiegelreflektor wirkenden Skioptikons der
Firma Zeiss in Jena, die dem Kongress einen solchen
ausgezeichneten Apparat zur Verfügung gestellt hatte,
sowohl die Originalstückchen, denen das mikrosko-
pische Präparat entnommen war, als auch die farbige
Nachbildung auf die Wand, und zeigte, dass ausser der
deutlichen Erkenntnis des Arbeitsvorganges bei den
untersuchten Bildern der weitere Ausbau des Systemes
auch viel zur Unterscheidung von „echt" und „falsch"
beitragen könnte. Neben einer Reihe schon bekannter
Präparate von Bruchstücken der Meister des t6. Jhdts.
(vergl. „Münch, kunstt. Bl.", III. Jhrg., Nr. 22—24)
demonstrierte Raehlmann pompejan.-römische und alt-
ägyptische Malereien und wies als interessantes Er-
gebnis auf die auffallende Uebereinstimmung dieser
Techniken des Altertums mit den mittelalterlichen
Malweisen hin. Sobald der Vortrag im Druck vollendet
vorliegen wird, werden wir auf Einzelheiten näher
eingehen.
Ein zweiter Vortrag beschäftigte sich auch mit
einem Thema kunsttechnischen Inhalts. Dr. Waetzold-
Berlin hatte auf dem letzten Kongress den Auftrag zu
„Vorschlägen zur Farbenterminologie" bekommen. Es
handelte sich dabei um eine einheitliche Nomenklatur
in der internationalen Kunstgeschichte. Da nun von
einer solchen Terminologie zu verlangen ist, dass die
Namen möglichst eindeutig, international verständlich
seien und sich mit dem Umfang der Malerpalette
decken (bekanntlich bezeichnen die Maler ihre Farben-
töne vielfach nach den von ihnen gebrauchten Pig-
menten [wie zinnoberrot, kobaltblau], während man
andererseits wieder Bezeichnungen [wie feuerrot,
himmelblau] anwendet, die zu allgemein gehalten sind,
um als sicher gelten zu können), schlug der Redner
vor, einen Ausbau der Goethe-Heimholtzschen Farben-
bezeichnung, die ihre Namen teils aus der Optik (wie
lichtstark, gesättigt usw.), teils aus den Grundnamen der
Volksausdrücke (rot, blau) nehme, diese zu kombinieren
und mit Hilfe der Kallabschen Farbenanalyse, einem
neuen Instrument von wesentlichem Fortschritt, in den
Nuancen zu ergänzen. Selbstverständlich sei diese
Terminologie, gegen die freilich wegen der indivi-
duellen Verschiedenheit im Farbensehen gewisse psy-
chologische Bedenken beständen, nur für den wissen-
schaftlichen, rein internen Zweck der Kunstgeschichte
zu empfehlen.
Anträgen und Beantwortungen.
Herrn P. F. in Leipzig. — Auf Ihre Anfrage, wie
man mit gutem Resultat reine einfache Glasscheiben
bemalt, z. B. zu Reklamezwecken innen am Schau-
fenster u. dergh, kann Ihnen zur Anwendung reiner
Oelfarben, wie Sie es beabsichtigen, wohl geraten
werden. Nur empñehlt es sich, nach dem völligen Trock-
nen die Malerei durch einen Oellack, wie Bernstein- oder
Kopallack, gegen die schädigenden Feuchtigkeits-
niederschläge zu schützen.
Bezügl. „Schleifgrund", der auf glatter Blechtafel
gespachtelt und geschliffen wird (vgl. IV. Jhrg., Nr. 9,
dieser Blätter), handelt es sich um einen von Lackie-
rern gebrauchten, aus Kreide, Oel und Sikkativ ver-
setzten Anstrich, der sich mit dem vorher mittels
Bimsstein oder dgl. aufgerauhten Metall innig verbindet.
Darauf folgen erst die Farbenaufstriche. Sie finden
diese Arbeiten, auch die Zusammensetzung der Schleif-
gründe, beschrieben in einem kleinen Werk: Die Praxis
der Lackierkunst von C. Hebing (Verlag von Georg
D. W. Callwey, München). B.
Verlag der Werkstatt der Kunst (E. A. Seemann, Leipzig).