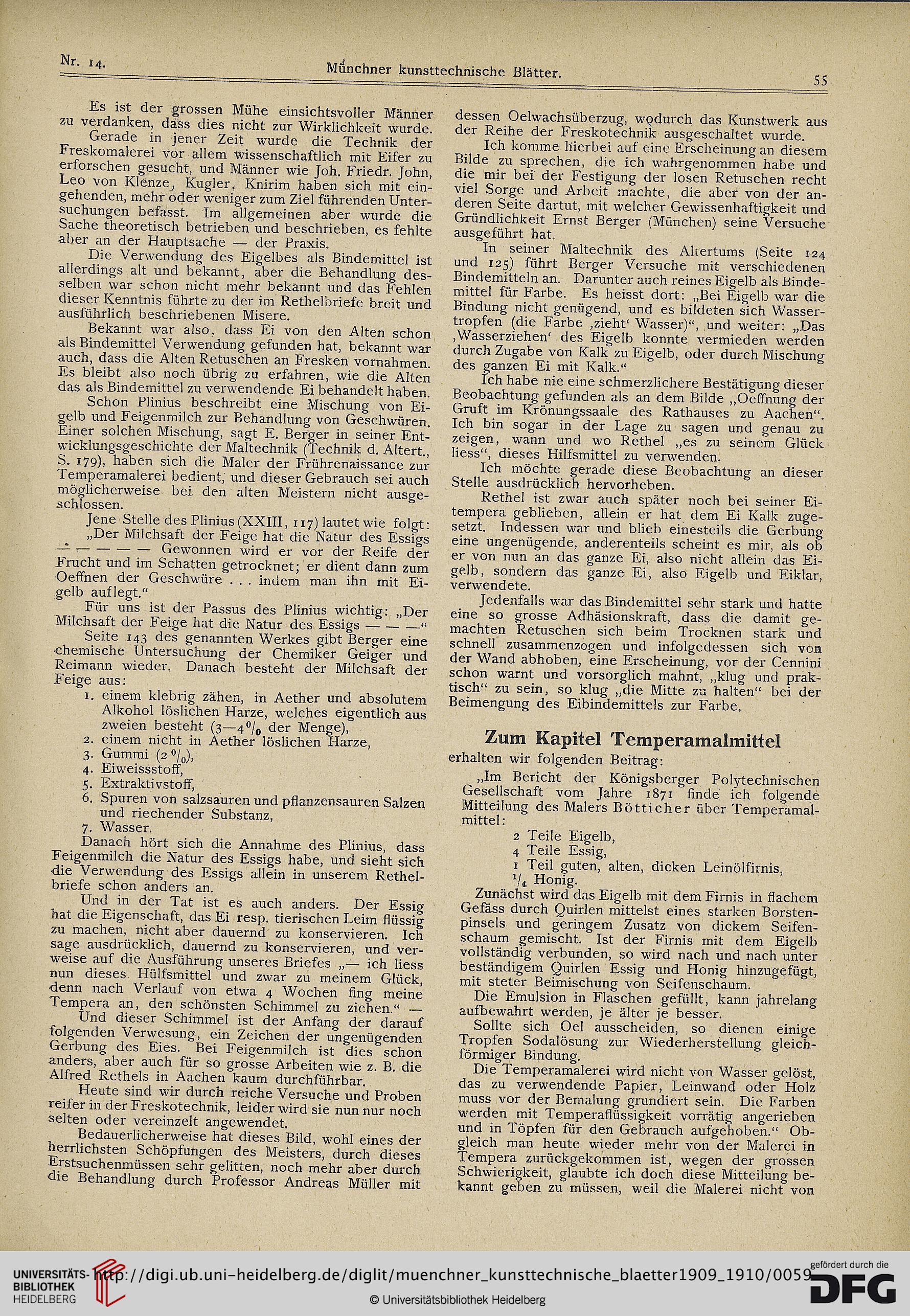Nr- 14- Münchner kunsttechnische Biätter. 55
Es ist der grossen Mühe einsichtsvoiier Männer
zu verdanken, dass dies nicht zur Wirkiichkeit wurde.
Gerade in jener Zeit wurde die Technik der
Freskomaierei vor aiiem tvissenschaftiich mit Eifer zu
erforschen gesucht, und Männer wie Joh. Friedr. John,
Leo von Kienze^ Kugier, Knirim haben sich mit ein-
gehenden, mehr oder weniger zum Ziei führenden Unter-
suchungen befasst. Im allgemeinen aber wurde die
Sache theoretisch betrieben und beschrieben, es fehite
aber an der Hauptsache — der Praxis.
Die Verwendung des Eigeibes ais Bindemitte] ist
aiierdings ait und bekannt, aber die Behandiung des-
seiben war schon nicht mehr bekannt und das Fehien
dieser Kenntnis führte zu der im Rethelbriefe breit und
ausführiich beschriebenen Misere.
Bekannt war aiso, dass Ei von den Aiten schon
ais Bindemittei Verwendung gefunden hat, bekannt war
auch, dass die Aiten Retuschen an Fresken Vornahmen.
Es bieibt aiso noch übrig zu erfahren, wie die Aiten
das ais Bindemittei zu verwendende Ei behandeit haben.
Schon Piinius beschreibt eine Mischung von Ei-
geib und Feigenmiich zur Behandiung von Geschwüren.
Einer soichen Mischung, sagt E. Berger in seiner Ent-
wickiungsgeschichte der Maitechnik (Technik d. Aitert.,
S. 179), haben sich die Maier der Frührenaissance zur
Temperamaierei bedient, und dieser Gebrauch sei auch
mögiicherweise bei den aiten Meistern nicht ausge-
schiossen.
Jene Stelie des Piinius (XXIII, :t7) iautet wie foigt:
„Der Miichsaft der Feige hat die Natur des Essigs
— -— -Gewonnen wird er vor der Reife der
Frucht und im Schatten getrocknet; er dient dann zum
Oeffnen der Geschwüre . . . indem man ihn mit Ei-
geib auiiegt."
Für uns ist der Passus des Piinius wichtig: „Der
Miichsaft der Feige hat die Natur des Essigs-"
Seite 143 des genannten Werkes gibt Berger eine
chemische Untersuchung der Chemiker Geiger und
Reimann wieder. Danach besteht der Miichsaft der
Feige aus:
1. einem kiebrig zähen, in Aether und absoiutem
Aikohoi iösiichen Harze, weiches eigentlich aus
zweien besteht (3—4°/,, der Menge),
2. einem nicht in Aether iösiichen Harze,
3. Gummi (2"j„),
4. Eiweissstoff,
3. Extraktivstoff,
6. Spuren von saizsauren und pHanzensauren Saizen
und riechender Substanz,
7. Wasser.
Danach hört sich die Annahme des Piinius, dass
Feigenmiich die Natur des Essigs habe, und sieht sich
die Verwendung des Essigs aiiein in unserem Rethei-
briefe schon anders an.
Und in der Tat ist es auch anders. Der Essig
hat die Eigenschaft, das Ei resp. tierischen Leim Hüssig
zu machen, nicht aber dauernd zu konservieren. Ich
sage ausdrückiich, dauernd zu konservieren, und ver-
weise auf die Ausführung unseres Briefes „— ich iiess
nun dieses Hüifsmittei und zwar zu meinem Giück,
denn nach Verlauf von etwa 4 Wochen fing meine
Tempera an, den schönsten Schimmei zu ziehen." —
Und dieser Schimmei ist der Anfang der darauf
foigenden Verwesung, ein Zeichen der ungenügenden
Gerbung des Eies. Bei Feigenmiich ist dies schon
anders, aber auch für so grosse Arbeiten wie z. B. die
Aifred Retheis in Aachen kaum durchführbar.
Heute sind wir durch reiche Versuche und Proben
reifer in der Freskotechnik, ieider wird sie nun nur noch
seiten oder vereinzeit angewendet.
Bedaueriicherweise hat dieses Biid, wohi eines der
herriichsten Schöpfungen des Meisters, durch dieses
Erstsuchenmüssen sehr geiitten, noch mehr aber durch
die Behandiung durch Professor Andreas Müiier mit
dessen Oeiwachsüberzug, wpdurch das Kunstwerk aus
der Reihe der Freskotechnik ausgeschaitet wurde.
Ich komme Hierbei auf eine Erscheinung an diesem
Biide zu sprechen, die ich wahrgenommen habe und
die mir bei der Festigung der iosen Retuschen recht
viei Sorge und Arbeit machte, die aber von der an-
deren Seite dartut, mit weicher Gewissenhaftigkeit und
Gründiichkeit Ernst Berger (München) seine Versuche
ausgeführt hat.
In seiner Maitechnik des AHertums (Seite 124
und 123) führt Berger Versuche mit verschiedenen
Bindemitteln an. Darunter auch reines Eigeib ais Binde-
mitte] für Farbe. Es heisst dort: „Bei Eigeib war die
Bindung nicht genügend, und es biideten sich Wasser-
tropfen (die Farbe .zieht' Wasser)", und weiter: „Das
,Wasserziehen' des Eigeib konnte vermieden werden
durch Zugabe von Kaik zu Eigeib, oder durch Mischung
des ganzen Ei mit Kaik."
Ich habe nie eine schmerzlichere Bestätigung dieser
Beobachtung gefunden ais an dem Bilde „Oeffnung der
Gruft im Krönungssaaie des Rathauses zu Aachen".
Ich bin sogar in der Lage zu sagen und genau zu
zeigen, wann und wo Rethei „es zu seinem Giück
Hess", dieses Hiifsmittei zu verwenden.
Ich möchte gerade diese Beobachtung an dieser
Steiie ausdrückiich hervorheben.
Rethei ist zwar auch später noch bei seiner Ei-
tempera gebiieben, aiiein er hat dem Ei Kaik zuge-
setzt. Indessen war und biieb einesteiis die Gerbung
eine ungenügende, anderenteiis scheint es mir, ais ob
er von nun an das ganze Ei, aiso nicht aiiein das Ei-
geib, sondern das ganze Ei, aiso Eigeib und Eikiar,
verwendete.
Jedenfaiis war das Bindemittei sehr stark und hatte
eine so grosse Adhäsionskraft, dass die damit ge-
machten Retuschen sich beim Trocknen stark und
schnei! zusammenzogen und infoigedessen sich von
der Wand abhoben, eine Erscheinung, vor der Cennini
schon warnt und vorsorgiich mahnt, ,,kiug und prak-
tisch" zu sein, so kiug „die Mitte zu hatten" bei der
Beimengung des Eibindemitteis zur Farbe.
Zum Kapitel Temperamalmittel
erhaiten wir foigenden Beitrag:
„Im Bericht der Königsberger Poiytechnischen
Geseiischaft vom Jahre 1871 finde ich folgende
Mitteiiung des Maiers Bötticher über Temperamai-
mittei:
2 Teiie Eigeib,
4 Teiie Essig,
1 Teii guten, aiten, dicken Leinöifirnis,
Honig.
Zunächst wird das Eigeib mit dem Firnis in Hachem
Gelass durch Quirlen mitteist eines starken Borsten-
pinseis und geringem Zusatz von dickem Seifen-
schaum gemischt. Ist der Firnis mit dem Eigeib
voiiständig verbunden, so wird nach und nach unter
beständigem Quirien Essig und Honig hinzugefügt,
mit steter Beimischung von Seifenschaum.
Die Emuision in Fiaschen gefüilt, kann jahrelang
aufbewahrt werden, je älter je besser.
Soiite sich Oei ausscheiden, so dienen einige
Tropfen Sodaiösung zur Wiederhersteiiung gieich-
förmiger Bindung.
Die Temperamaierei wird nicht von Wasser getost,
das zu verwendende Papier, Leinwand oder Hoiz
muss vor der Bemaiung grundiert sein. Die Farben
werden mit Temperafiüssigkeit vorrätig angerieben
und in Töpfen für den Gebrauch aufgehoben." Ob-
gleich man heute wieder mehr von der Maierei in
Tempera zurückgekommen ist, wegen der grossen
Schwierigkeit, giaubte ich doch diese Mitteiiung be-
kannt geben zu müssen, weit die Maierei nicht von
Es ist der grossen Mühe einsichtsvoiier Männer
zu verdanken, dass dies nicht zur Wirkiichkeit wurde.
Gerade in jener Zeit wurde die Technik der
Freskomaierei vor aiiem tvissenschaftiich mit Eifer zu
erforschen gesucht, und Männer wie Joh. Friedr. John,
Leo von Kienze^ Kugier, Knirim haben sich mit ein-
gehenden, mehr oder weniger zum Ziei führenden Unter-
suchungen befasst. Im allgemeinen aber wurde die
Sache theoretisch betrieben und beschrieben, es fehite
aber an der Hauptsache — der Praxis.
Die Verwendung des Eigeibes ais Bindemitte] ist
aiierdings ait und bekannt, aber die Behandiung des-
seiben war schon nicht mehr bekannt und das Fehien
dieser Kenntnis führte zu der im Rethelbriefe breit und
ausführiich beschriebenen Misere.
Bekannt war aiso, dass Ei von den Aiten schon
ais Bindemittei Verwendung gefunden hat, bekannt war
auch, dass die Aiten Retuschen an Fresken Vornahmen.
Es bieibt aiso noch übrig zu erfahren, wie die Aiten
das ais Bindemittei zu verwendende Ei behandeit haben.
Schon Piinius beschreibt eine Mischung von Ei-
geib und Feigenmiich zur Behandiung von Geschwüren.
Einer soichen Mischung, sagt E. Berger in seiner Ent-
wickiungsgeschichte der Maitechnik (Technik d. Aitert.,
S. 179), haben sich die Maier der Frührenaissance zur
Temperamaierei bedient, und dieser Gebrauch sei auch
mögiicherweise bei den aiten Meistern nicht ausge-
schiossen.
Jene Stelie des Piinius (XXIII, :t7) iautet wie foigt:
„Der Miichsaft der Feige hat die Natur des Essigs
— -— -Gewonnen wird er vor der Reife der
Frucht und im Schatten getrocknet; er dient dann zum
Oeffnen der Geschwüre . . . indem man ihn mit Ei-
geib auiiegt."
Für uns ist der Passus des Piinius wichtig: „Der
Miichsaft der Feige hat die Natur des Essigs-"
Seite 143 des genannten Werkes gibt Berger eine
chemische Untersuchung der Chemiker Geiger und
Reimann wieder. Danach besteht der Miichsaft der
Feige aus:
1. einem kiebrig zähen, in Aether und absoiutem
Aikohoi iösiichen Harze, weiches eigentlich aus
zweien besteht (3—4°/,, der Menge),
2. einem nicht in Aether iösiichen Harze,
3. Gummi (2"j„),
4. Eiweissstoff,
3. Extraktivstoff,
6. Spuren von saizsauren und pHanzensauren Saizen
und riechender Substanz,
7. Wasser.
Danach hört sich die Annahme des Piinius, dass
Feigenmiich die Natur des Essigs habe, und sieht sich
die Verwendung des Essigs aiiein in unserem Rethei-
briefe schon anders an.
Und in der Tat ist es auch anders. Der Essig
hat die Eigenschaft, das Ei resp. tierischen Leim Hüssig
zu machen, nicht aber dauernd zu konservieren. Ich
sage ausdrückiich, dauernd zu konservieren, und ver-
weise auf die Ausführung unseres Briefes „— ich iiess
nun dieses Hüifsmittei und zwar zu meinem Giück,
denn nach Verlauf von etwa 4 Wochen fing meine
Tempera an, den schönsten Schimmei zu ziehen." —
Und dieser Schimmei ist der Anfang der darauf
foigenden Verwesung, ein Zeichen der ungenügenden
Gerbung des Eies. Bei Feigenmiich ist dies schon
anders, aber auch für so grosse Arbeiten wie z. B. die
Aifred Retheis in Aachen kaum durchführbar.
Heute sind wir durch reiche Versuche und Proben
reifer in der Freskotechnik, ieider wird sie nun nur noch
seiten oder vereinzeit angewendet.
Bedaueriicherweise hat dieses Biid, wohi eines der
herriichsten Schöpfungen des Meisters, durch dieses
Erstsuchenmüssen sehr geiitten, noch mehr aber durch
die Behandiung durch Professor Andreas Müiier mit
dessen Oeiwachsüberzug, wpdurch das Kunstwerk aus
der Reihe der Freskotechnik ausgeschaitet wurde.
Ich komme Hierbei auf eine Erscheinung an diesem
Biide zu sprechen, die ich wahrgenommen habe und
die mir bei der Festigung der iosen Retuschen recht
viei Sorge und Arbeit machte, die aber von der an-
deren Seite dartut, mit weicher Gewissenhaftigkeit und
Gründiichkeit Ernst Berger (München) seine Versuche
ausgeführt hat.
In seiner Maitechnik des AHertums (Seite 124
und 123) führt Berger Versuche mit verschiedenen
Bindemitteln an. Darunter auch reines Eigeib ais Binde-
mitte] für Farbe. Es heisst dort: „Bei Eigeib war die
Bindung nicht genügend, und es biideten sich Wasser-
tropfen (die Farbe .zieht' Wasser)", und weiter: „Das
,Wasserziehen' des Eigeib konnte vermieden werden
durch Zugabe von Kaik zu Eigeib, oder durch Mischung
des ganzen Ei mit Kaik."
Ich habe nie eine schmerzlichere Bestätigung dieser
Beobachtung gefunden ais an dem Bilde „Oeffnung der
Gruft im Krönungssaaie des Rathauses zu Aachen".
Ich bin sogar in der Lage zu sagen und genau zu
zeigen, wann und wo Rethei „es zu seinem Giück
Hess", dieses Hiifsmittei zu verwenden.
Ich möchte gerade diese Beobachtung an dieser
Steiie ausdrückiich hervorheben.
Rethei ist zwar auch später noch bei seiner Ei-
tempera gebiieben, aiiein er hat dem Ei Kaik zuge-
setzt. Indessen war und biieb einesteiis die Gerbung
eine ungenügende, anderenteiis scheint es mir, ais ob
er von nun an das ganze Ei, aiso nicht aiiein das Ei-
geib, sondern das ganze Ei, aiso Eigeib und Eikiar,
verwendete.
Jedenfaiis war das Bindemittei sehr stark und hatte
eine so grosse Adhäsionskraft, dass die damit ge-
machten Retuschen sich beim Trocknen stark und
schnei! zusammenzogen und infoigedessen sich von
der Wand abhoben, eine Erscheinung, vor der Cennini
schon warnt und vorsorgiich mahnt, ,,kiug und prak-
tisch" zu sein, so kiug „die Mitte zu hatten" bei der
Beimengung des Eibindemitteis zur Farbe.
Zum Kapitel Temperamalmittel
erhaiten wir foigenden Beitrag:
„Im Bericht der Königsberger Poiytechnischen
Geseiischaft vom Jahre 1871 finde ich folgende
Mitteiiung des Maiers Bötticher über Temperamai-
mittei:
2 Teiie Eigeib,
4 Teiie Essig,
1 Teii guten, aiten, dicken Leinöifirnis,
Honig.
Zunächst wird das Eigeib mit dem Firnis in Hachem
Gelass durch Quirlen mitteist eines starken Borsten-
pinseis und geringem Zusatz von dickem Seifen-
schaum gemischt. Ist der Firnis mit dem Eigeib
voiiständig verbunden, so wird nach und nach unter
beständigem Quirien Essig und Honig hinzugefügt,
mit steter Beimischung von Seifenschaum.
Die Emuision in Fiaschen gefüilt, kann jahrelang
aufbewahrt werden, je älter je besser.
Soiite sich Oei ausscheiden, so dienen einige
Tropfen Sodaiösung zur Wiederhersteiiung gieich-
förmiger Bindung.
Die Temperamaierei wird nicht von Wasser getost,
das zu verwendende Papier, Leinwand oder Hoiz
muss vor der Bemaiung grundiert sein. Die Farben
werden mit Temperafiüssigkeit vorrätig angerieben
und in Töpfen für den Gebrauch aufgehoben." Ob-
gleich man heute wieder mehr von der Maierei in
Tempera zurückgekommen ist, wegen der grossen
Schwierigkeit, giaubte ich doch diese Mitteiiung be-
kannt geben zu müssen, weit die Maierei nicht von