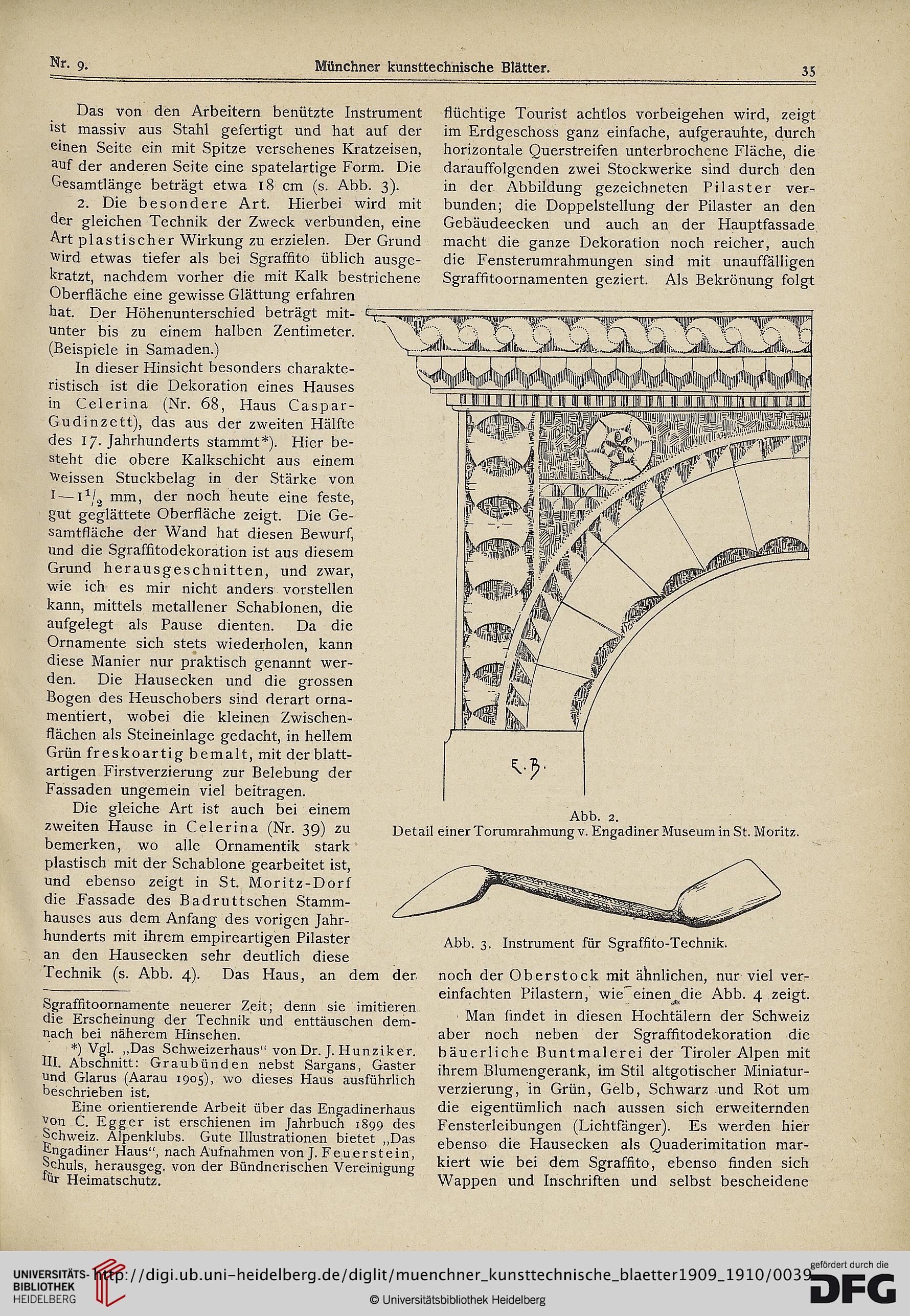Münchner kunsttechnische Blätter.
35
Nr. 9.
Das von den Arbeitern benützte Instrument
ist massiv aus Stahl gefertigt und hat auf der
einen Seite ein mit Spitze versehenes Kratzeisen,
auf der anderen Seite eine spateiartige Form. Die
Gesamtlänge beträgt etwa 18 cm (s. Abb. 3).
2. Die besondere Art. Hierbei wird mit
der gleichen Technik der Zweck verbunden, eine
Art plastischer Wirkung zu erzielen. Der Grund
Wird etwas tiefer als bei Sgrafüto üblich ausge-
kratzt, nachdem vorher die mit Kalk bestrichene
Oberfläche eine gewisse Glättung erfahren
hat. Der Höhenunterschied beträgt mit-
unter bis zu einem halben Zentimeter.
(Beispiele in Samaden.)
In dieser Hinsicht besonders charakte-
ristisch ist die Dekoration eines Hauses
in Celerina (Nr. 68, Haus Caspar-
Gudinzett), das aus der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts stammt* *). Hier be-
steht die obere Kalkschicht aus einem
Weissen Stuckbelag in der Stärke von
I-—mm, der noch heute eine feste,
gut geglättete Oberfläche zeigt. Die Ge-
samtfläche der Wand hat diesen Bewurf,
und die Sgrafütodekoration ist aus diesem
Grund herausgeschnitten, und zwar,
wie ich es mir nicht anders vorstellen
kann, mittels metallener Schablonen, die
aufgelegt als Pause dienten. Da die
Ornamente sich stets wiederholen, kann
diese Manier nur praktisch genannt wer-
den. Die Hausecken und die grossen
Bogen des Heuschobers sind derart orna-
mentiert, wobei die kleinen Zwischen-
flächen als Steineinlage gedacht, in hellem
Grün freskoartig bemalt, mit der blatt-
artigen Firstverzierung zur Belebung der
Fassaden ungemein viel beitragen.
Die gleiche Art ist auch bei einem
zweiten Hause in Celerina (Nr. 39) zu
bemerken, wo alle Ornamentik stark
plastisch mit der Schablone gearbeitet ist,
und ebenso zeigt in St. Moritz-Dorf
die Fassade des Badruttschen Stamm-
hauses aus dem Anfang des vorigen Jahr-
hunderts mit ihrem empireartigen Pilaster
an den Hausecken sehr deutlich diese
Technik (s. Abb. 4). Das Haus, an dem der
Sgrafñtoornamente neuerer Zeit; denn sie imitieren
die Erscheinung der Technik und enttäuschen dem-
nach bei näherem Hinsehen.
*) Vgl. ,,Das Schweizerhaus" von Dr.J.Hunziker.
III. Abschnitt: Graubünden nebst Sargans, Gaster
und Glarus (Aarau ¡905), wo dieses Haus ausführlich
beschrieben ist.
Eine orientierende Arbeit über das Engadinerhaus
von C. Egger ist erschienen im Jahrbuch 1899 des
Schweiz. Alpenklubs. Gute Illustrationen bietet ,,Das
Bngadiner Haus", nach Aufnahmen von J. Feuerstein,
Schuls, herausgeg. von der Bündnerischen Vereinigung
mr Heimatschutz.
flüchtige Tourist achtlos Vorbeigehen wird, zeigt
im Erdgeschoss ganz einfache, aufgerauhte, durch
horizontale Querstreifen unterbrochene Fläche, die
darauffolgenden zwei Stockwerke sind durch den
in der Abbildung gezeichneten Pilaster ver-
bunden; die Doppelstellung der Pilaster an den
Gebäudeecken und auch an der Hauptfassade
macht die ganze Dekoration noch reicher, auch
die Fensterumrahmungen sind mit unauffälligen
Sgrafütoornamenten geziert. Als Bekrönung folgt
Abb. 3. Instrument für Sgrafüto-Technik.
noch der Oberstock mit ähnlichen, nur viel ver-
einfachten Pilastern, wie einen^die Abb. 4 zeigt.
Man findet in diesen Hochtälern der Schweiz
aber noch neben der Sgrafütodekoration die
bäuerliche Buntmalerei der Tiroler Alpen mit
ihrem Blumengerank, im Stil altgotischer Miniatur-
verzierung, in Grün, Gelb, Schwarz und Rot um
die eigentümlich nach aussen sich erweiternden
Fensterleibungen (Lichtfänger). Es werden hier
ebenso die Hausecken als Quaderimitation mar-
kiert wie bei dem Sgrafüto, ebenso ünden sich
Wappen und Inschriften und selbst bescheidene
Abb. 3.
Detail einer Torumrahmung v. Engadiner Museum in St. Moritz.
35
Nr. 9.
Das von den Arbeitern benützte Instrument
ist massiv aus Stahl gefertigt und hat auf der
einen Seite ein mit Spitze versehenes Kratzeisen,
auf der anderen Seite eine spateiartige Form. Die
Gesamtlänge beträgt etwa 18 cm (s. Abb. 3).
2. Die besondere Art. Hierbei wird mit
der gleichen Technik der Zweck verbunden, eine
Art plastischer Wirkung zu erzielen. Der Grund
Wird etwas tiefer als bei Sgrafüto üblich ausge-
kratzt, nachdem vorher die mit Kalk bestrichene
Oberfläche eine gewisse Glättung erfahren
hat. Der Höhenunterschied beträgt mit-
unter bis zu einem halben Zentimeter.
(Beispiele in Samaden.)
In dieser Hinsicht besonders charakte-
ristisch ist die Dekoration eines Hauses
in Celerina (Nr. 68, Haus Caspar-
Gudinzett), das aus der zweiten Hälfte
des 17. Jahrhunderts stammt* *). Hier be-
steht die obere Kalkschicht aus einem
Weissen Stuckbelag in der Stärke von
I-—mm, der noch heute eine feste,
gut geglättete Oberfläche zeigt. Die Ge-
samtfläche der Wand hat diesen Bewurf,
und die Sgrafütodekoration ist aus diesem
Grund herausgeschnitten, und zwar,
wie ich es mir nicht anders vorstellen
kann, mittels metallener Schablonen, die
aufgelegt als Pause dienten. Da die
Ornamente sich stets wiederholen, kann
diese Manier nur praktisch genannt wer-
den. Die Hausecken und die grossen
Bogen des Heuschobers sind derart orna-
mentiert, wobei die kleinen Zwischen-
flächen als Steineinlage gedacht, in hellem
Grün freskoartig bemalt, mit der blatt-
artigen Firstverzierung zur Belebung der
Fassaden ungemein viel beitragen.
Die gleiche Art ist auch bei einem
zweiten Hause in Celerina (Nr. 39) zu
bemerken, wo alle Ornamentik stark
plastisch mit der Schablone gearbeitet ist,
und ebenso zeigt in St. Moritz-Dorf
die Fassade des Badruttschen Stamm-
hauses aus dem Anfang des vorigen Jahr-
hunderts mit ihrem empireartigen Pilaster
an den Hausecken sehr deutlich diese
Technik (s. Abb. 4). Das Haus, an dem der
Sgrafñtoornamente neuerer Zeit; denn sie imitieren
die Erscheinung der Technik und enttäuschen dem-
nach bei näherem Hinsehen.
*) Vgl. ,,Das Schweizerhaus" von Dr.J.Hunziker.
III. Abschnitt: Graubünden nebst Sargans, Gaster
und Glarus (Aarau ¡905), wo dieses Haus ausführlich
beschrieben ist.
Eine orientierende Arbeit über das Engadinerhaus
von C. Egger ist erschienen im Jahrbuch 1899 des
Schweiz. Alpenklubs. Gute Illustrationen bietet ,,Das
Bngadiner Haus", nach Aufnahmen von J. Feuerstein,
Schuls, herausgeg. von der Bündnerischen Vereinigung
mr Heimatschutz.
flüchtige Tourist achtlos Vorbeigehen wird, zeigt
im Erdgeschoss ganz einfache, aufgerauhte, durch
horizontale Querstreifen unterbrochene Fläche, die
darauffolgenden zwei Stockwerke sind durch den
in der Abbildung gezeichneten Pilaster ver-
bunden; die Doppelstellung der Pilaster an den
Gebäudeecken und auch an der Hauptfassade
macht die ganze Dekoration noch reicher, auch
die Fensterumrahmungen sind mit unauffälligen
Sgrafütoornamenten geziert. Als Bekrönung folgt
Abb. 3. Instrument für Sgrafüto-Technik.
noch der Oberstock mit ähnlichen, nur viel ver-
einfachten Pilastern, wie einen^die Abb. 4 zeigt.
Man findet in diesen Hochtälern der Schweiz
aber noch neben der Sgrafütodekoration die
bäuerliche Buntmalerei der Tiroler Alpen mit
ihrem Blumengerank, im Stil altgotischer Miniatur-
verzierung, in Grün, Gelb, Schwarz und Rot um
die eigentümlich nach aussen sich erweiternden
Fensterleibungen (Lichtfänger). Es werden hier
ebenso die Hausecken als Quaderimitation mar-
kiert wie bei dem Sgrafüto, ebenso ünden sich
Wappen und Inschriften und selbst bescheidene
Abb. 3.
Detail einer Torumrahmung v. Engadiner Museum in St. Moritz.