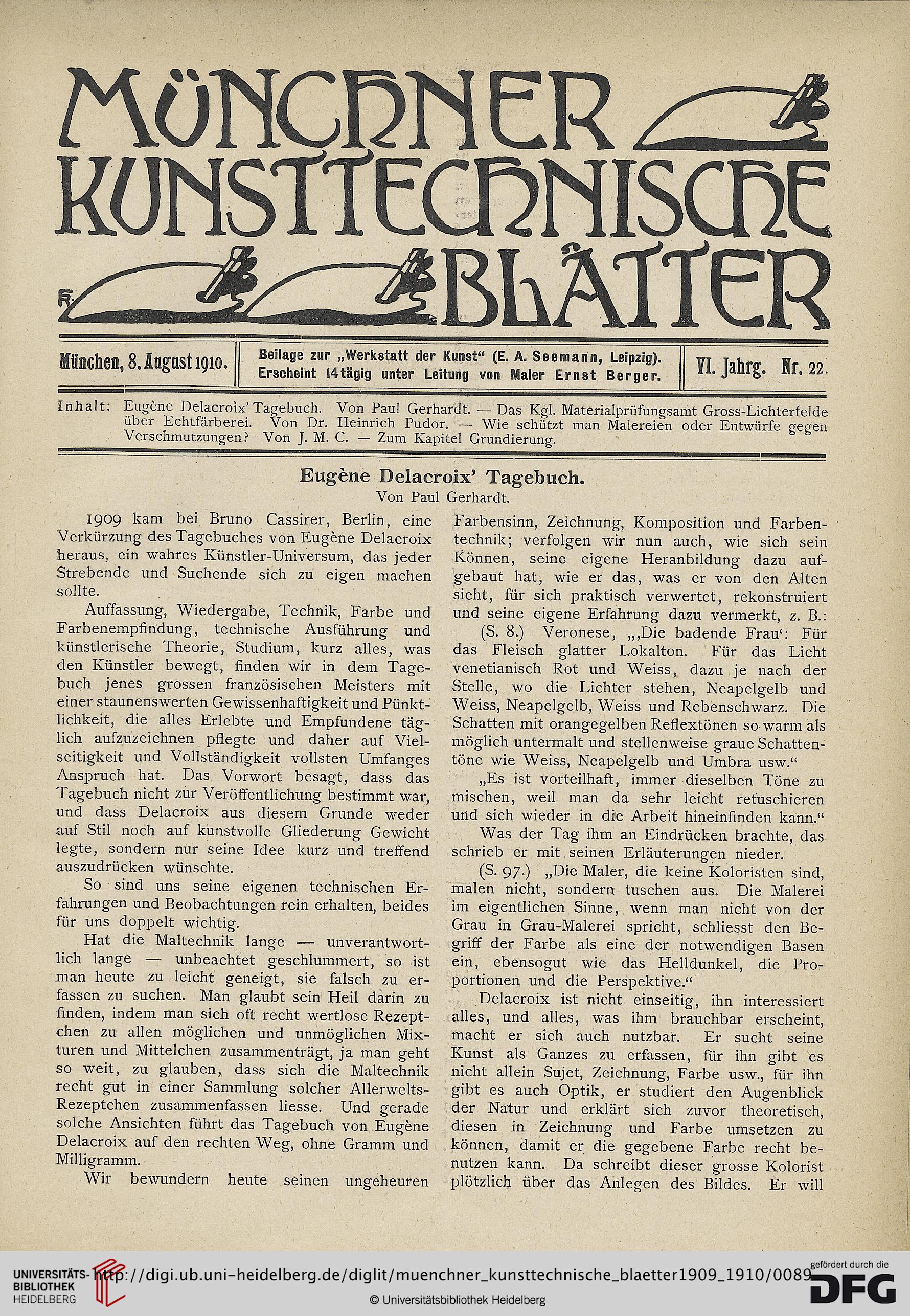München, 8.ingnstiQio.
Behage zur „Werkstatt der Kunst" (E. A. Seemann, Leipzig).
Erscheint i4tägig unter Leitung von Maier Ernst Berger.
YI. Jahrg. Nr. 22.
Inhalt: Eugene Delacroix'Tagebuch. Von Paul Gerhardt. — Das Kgl. MateriaiprüfungsamtGross-Lichterfeide
über Echtfärberei. Von Dr. Heinrich Pudor. — Wie schützt man Malereien oder Entwürfe gegen
Verschmutzungen? Von J. M. C. — Zum Kapitel Grundierung.
Eugene Delacroix' Tagebuch.
Von Paul Gerhardt.
1909 kam bei Bruno Cassirer, Berlin, eine
Verkürzung des Tagebuches von Eugene Delacroix
heraus, ein wahres Künstler-Universum, das jeder
Strebende und Suchende sich zu eigen machen
sollte.
Auffassung, Wiedergabe, Technik, Farbe und
Farbenempfindung, technische Ausführung und
künstlerische Theorie, Studium, kurz alles, was
den Künstler bewegt, finden wir in dem Tage-
buch jenes grossen französischen Meisters mit
einer staunenswerten Gewissenhaftigkeit und Pünkt-
lichkeit, die alles Erlebte und Empfundene täg-
lich aufzuzeichnen pflegte und daher auf Viel-
seitigkeit und Vollständigkeit vollsten Umfanges
Anspruch hat. Das Vorwort besagt, dass das
Tagebuch nicht zur Veröffentlichung bestimmt war,
und dass Delacroix aus diesem Grunde weder
auf Stil noch auf kunstvolle Gliederung Gewicht
legte, sondern nur seine Idee kurz und treffend
auszudrücken wünschte.
So sind uns seine eigenen technischen Er-
fahrungen und Beobachtungen rein erhalten, beides
für uns doppelt wichtig.
Hat die Maltechnik lange — unverantwort-
lich lange — unbeachtet geschlummert, so ist
man heute zu leicht geneigt, sie falsch zu er-
fassen zu suchen. Man glaubt sein Heil darin zu
finden, indem man sich oft recht wertlose Rezept-
ehen zu allen möglichen und unmöglichen Mix-
turen und Mittelchen zusammenträgt, ja man geht
so weit, zu glauben, dass sich die Maltechnik
recht gut in einer Sammlung solcher Allerwelts-
Rezeptchen zusammenfassen Hesse. Und gerade
solche Ansichten führt das Tagebuch von Eugene
Delacroix auf den rechten Weg, ohne Gramm und
Milligramm.
Wir bewundern heute seinen ungeheuren
Farbensinn, Zeichnung, Komposition und Farben-
technik; verfolgen wir nun auch, wie sich sein
Können, seine eigene Heranbildung dazu auf-
gebaut hat, wie er das, was er von den Alten
sieht, für sich praktisch verwertet, rekonstruiert
und seine eigene Erfahrung dazu vermerkt, z. B.:
(S. 8.) Veronese, „,Die badende Frau': Für
das Fleisch glatter Lokalton. Für das Licht
venetianisch Rot und Weiss, dazu je nach der
Stelle, wo die Lichter stehen, Neapelgelb und
Weiss, Neapelgelb, Weiss und Rebenschwarz. Die
Schatten mit orangegelben Reflextönen so warm als
möglich untermalt und stellenweise graue Schatten-
töne wie Weiss, Neapelgelb und Umbra usw."
„Es ist vorteilhaft, immer dieselben Töne zu
mischen, weil man da sehr leicht retuschieren
und sich wieder in die Arbeit hineinfinden kann."
Was der Tag ihm an Eindrücken brachte, das
schrieb er mit seinen Erläuterungen nieder.
(S. 9Z-) "Die Maler, die keine Koloristen sind,
malen nicht, sondern tuschen aus. Die Malerei
im eigentlichen Sinne, wenn man nicht von der
Grau in Grau-Malerei spricht, schliesst den Be-
griff der Farbe als eine der notwendigen Basen
ein, ebensogut wie das Helldunkel, die Pro-
portionen und die Perspektive."
Delacroix ist nicht einseitig, ihn interessiert
alles, und alles, was ihm brauchbar erscheint,
macht er sich auch nutzbar. Er sucht seine
Kunst als Ganzes zu erfassen, für ihn gibt es
nicht allein Sujet, Zeichnung, Farbe usw., für ihn
gibt es auch Optik, er studiert den Augenblick
der Natur und erklärt sich zuvor theoretisch,
diesen in Zeichnung und Farbe umsetzen zu
können, damit er die gegebene Farbe recht be-
nutzen kann. Da schreibt dieser grosse Kolorist
plötzlich über das Anlegen des Bildes. Er will