Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.
0.5
1 cm
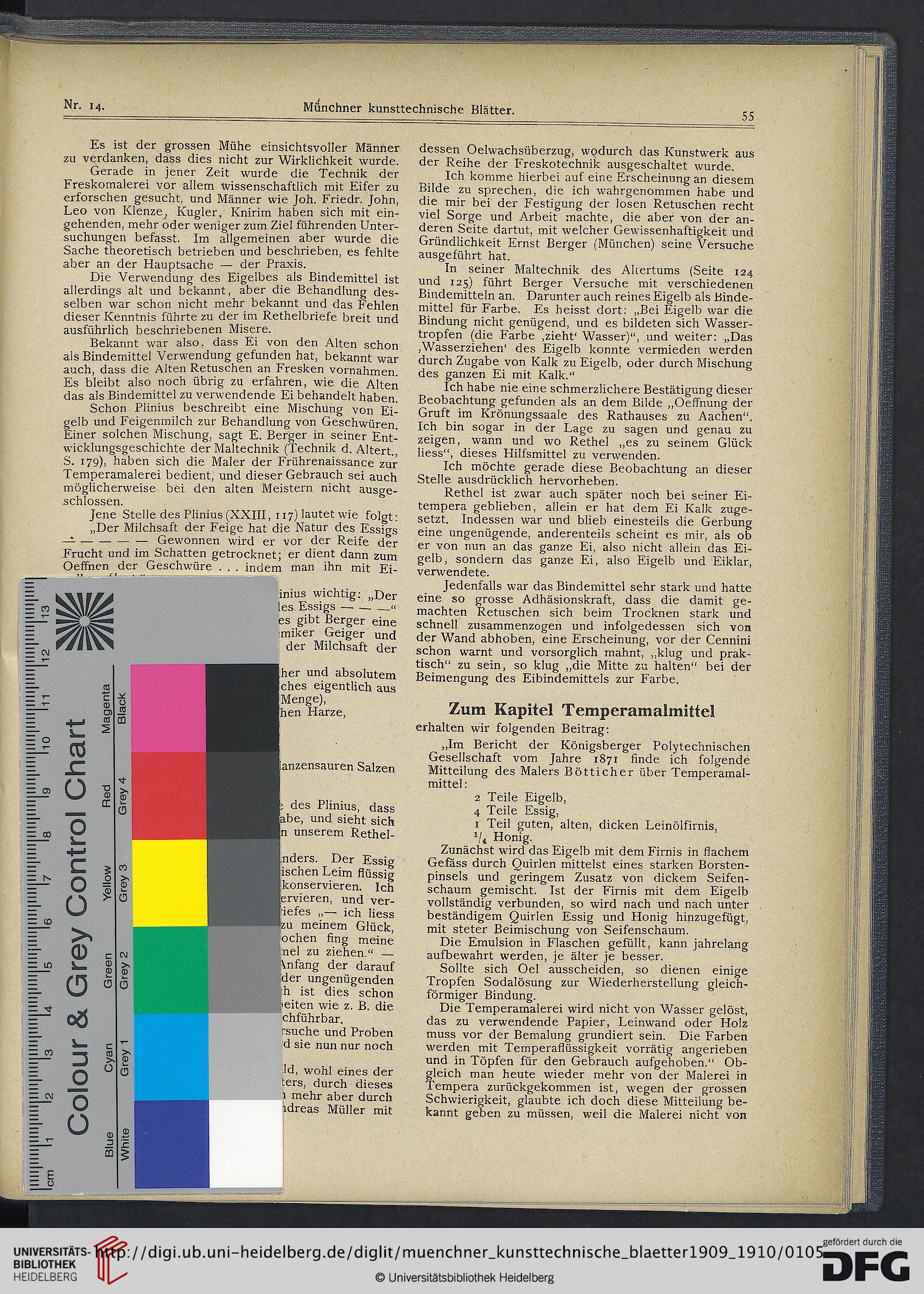
Nr. !4.
Münchner kunsttechnische Blätter.
55
Es ist der grossen Mühe einsichtsvoHer Männer
zu verdanken, dass dies nicht zur Wirklichkeit wurde.
Gerade in jener Zeit wurde die Technik der
Freskomalerei vor allem Wissenschaftlich mit Eifer zu
erforschen gesucht, und Männer wie Joh. Friedr. John,
Leo von Klenze^ Kugler. Knirim haben sich mit ein-
gehenden, mehr oder weniger zum Ziel führenden Unter-
suchungen befasst. Im allgemeinen aber wurde die
Sache theoretisch betrieben und beschrieben, es fehlte
aber an der Hauptsache — der Praxis.
Die Verwendung des Eigelbes als Bindemittel ist
allerdings alt und bekannt, aber die Behandlung des-
selben war schon nicht mehr bekannt und das Fehlen
dieser Kenntnis führte zu der im Rethelbriefe breit und
ausführlich beschriebenen Misere.
Bekannt war also, dass Ei von den Alten schon
als Bindemittel Verwendung gefunden hat, bekannt war
auch, dass die Alten Retuschen an Fresken Vornahmen.
Es bleibt also noch übrig zu erfahren, wie die Alten
das als Bindemittel zu verwendende Ei behandelt haben.
Schon Plinius beschreibt eine Mischung von Ei-
gelb und Feigenmilch zur Behandlung von Geschwüren.
Einer solchen Mischung, sagt E. Berger in seiner Ent-
wicklungsgeschichte der Maltechnik (Technik d. Altert.,
S. 179), haben sich die Maler der Frührenaissance zur
Temperamalerei bedient, und dieser Gebrauch sei auch
möglicherweise bei den alten Meistern mcht ausge-
schlossen.
Jene Stelle des Plinius (XXIII, 1:7) lautet wie folgt:
„Der Milchsaft der Feige hat die Natur des Essigs
—-Gewonnen vürd er vor der Reife der
Frucht und im Schatten getrocknet; er dient dann zum
Oeffnen der Geschwüre . . . indem man ihn mit Ei-
inius wichtig: „Der
les Essigs--
es gibt Berger eine
:miker Geiger und
der Milchsaft der
her und absolutem
ches eigentlich aus
Menge),
hcn Harze,
anzensauren Salzen
des Plinius, dass
¡abe, und sieht sich
[n unserem Rethel-
nders. Der Essig
ischen Leim flüssig
konservieren. Ich
[ervieren, und ver-
iefes „— ich liess
¡zu meinem Glück,
ochen ßng meine
ne) zu ziehen." .—
Anfang der darauf
der ungenügenden
;h ist dies schon
¡eiten wie z. B. die
chführbar.
rsuche und Proben
d sie nun nur noch
Id, wohl eines der
ters, durch dieses
1 mehr aber durch
tdreas Müller mit
dessen Oelwachsüberzug, wodurch das Kunstwerk aus
der Reihe der Freskotechnik ausgeschaltet wurde.
Ich komme Hierbei auf eine Erscheinung an diesem
Bilde zu sprechen, die ich wahrgenommen habe und
die mir bei der Festigung der losen Retuschen recht
viel Sorge und Arbeit machte, die aber von der an-
deren Seite dartut, mit welcher Gewissenhaftigkeit und
Gründlichkeit Ernst Berger (München) seine Versuche
ausgeführt hat.
In seiner Maltechnik des Altertums (Seite :24
und ]2$) führt Berger Versuche mit verschiedenen
Bindemitteln an. Darunter auch reines Eigelb als Binde-
mittel für Farbe. Es heisst dort: „Bei Eigelb war die
Bindung nicht genügend, und es bildeten sich Wasser-
tropfen (die Farbe .zieht' Wasser)", und weiter: „Das
.Wasserziehen' des Eigelb konnte vermieden werden
durch Zugabe von Kalk zu Eigelb, oder durch Mischung
des ganzen Ei mit Kalk."
Ich habe nie eine schmerzlichere Bestätigung dieser
Beobachtung gefunden als an dem Bilde „Oeffnung der
Gruft im Krönungssaale des Rathauses zu Aachen".
Ich bin sogar in der Lage zu sagen und genau zu
zeigen, wann und wo Rethel „es zu seinem Glück
liess", dieses Hilfsmittel zu verwenden.
Ich möchte gerade diese Beobachtung an dieser
Stelle ausdrücklich hervorheben.
Rethel ist zwar auch später noch bei seiner Ei-
tempera geblieben, allein er hat dem Ei Kalk zuge-
setzt. Indessen war und blieb einesteils die Gerbung
eine ungenügende, anderenteils scheint es mir, als ob
er von nun an das ganze Ei, also nicht allein das Ei-
gelb, sondern das ganze Ei, also Eigelb und Eiklar,
verwendete.
Jedenfalls war das Bindemitte! sehr stark und hatte
eine so grosse Adhäsionskraft, dass die damit ge-
machten Retuschen sich beim Trocknen stark und
schnell zusammenzogen und infolgedessen sich von
der Wand abhoben, eine Erscheinung, vor der Cennini
schon warnt und vorsorglich mahnt, „klug und prak-
tisch" zu sein, so klug „die Mitte zu halten" bei der
Beimengung des Eibindemittels zur Farbe.
Zum Kapitel Temperamaimittel
erhalten wir folgenden Beitrag:
„Im Bericht der Königsberger Polytechnischen
Gesellschaft vom Jahre 1871 finde ich folgende
Mitteilung des Malers Bötticher über Temperamal-
mittel :
2 Teile Eigelb,
4 Teile Essig,
i Teil guten, alten, dicken Leinölfirnis,
Honig.
Zunächst wird das Eigelb mit dem Firnis in flachem
Geiass durch Quirlen mittelst eines starken Borsten-
pinsels und geringem Zusatz von dickem Seifen-
schaum gemischt. Ist der Firnis mit dem Eigelb
vollständig verbunden, so wird nach und nach unter
beständigem Quirlen Essig und Honig hinzugefügt,
mit steter Beimischung von Seifenschaum.
Die Emulsion in Flaschen gefüllt, kann jahrelang
aufbewahrt werden, je älter je besser.
Sollte sich Oel ausscheiden, so dienen einige
Tropfen Sodalösung zur Wiederherstellung gleich-
förmiger Bindung.
Die Temperamalerei wird nicht von Wasser gelöst,
das zu verwendende Papier, Leinwand oder Holz
muss vor der Bemalung grundiert sein. Die Farben
werden mit TemperaHüssigkeit vorrätig angerieben
und in Töpfen für den Gebrauch aufgehoben." Ob-
gleich man heute wieder mehr von der Malerei in
Tempera zurückgekommen ist, wegen der grossen
Schwierigkeit, glaubte ich doch diese Mitteilung be-
kannt geben zu müssen, weil die Malerei nicht von
Münchner kunsttechnische Blätter.
55
Es ist der grossen Mühe einsichtsvoHer Männer
zu verdanken, dass dies nicht zur Wirklichkeit wurde.
Gerade in jener Zeit wurde die Technik der
Freskomalerei vor allem Wissenschaftlich mit Eifer zu
erforschen gesucht, und Männer wie Joh. Friedr. John,
Leo von Klenze^ Kugler. Knirim haben sich mit ein-
gehenden, mehr oder weniger zum Ziel führenden Unter-
suchungen befasst. Im allgemeinen aber wurde die
Sache theoretisch betrieben und beschrieben, es fehlte
aber an der Hauptsache — der Praxis.
Die Verwendung des Eigelbes als Bindemittel ist
allerdings alt und bekannt, aber die Behandlung des-
selben war schon nicht mehr bekannt und das Fehlen
dieser Kenntnis führte zu der im Rethelbriefe breit und
ausführlich beschriebenen Misere.
Bekannt war also, dass Ei von den Alten schon
als Bindemittel Verwendung gefunden hat, bekannt war
auch, dass die Alten Retuschen an Fresken Vornahmen.
Es bleibt also noch übrig zu erfahren, wie die Alten
das als Bindemittel zu verwendende Ei behandelt haben.
Schon Plinius beschreibt eine Mischung von Ei-
gelb und Feigenmilch zur Behandlung von Geschwüren.
Einer solchen Mischung, sagt E. Berger in seiner Ent-
wicklungsgeschichte der Maltechnik (Technik d. Altert.,
S. 179), haben sich die Maler der Frührenaissance zur
Temperamalerei bedient, und dieser Gebrauch sei auch
möglicherweise bei den alten Meistern mcht ausge-
schlossen.
Jene Stelle des Plinius (XXIII, 1:7) lautet wie folgt:
„Der Milchsaft der Feige hat die Natur des Essigs
—-Gewonnen vürd er vor der Reife der
Frucht und im Schatten getrocknet; er dient dann zum
Oeffnen der Geschwüre . . . indem man ihn mit Ei-
inius wichtig: „Der
les Essigs--
es gibt Berger eine
:miker Geiger und
der Milchsaft der
her und absolutem
ches eigentlich aus
Menge),
hcn Harze,
anzensauren Salzen
des Plinius, dass
¡abe, und sieht sich
[n unserem Rethel-
nders. Der Essig
ischen Leim flüssig
konservieren. Ich
[ervieren, und ver-
iefes „— ich liess
¡zu meinem Glück,
ochen ßng meine
ne) zu ziehen." .—
Anfang der darauf
der ungenügenden
;h ist dies schon
¡eiten wie z. B. die
chführbar.
rsuche und Proben
d sie nun nur noch
Id, wohl eines der
ters, durch dieses
1 mehr aber durch
tdreas Müller mit
dessen Oelwachsüberzug, wodurch das Kunstwerk aus
der Reihe der Freskotechnik ausgeschaltet wurde.
Ich komme Hierbei auf eine Erscheinung an diesem
Bilde zu sprechen, die ich wahrgenommen habe und
die mir bei der Festigung der losen Retuschen recht
viel Sorge und Arbeit machte, die aber von der an-
deren Seite dartut, mit welcher Gewissenhaftigkeit und
Gründlichkeit Ernst Berger (München) seine Versuche
ausgeführt hat.
In seiner Maltechnik des Altertums (Seite :24
und ]2$) führt Berger Versuche mit verschiedenen
Bindemitteln an. Darunter auch reines Eigelb als Binde-
mittel für Farbe. Es heisst dort: „Bei Eigelb war die
Bindung nicht genügend, und es bildeten sich Wasser-
tropfen (die Farbe .zieht' Wasser)", und weiter: „Das
.Wasserziehen' des Eigelb konnte vermieden werden
durch Zugabe von Kalk zu Eigelb, oder durch Mischung
des ganzen Ei mit Kalk."
Ich habe nie eine schmerzlichere Bestätigung dieser
Beobachtung gefunden als an dem Bilde „Oeffnung der
Gruft im Krönungssaale des Rathauses zu Aachen".
Ich bin sogar in der Lage zu sagen und genau zu
zeigen, wann und wo Rethel „es zu seinem Glück
liess", dieses Hilfsmittel zu verwenden.
Ich möchte gerade diese Beobachtung an dieser
Stelle ausdrücklich hervorheben.
Rethel ist zwar auch später noch bei seiner Ei-
tempera geblieben, allein er hat dem Ei Kalk zuge-
setzt. Indessen war und blieb einesteils die Gerbung
eine ungenügende, anderenteils scheint es mir, als ob
er von nun an das ganze Ei, also nicht allein das Ei-
gelb, sondern das ganze Ei, also Eigelb und Eiklar,
verwendete.
Jedenfalls war das Bindemitte! sehr stark und hatte
eine so grosse Adhäsionskraft, dass die damit ge-
machten Retuschen sich beim Trocknen stark und
schnell zusammenzogen und infolgedessen sich von
der Wand abhoben, eine Erscheinung, vor der Cennini
schon warnt und vorsorglich mahnt, „klug und prak-
tisch" zu sein, so klug „die Mitte zu halten" bei der
Beimengung des Eibindemittels zur Farbe.
Zum Kapitel Temperamaimittel
erhalten wir folgenden Beitrag:
„Im Bericht der Königsberger Polytechnischen
Gesellschaft vom Jahre 1871 finde ich folgende
Mitteilung des Malers Bötticher über Temperamal-
mittel :
2 Teile Eigelb,
4 Teile Essig,
i Teil guten, alten, dicken Leinölfirnis,
Honig.
Zunächst wird das Eigelb mit dem Firnis in flachem
Geiass durch Quirlen mittelst eines starken Borsten-
pinsels und geringem Zusatz von dickem Seifen-
schaum gemischt. Ist der Firnis mit dem Eigelb
vollständig verbunden, so wird nach und nach unter
beständigem Quirlen Essig und Honig hinzugefügt,
mit steter Beimischung von Seifenschaum.
Die Emulsion in Flaschen gefüllt, kann jahrelang
aufbewahrt werden, je älter je besser.
Sollte sich Oel ausscheiden, so dienen einige
Tropfen Sodalösung zur Wiederherstellung gleich-
förmiger Bindung.
Die Temperamalerei wird nicht von Wasser gelöst,
das zu verwendende Papier, Leinwand oder Holz
muss vor der Bemalung grundiert sein. Die Farben
werden mit TemperaHüssigkeit vorrätig angerieben
und in Töpfen für den Gebrauch aufgehoben." Ob-
gleich man heute wieder mehr von der Malerei in
Tempera zurückgekommen ist, wegen der grossen
Schwierigkeit, glaubte ich doch diese Mitteilung be-
kannt geben zu müssen, weil die Malerei nicht von



