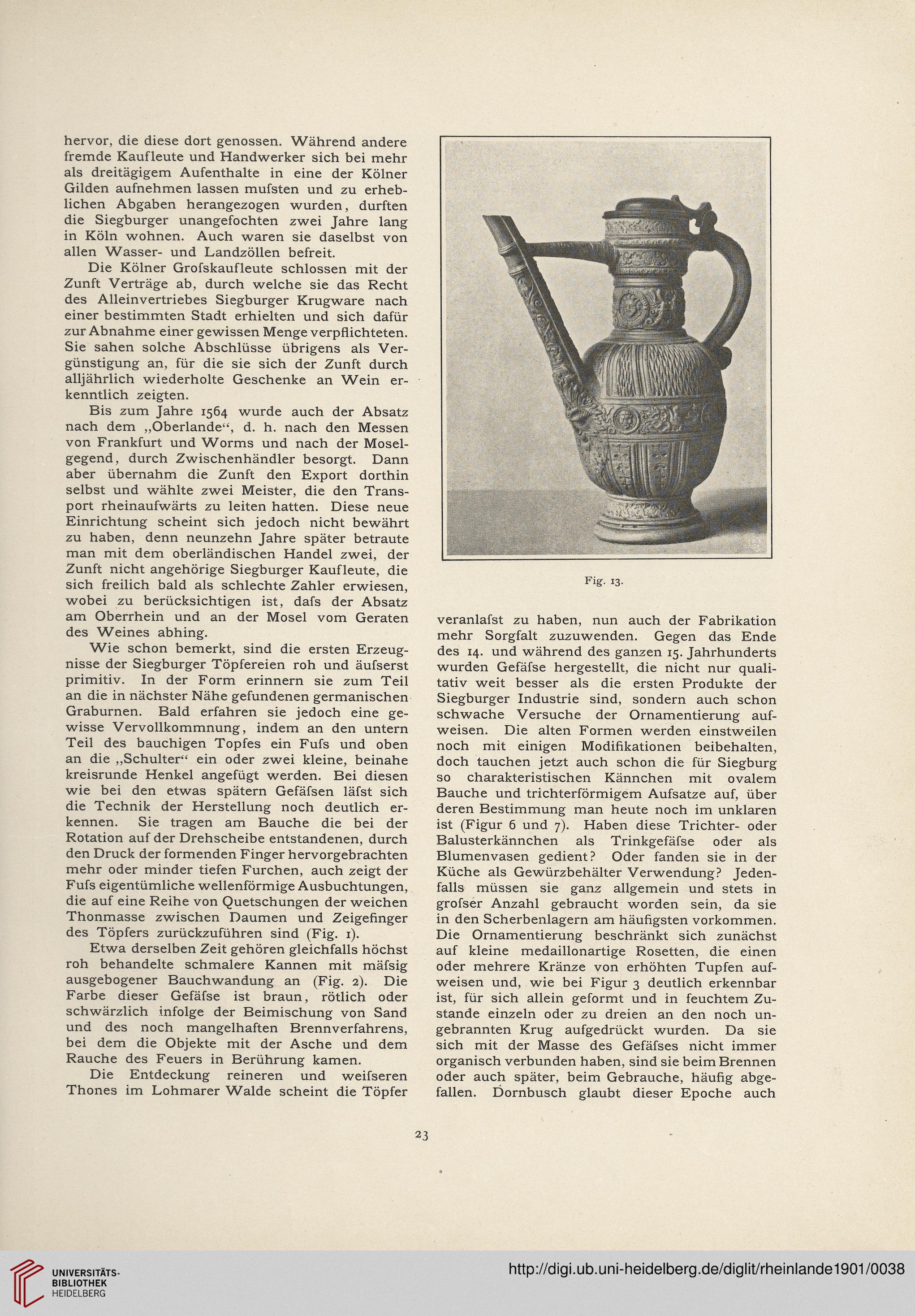hervor, die diese dort genossen. Während andere
fremde Kaufleute und Handwerker sich bei mehr
als dreitägigem Aufenthalte in eine der Kölner
Bilden aufnebmen lassen mussten und xu erbeb-
licben Abgaben berangexogen wurden, dursten
die 8iegburger unangefochten xwei Jabre lang
in Köln wolinen. ^ucb waren sie daseihst von
allen Wasser- und DandxöUen desreit.
Oie Kölner Brofskauklsute schlossen mit der
Jurist Verträge ad, durch welche sie das Becbt
des Alleinvertriebes 8isgburger Krugware nach
einer bestimmten 8tadt erhielten und sich dafür
xur Abnahme einer gewissen lVlenge verpflichteten.
8ie sahen solche Abschlüsse übrigens als Ver-
günstigung an, für die sie sich der Zunft durch
alljährlich wiederholte Beschenke an Wein er-
kenntlich Zeigten.
Lis xum Jahre 1564 wurde auch der ^bsatx
nach dem „Oberlande", d. b. nach den lVlessen
von Krankfurt und Worms und nach der lVlosel-
gegend, durch Zwischenhändler besorgt. Oann
aber übernahm die Zunft den Bxport dorthin
selbst und wählte xwei Meister, die den Trans-
port rheinaufwärts xu leiten hatten. Oiese neue
Einrichtung scheint sich jedoch nicht bewährt
xu haben, denn neunzehn Jakre später betraute
man mit dem oberländiscken sandel xwei, der
Zunft nicht angehörige 8iegburger Kaufleute, die
sich freilich bald als schlechte Zahler erwiesen,
wobei xu berücksichtigen ist, dass der ^bsatx
am Oberrhein und an der lVlosel vom Oeraten
des Weines abhing.
Wie schon bemerkt, sind die ersten Krxeug-
nisse der 8iegburger Töpfereien rob und äusserst
primitiv. In der Korm erinnern sie xum l'eil
an die in nächster blähe gefundenen germanischen
Oraburnen. Bald erfahren sie jedoch eine ge-
wisse Vervollkommnung, indem an den untern
leil des bauchigen 'Kopfes ein Kufs und oben
an die „8cbulter" ein oder xwei kleine, beinahe
kreisrunde Henkel angefügt werden. Lei diesen
wie bei den etwas spätern Belafsen lässt sich
die 'Kecbnik der Herstellung noch deutlich er-
kennen. 8ie tragen am Baucke die bei der
Dotation auf der Drehscheibe entstandenen, durch
den Druck der formenden Kinger kervorgebrachten
mehr oder minder tiefen Kurchen, auch xeigt der
Kufs eigentümliche wellenförmige Ausbuchtungen,
die auf eine Beike von (Quetschungen der weichen
'Kbonmasse xwischen Daumen und Zeigefinger
des 'Köpfers xurückxuführen sind (Kig. 1).
Ktwa derselben Zeit geboren gleichfalls höchst
rob behandelte schmalere Kannen mit mäfsig
ausgebogener Baucbwandung an (Kig. 2). Die
Karbe dieser Befälse ist braun, rötlich oder
scbwärxlich infolge der Beimischung von 8and
und des noch mangelhaften Brennverfahrens,
bei dem die Objekte mit der ^.scke und dem
Bauche des Keuers in Berührung kamen.
Die Entdeckung reineren und weisseren
'Kkones im Dobmarer Walde scheint die 'Köpfer
13-
veranlafst xu haben, nun auch der Kabrikation
mehr 8orgfalt xuxuwenden. Oegen das Knde
des 14. und während des ganxen 15. Jahrhunderts
wurden Belasse hergestellt, die nickt nur quali-
tativ weit besser als die ersten Produkte der
8iegburger Industrie sind, sondern auch schon
schwache Versuche der Ornamentierung auf-
weisen. Die alten Kormen werden einstweilen
noch mit einigen lVlodiükationen beibebalten,
dock tauchen jetxt auch schon die für 8iegburg
so charakteristischen Känncken mit ovalem
Bauche und trichterförmigem -^.utsatxe auf, über
deren Bestimmung man beute noch im unklaren
ist (Kigur 6 und 7). Baben diese Trichter- oder
Balusterkännchen als 'Krinkgetälse oder als
Blumenvasen gedient? Oder sanden sie in der
Kücbe als Oewürxbebälter Verwendung? Jeden-
falls müssen sie ganx allgemein und stets in
grosser ^nxabl gebraucht worden sein, da sie
in den 8cberbenlagern am häutigsten vorkommen.
Die Ornamentierung beschränkt sich xunäckst
auf kleine medaillonartige Bosetten, die einen
oder mehrere Kränxe von erhöhten Rupien aus-
weisen und, wie bei Kigur z deutlich erkennbar
ist, für sich allein geformt und in feuchtem Zu-
stande einxeln oder xu dreien an den noch un-
gebrannten Krug aufgedrückt wurden. Da sie
sich mit der IVlasse des Oefäfses nickt immer
organisch verbunden haben, sind sie beim Brennen
oder auch später, beim Oebraucbe, häutig abge-
fallen. Dornbusch glaubt dieser Kpocbe auch
2Z
fremde Kaufleute und Handwerker sich bei mehr
als dreitägigem Aufenthalte in eine der Kölner
Bilden aufnebmen lassen mussten und xu erbeb-
licben Abgaben berangexogen wurden, dursten
die 8iegburger unangefochten xwei Jabre lang
in Köln wolinen. ^ucb waren sie daseihst von
allen Wasser- und DandxöUen desreit.
Oie Kölner Brofskauklsute schlossen mit der
Jurist Verträge ad, durch welche sie das Becbt
des Alleinvertriebes 8isgburger Krugware nach
einer bestimmten 8tadt erhielten und sich dafür
xur Abnahme einer gewissen lVlenge verpflichteten.
8ie sahen solche Abschlüsse übrigens als Ver-
günstigung an, für die sie sich der Zunft durch
alljährlich wiederholte Beschenke an Wein er-
kenntlich Zeigten.
Lis xum Jahre 1564 wurde auch der ^bsatx
nach dem „Oberlande", d. b. nach den lVlessen
von Krankfurt und Worms und nach der lVlosel-
gegend, durch Zwischenhändler besorgt. Oann
aber übernahm die Zunft den Bxport dorthin
selbst und wählte xwei Meister, die den Trans-
port rheinaufwärts xu leiten hatten. Oiese neue
Einrichtung scheint sich jedoch nicht bewährt
xu haben, denn neunzehn Jakre später betraute
man mit dem oberländiscken sandel xwei, der
Zunft nicht angehörige 8iegburger Kaufleute, die
sich freilich bald als schlechte Zahler erwiesen,
wobei xu berücksichtigen ist, dass der ^bsatx
am Oberrhein und an der lVlosel vom Oeraten
des Weines abhing.
Wie schon bemerkt, sind die ersten Krxeug-
nisse der 8iegburger Töpfereien rob und äusserst
primitiv. In der Korm erinnern sie xum l'eil
an die in nächster blähe gefundenen germanischen
Oraburnen. Bald erfahren sie jedoch eine ge-
wisse Vervollkommnung, indem an den untern
leil des bauchigen 'Kopfes ein Kufs und oben
an die „8cbulter" ein oder xwei kleine, beinahe
kreisrunde Henkel angefügt werden. Lei diesen
wie bei den etwas spätern Belafsen lässt sich
die 'Kecbnik der Herstellung noch deutlich er-
kennen. 8ie tragen am Baucke die bei der
Dotation auf der Drehscheibe entstandenen, durch
den Druck der formenden Kinger kervorgebrachten
mehr oder minder tiefen Kurchen, auch xeigt der
Kufs eigentümliche wellenförmige Ausbuchtungen,
die auf eine Beike von (Quetschungen der weichen
'Kbonmasse xwischen Daumen und Zeigefinger
des 'Köpfers xurückxuführen sind (Kig. 1).
Ktwa derselben Zeit geboren gleichfalls höchst
rob behandelte schmalere Kannen mit mäfsig
ausgebogener Baucbwandung an (Kig. 2). Die
Karbe dieser Befälse ist braun, rötlich oder
scbwärxlich infolge der Beimischung von 8and
und des noch mangelhaften Brennverfahrens,
bei dem die Objekte mit der ^.scke und dem
Bauche des Keuers in Berührung kamen.
Die Entdeckung reineren und weisseren
'Kkones im Dobmarer Walde scheint die 'Köpfer
13-
veranlafst xu haben, nun auch der Kabrikation
mehr 8orgfalt xuxuwenden. Oegen das Knde
des 14. und während des ganxen 15. Jahrhunderts
wurden Belasse hergestellt, die nickt nur quali-
tativ weit besser als die ersten Produkte der
8iegburger Industrie sind, sondern auch schon
schwache Versuche der Ornamentierung auf-
weisen. Die alten Kormen werden einstweilen
noch mit einigen lVlodiükationen beibebalten,
dock tauchen jetxt auch schon die für 8iegburg
so charakteristischen Känncken mit ovalem
Bauche und trichterförmigem -^.utsatxe auf, über
deren Bestimmung man beute noch im unklaren
ist (Kigur 6 und 7). Baben diese Trichter- oder
Balusterkännchen als 'Krinkgetälse oder als
Blumenvasen gedient? Oder sanden sie in der
Kücbe als Oewürxbebälter Verwendung? Jeden-
falls müssen sie ganx allgemein und stets in
grosser ^nxabl gebraucht worden sein, da sie
in den 8cberbenlagern am häutigsten vorkommen.
Die Ornamentierung beschränkt sich xunäckst
auf kleine medaillonartige Bosetten, die einen
oder mehrere Kränxe von erhöhten Rupien aus-
weisen und, wie bei Kigur z deutlich erkennbar
ist, für sich allein geformt und in feuchtem Zu-
stande einxeln oder xu dreien an den noch un-
gebrannten Krug aufgedrückt wurden. Da sie
sich mit der IVlasse des Oefäfses nickt immer
organisch verbunden haben, sind sie beim Brennen
oder auch später, beim Oebraucbe, häutig abge-
fallen. Dornbusch glaubt dieser Kpocbe auch
2Z