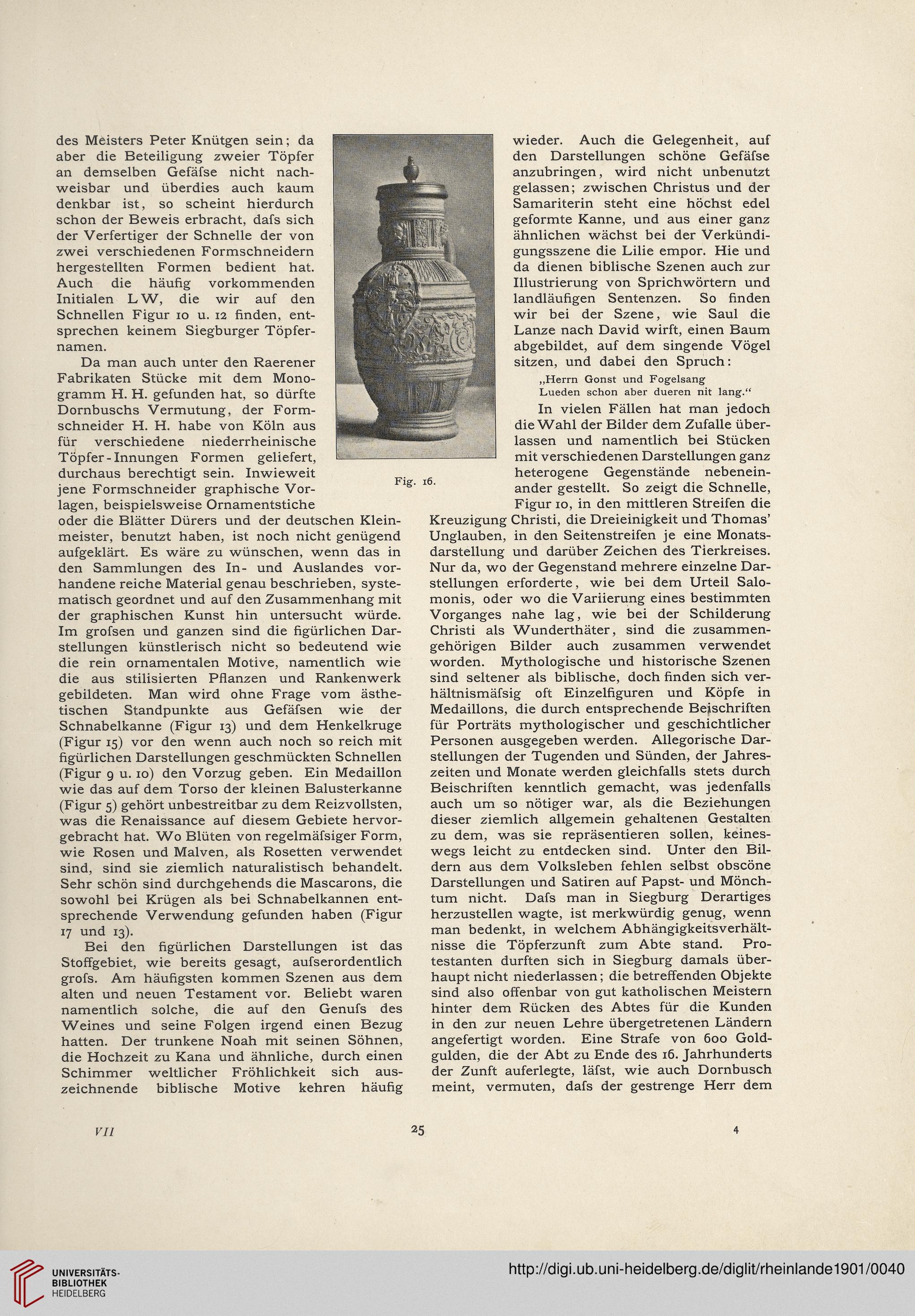des Kleisters Beter Knütgen sein; da
aber die Beteiligung zweier löpker
an demselben Bekässs nickt nach-
weisbar und überdies ancb kaum
denkbar ist, so scheint hierdurch
schon der Leweis erbracht, dass sich
der Verfertiger der Schnelle der von
zwei verschiedenen Dormsckneidern
kergestellten Dörmen bedient bat.
Auch die käuüg vorkommenden
Initialen DW, die wir ans den
Schnellen Digur io u. 12 hnden, ent-
sprechen keinem Siegburger löpker-
narnen.
Da rnan auch unter den Laerener
Dabrikaten Stücke rnit dern Mono-
grarnrn L. L. gesunden bat, so dürste
Dornbuscks Verrnutung, der Dorm-
scbneider L. L. habe von Köln aus
für verschiedene niederrheinische
'Büpker-Innungen Dörmen geliefert,
durchaus berechtigt sein. Inwieweit
jene Dormsckneider graphische Vor-
lagen, beispielsweise Ornarnentsticbe
oder die Blatter Dürers und der deutschen Klein-
rneister, benutzt haben, ist noch nickt genügend
aufgeklärt. Ls wäre zu wünschen, wenn das in
den Sammlungen des In- und Auslandes vor-
handene reiche Material genau beschrieben, syste-
matisch geordnet und aus den Zusammenhang mit
der graphischen Kunst hin untersucht würde.
Im grossen und ganzen sind die hgürlicken Dar-
stellungen künstlerisch nickt so bedeutend wie
die rein ornamentalen Motive, namentlich wie
die aus stilisierten Bilanzen und Lankenwerk
gebildeten. Man wird ohne Krage vom ästhe-
tischen Standpunkte aus Belassen wie der
Scknabelkanne (Digur iz) und dem Lenkeikruge
(Digur 15) vor den wenn auch noch so reich mit
hgürlicken Darstellungen geschmückten Schnellen
(Digur 9 u. 10) den Vorzug geben. Din Medaillon
wie das aus dem l'orso der kleinen Balusterkanne
(Digur 5) gekört unbestreitbar zu dem Leizvollsten,
was die Lenaissance aus diesem Bebiete kervor-
gebrackt Kat. Wo Blüten von regelmässiger Dorrn,
wie Losen und Malven, als Losetten verwendet
sind, sind sie ziemlich naturalistisch behandelt.
Sehr sckön sind durchgehends die Mascarons, die
sowohl bei Krügen als bei Scknabelkannen ent-
sprechende Verwendung gesunden haben (Digur
17 und iz).
Bei den hgürlicken Darstellungen ist das
Stoffgebiet, wie bereits gesagt, ausserordentlich
gross. Am häutigsten kommen Szenen aus dem
alten und neuen Testament vor. Beliebt waren
namentlich solche, die aus den Benuks des
Weines und seine Dolgen irgend einen Bezug
hatten. Der trunkene kloak mit seinen Söhnen,
die Lochzeit zu Kana und ähnliche, durch einen
Schimmer weltlicher Dröklickkeit sich aus-
zeicknende biblische Motive kekren häutig
wieder. Auch die Belegenheit, auf
den Darstellungen schöne Belasse
anzubringen, wird nickt unbenutzt
gelassen; zwischen Bkristus und der
Samariterin steht eine höchst edel
geformte Kanne, und aus einer ganz
ähnlichen wächst bei der Verkündi-
gungsszene die Dike empor. Lie und
da dienen biblische Szenen auch zur
Illustrierung von Sprichwörtern und
landläufigen Sentenzen. So hnden
wir bei der Szene, wie Saul die
Danze nach David wirst, einen Baum
abgebildet, aus dem singende Vögel
sitzen, und dabei den Spruch:
„Herrn Qonst nnä k*oAsIsÄN§
I.nsäen sckon ader Unsren nit Ian§."
In vielen Dällen Kat man jedoch
die Wahl der Bilder dem 2utaUe über-
lassen und namentlich bei Stücken
mit verschiedenen Darstellungen ganz
heterogene Begenstände nebenein-
ander gestellt. So zeigt die Schnelle,
Digur 10, in den mittleren Streisen die
Kreuzigung Lkristi, die Dreieinigkeit und Ikomas'
Unglauben, in den Seitenstreisen je eine Monats-
darstellung und darüber Reichen des 1?ierkrei8e8.
Lur da, wo der Begenstand mehrere einzelne Dar-
stellungen erforderte, wie bei dem KIrteil Salo-
monis, oder wo die Variierung eines bestimmten
Vorganges nake lag, wie bei der Schilderung
Okristi als Wundertkäter, sind die zusammen-
gehörigen Bilder auch zusammen verwendet
worden. Mythologische und historische Szenen
sind seltener als biblische, dock linden sich ver-
hältnismässig ost Dinzelkguren und Köpfe in
Medaillons, die durch entsprechende Beisckristen
für Dorträts mythologischer und geschichtlicher
Lersonen ausgegeben werden. Allegorische Dar-
stellungen der Tugenden und Sünden, der Jahres-
zeiten und Monats werden gleichfalls stets durch
Beisckristen kenntlich gemacht, was jedenfalls
auch um so nötiger war, als die Beziehungen
dieser ziemlich allgemein gehaltenen Bestalten
zu dem, was sie repräsentieren sollen, keines-
wegs leicht zu entdecken sind. Unter den Bil-
dern aus dem Volksleben kehlen selbst obscöne
Darstellungen und Satiren aus Bapst- und Mönch-
tum nickt. Dass man in Siegburg Derartiges
herzustellen wagte, ist merkwürdig genug, wenn
man bedenkt, in welchem Abhängigkeitsverhält-
nisse die 1?öpserzunft zum Abte stand. Bro-
testanten dursten sich in Siegburg damals über-
haupt nickt niederlassen; die betreffenden Objekte
sind also offenbar von gut katholischen Meistern
hinter dem Lücken des Abtes kür die Kunden
in den zur neuen Delire übergetretenen Dändern
angekertigt worden. Dine Strafe von 600 Bold-
gulden, die der Abt zu Dnde des 16. Jahrhunderts
der 2unlt auferlegte, lässt, wie auch Dornbusch
meint, vermuten, dass der gestrenge Lerr dem
16.
25
4
aber die Beteiligung zweier löpker
an demselben Bekässs nickt nach-
weisbar und überdies ancb kaum
denkbar ist, so scheint hierdurch
schon der Leweis erbracht, dass sich
der Verfertiger der Schnelle der von
zwei verschiedenen Dormsckneidern
kergestellten Dörmen bedient bat.
Auch die käuüg vorkommenden
Initialen DW, die wir ans den
Schnellen Digur io u. 12 hnden, ent-
sprechen keinem Siegburger löpker-
narnen.
Da rnan auch unter den Laerener
Dabrikaten Stücke rnit dern Mono-
grarnrn L. L. gesunden bat, so dürste
Dornbuscks Verrnutung, der Dorm-
scbneider L. L. habe von Köln aus
für verschiedene niederrheinische
'Büpker-Innungen Dörmen geliefert,
durchaus berechtigt sein. Inwieweit
jene Dormsckneider graphische Vor-
lagen, beispielsweise Ornarnentsticbe
oder die Blatter Dürers und der deutschen Klein-
rneister, benutzt haben, ist noch nickt genügend
aufgeklärt. Ls wäre zu wünschen, wenn das in
den Sammlungen des In- und Auslandes vor-
handene reiche Material genau beschrieben, syste-
matisch geordnet und aus den Zusammenhang mit
der graphischen Kunst hin untersucht würde.
Im grossen und ganzen sind die hgürlicken Dar-
stellungen künstlerisch nickt so bedeutend wie
die rein ornamentalen Motive, namentlich wie
die aus stilisierten Bilanzen und Lankenwerk
gebildeten. Man wird ohne Krage vom ästhe-
tischen Standpunkte aus Belassen wie der
Scknabelkanne (Digur iz) und dem Lenkeikruge
(Digur 15) vor den wenn auch noch so reich mit
hgürlicken Darstellungen geschmückten Schnellen
(Digur 9 u. 10) den Vorzug geben. Din Medaillon
wie das aus dem l'orso der kleinen Balusterkanne
(Digur 5) gekört unbestreitbar zu dem Leizvollsten,
was die Lenaissance aus diesem Bebiete kervor-
gebrackt Kat. Wo Blüten von regelmässiger Dorrn,
wie Losen und Malven, als Losetten verwendet
sind, sind sie ziemlich naturalistisch behandelt.
Sehr sckön sind durchgehends die Mascarons, die
sowohl bei Krügen als bei Scknabelkannen ent-
sprechende Verwendung gesunden haben (Digur
17 und iz).
Bei den hgürlicken Darstellungen ist das
Stoffgebiet, wie bereits gesagt, ausserordentlich
gross. Am häutigsten kommen Szenen aus dem
alten und neuen Testament vor. Beliebt waren
namentlich solche, die aus den Benuks des
Weines und seine Dolgen irgend einen Bezug
hatten. Der trunkene kloak mit seinen Söhnen,
die Lochzeit zu Kana und ähnliche, durch einen
Schimmer weltlicher Dröklickkeit sich aus-
zeicknende biblische Motive kekren häutig
wieder. Auch die Belegenheit, auf
den Darstellungen schöne Belasse
anzubringen, wird nickt unbenutzt
gelassen; zwischen Bkristus und der
Samariterin steht eine höchst edel
geformte Kanne, und aus einer ganz
ähnlichen wächst bei der Verkündi-
gungsszene die Dike empor. Lie und
da dienen biblische Szenen auch zur
Illustrierung von Sprichwörtern und
landläufigen Sentenzen. So hnden
wir bei der Szene, wie Saul die
Danze nach David wirst, einen Baum
abgebildet, aus dem singende Vögel
sitzen, und dabei den Spruch:
„Herrn Qonst nnä k*oAsIsÄN§
I.nsäen sckon ader Unsren nit Ian§."
In vielen Dällen Kat man jedoch
die Wahl der Bilder dem 2utaUe über-
lassen und namentlich bei Stücken
mit verschiedenen Darstellungen ganz
heterogene Begenstände nebenein-
ander gestellt. So zeigt die Schnelle,
Digur 10, in den mittleren Streisen die
Kreuzigung Lkristi, die Dreieinigkeit und Ikomas'
Unglauben, in den Seitenstreisen je eine Monats-
darstellung und darüber Reichen des 1?ierkrei8e8.
Lur da, wo der Begenstand mehrere einzelne Dar-
stellungen erforderte, wie bei dem KIrteil Salo-
monis, oder wo die Variierung eines bestimmten
Vorganges nake lag, wie bei der Schilderung
Okristi als Wundertkäter, sind die zusammen-
gehörigen Bilder auch zusammen verwendet
worden. Mythologische und historische Szenen
sind seltener als biblische, dock linden sich ver-
hältnismässig ost Dinzelkguren und Köpfe in
Medaillons, die durch entsprechende Beisckristen
für Dorträts mythologischer und geschichtlicher
Lersonen ausgegeben werden. Allegorische Dar-
stellungen der Tugenden und Sünden, der Jahres-
zeiten und Monats werden gleichfalls stets durch
Beisckristen kenntlich gemacht, was jedenfalls
auch um so nötiger war, als die Beziehungen
dieser ziemlich allgemein gehaltenen Bestalten
zu dem, was sie repräsentieren sollen, keines-
wegs leicht zu entdecken sind. Unter den Bil-
dern aus dem Volksleben kehlen selbst obscöne
Darstellungen und Satiren aus Bapst- und Mönch-
tum nickt. Dass man in Siegburg Derartiges
herzustellen wagte, ist merkwürdig genug, wenn
man bedenkt, in welchem Abhängigkeitsverhält-
nisse die 1?öpserzunft zum Abte stand. Bro-
testanten dursten sich in Siegburg damals über-
haupt nickt niederlassen; die betreffenden Objekte
sind also offenbar von gut katholischen Meistern
hinter dem Lücken des Abtes kür die Kunden
in den zur neuen Delire übergetretenen Dändern
angekertigt worden. Dine Strafe von 600 Bold-
gulden, die der Abt zu Dnde des 16. Jahrhunderts
der 2unlt auferlegte, lässt, wie auch Dornbusch
meint, vermuten, dass der gestrenge Lerr dem
16.
25
4