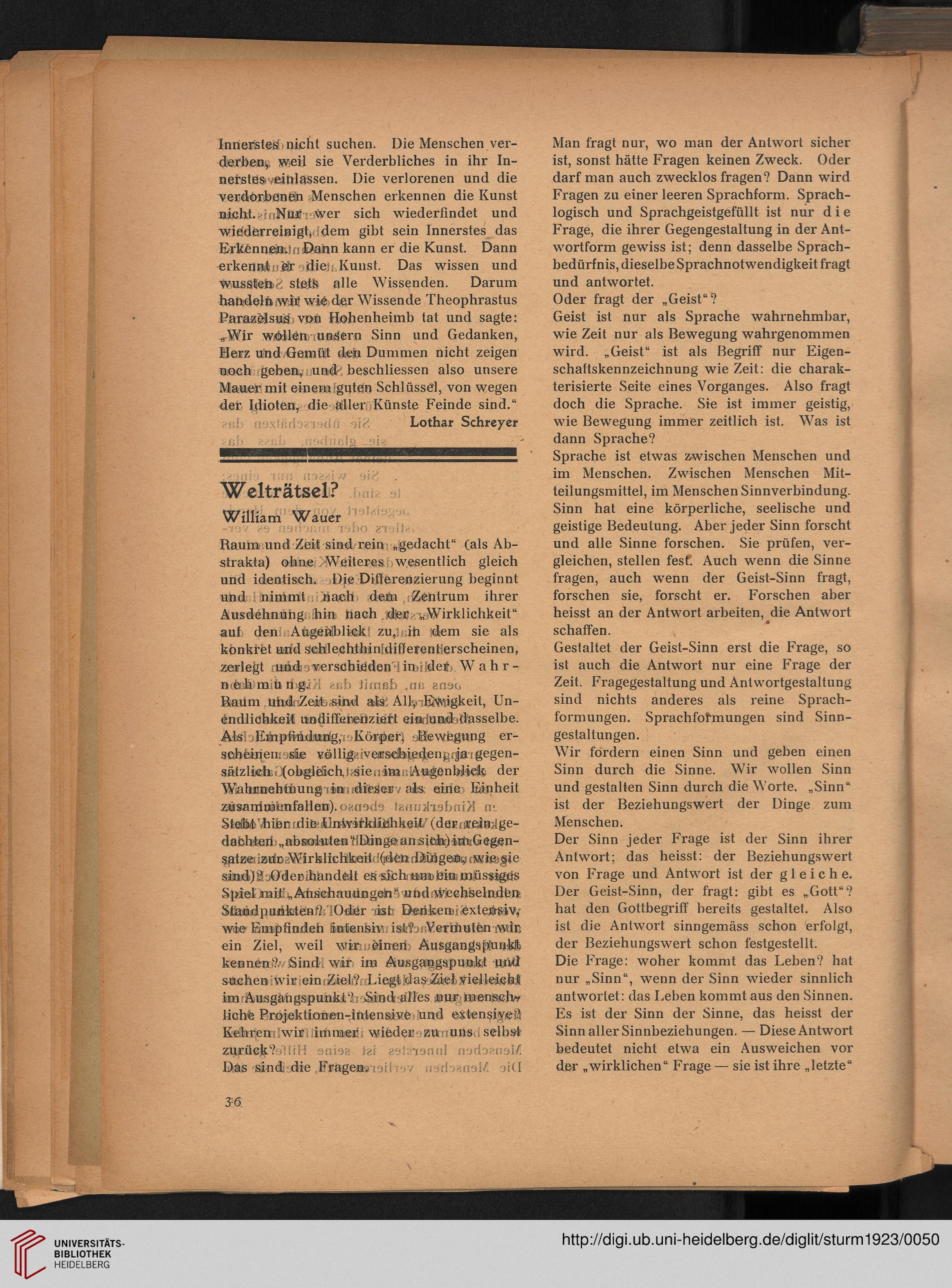Innerstes nicht suchen. Die Menschen ver-
derben, weil sie Verderbliches in ihr In-
nerstes .einlassen. Die verlorenen und die
verdorbenen Menschen erkennen die Kunst
nicht. AnNüJf wer sich wiederfindet und
wiederreinigt, dem gibt sein Innerstes das
Erkennen Jn Dann kann er die Kunst. Dann
erkennt $r die Kunst. Das wissen und
wussten^ stets alle Wissenden. Darum
handele wiit wie der Wissende Theophrastus
ParazMsuiS von Hohenheimb tat und sagte:
„Wir wMLen unäern Sinn und Gedanken,
Herz und Gemüt den Dummen nicht zeigen
noch geben, und beschliessen also unsere
Mauer mit einem guten Schlüssel, von wegen
der Idioten, die aller Künste Feinde sind.“
Lothar Schreyer
Welträtsel?
William Wauer
-rrz nadoßm iabo zielt«.
Raum und Zeit sind rein „gedacht“ (als Ab-
strakta) ohne Weiteres wesentlich gleich
und identisch. Die Differenzierung beginnt
und nimmt nach dem Zentrum ihrer
Ausdehnung hin hach der „:Wirklichkeit“
auf den Augenblick zu,uih dem sie als
konkret und schlechthinldifferenfcerscheinen,
zerlegt und verschieden inEdet Wahr-
n«ehm üri;gi cb iinißb .nß enoe
Raum uMrZeit sind als AlJy Ewigkeit, Un-
endlichkeit andifferenziert eiwlund dasselbe.
Als Empfindung, Körper, 'Bewegung er-
scheirienr sie völligzJversdhiedengfja{gegen-
sätzlich iXobgleächjzsienimbAugenblick der
Wahrnehfnung:in diesem als eine Einheit
zÄsairimhnfallen). oauade lumdiabnDI ir
Steht’Uior die Univifknchkeil (jl er? aTink ge-
dachten „absoluten ff Ding© anjs ich) irhjGegen-
satzei Ad n [Wirklichkeit^ fDüige®^ (Wiföfie
sinds)S:;Oder£handelt es sich ttnr bin müssiges
Spiel mit „ Anschauungen“ und^eehselndbrt
Standpunkten?’iOder -risfa Derikeaextehsiv,
wie Empfindeh intensiv i&fcTonVerihuten wdß
ein Ziel, weil wir einen Ausgangspunkt
kennen?; Sind wir im Ausgangspunkt ujMl
suchen wir ein Ziel? Liegt das Ziel vielleich,l!
im Ausgangspunkt?,? Sindülles nur mensclw
liehe Projektionen-ihten&ive und extensiyieff
Kehren wir immer wieder zu ?uns selbst
Z^jEÜs^?d!liH oniog Jzi zsiaiannl nadafciiaM
Das sind die Frageneiail iev narioanaM oi(I
Man fragt nur, wo man der Antwort sicher
ist, sonst hätte Fragen keinen Zweck. Oder
darf man auch zwecklos fragen? Dann wird
Fragen zu einer leeren Sprachform. Sprach-
logisch und Sprachgeistgefüllt ist nur die
Frage, die ihrer Gegengestaltung in der Ant-
wortform gewiss ist; denn dasselbe Sprach-
bedürfnis, dieselbe Sprachnotwendigkeit fragt
und antwortet.
Oder fragt der „Geist“?
Geist ist nur als Sprache wahrnehmbar,
wie Zeit nur als Bewegung wahrgenommen
wird. „Geist“ ist als Begriff nur Eigen-
schaftskennzeichnung wie Zeit: die charak-
terisierte Seite eines Vorganges. Also fragt
doch die Sprache. Sie ist immer geistig,
wie Bewegung immer zeitlich ist. Was ist
dann Sprache?
Sprache ist etwas zwischen Menschen und
im Menschen. Zwischen Menschen Mit-
teilungsmittel, im MenschenSinnverbindung.
Sinn hat eine körperliche, seelische und
geistige Bedeutung. Aber jeder Sinn forscht
und alle Sinne forschen. Sie prüfen, ver-
gleichen, stellen fest. Auch wenn die Sinne
fragen, auch wenn der Geist-Sinn fragt,
forschen sie, forscht er. Forschen aber
heisst an der Antwort arbeiten, die Antwort
schaffen.
Gestaltet der Geist-Sinn erst die Frage, so
ist auch die Antwort nur eine Frage der
Zeit. Fragegestaltung und Antwortgestaltung
sind nichts anderes als reine Sprach-
formungen. Sprachfofmungen sind Sinn-
gestaltungen.
Wir fordern einen Sinn und geben einen
Sinn durch die Sinne. Wir wollen Sinn
und gestalten Sinn durch die Worte. „Sinn“
ist der Beziehungswert der Dinge zum
Menschen.
Der Sinn jeder Frage ist der Sinn ihrer
Antwort; das heisst: der Beziehungswert
von Frage und Antwort ist der gleiche.
Der Geist-Sinn, der fragt: gibt es „Gott“?
hat den Gottbegriff bereits gestaltet. Also
ist die Antwort sinngemäss schon erfolgt,
der Beziehungswert schon festgestellt.
Die Frage: woher kommt das Leben? hat
nur „Sinn“, wenn der Sinn wieder sinnlich
antwortet: das Leben kommt aus den Sinnen.
Es ist der Sinn der Sinne, das heisst der
Sinn aller Sinnbeziehungen. — Diese Antwort
bedeutet nicht etwa ein Ausweichen vor
der „wirklichen“ Frage — sie ist ihre „letzte“
derben, weil sie Verderbliches in ihr In-
nerstes .einlassen. Die verlorenen und die
verdorbenen Menschen erkennen die Kunst
nicht. AnNüJf wer sich wiederfindet und
wiederreinigt, dem gibt sein Innerstes das
Erkennen Jn Dann kann er die Kunst. Dann
erkennt $r die Kunst. Das wissen und
wussten^ stets alle Wissenden. Darum
handele wiit wie der Wissende Theophrastus
ParazMsuiS von Hohenheimb tat und sagte:
„Wir wMLen unäern Sinn und Gedanken,
Herz und Gemüt den Dummen nicht zeigen
noch geben, und beschliessen also unsere
Mauer mit einem guten Schlüssel, von wegen
der Idioten, die aller Künste Feinde sind.“
Lothar Schreyer
Welträtsel?
William Wauer
-rrz nadoßm iabo zielt«.
Raum und Zeit sind rein „gedacht“ (als Ab-
strakta) ohne Weiteres wesentlich gleich
und identisch. Die Differenzierung beginnt
und nimmt nach dem Zentrum ihrer
Ausdehnung hin hach der „:Wirklichkeit“
auf den Augenblick zu,uih dem sie als
konkret und schlechthinldifferenfcerscheinen,
zerlegt und verschieden inEdet Wahr-
n«ehm üri;gi cb iinißb .nß enoe
Raum uMrZeit sind als AlJy Ewigkeit, Un-
endlichkeit andifferenziert eiwlund dasselbe.
Als Empfindung, Körper, 'Bewegung er-
scheirienr sie völligzJversdhiedengfja{gegen-
sätzlich iXobgleächjzsienimbAugenblick der
Wahrnehfnung:in diesem als eine Einheit
zÄsairimhnfallen). oauade lumdiabnDI ir
Steht’Uior die Univifknchkeil (jl er? aTink ge-
dachten „absoluten ff Ding© anjs ich) irhjGegen-
satzei Ad n [Wirklichkeit^ fDüige®^ (Wiföfie
sinds)S:;Oder£handelt es sich ttnr bin müssiges
Spiel mit „ Anschauungen“ und^eehselndbrt
Standpunkten?’iOder -risfa Derikeaextehsiv,
wie Empfindeh intensiv i&fcTonVerihuten wdß
ein Ziel, weil wir einen Ausgangspunkt
kennen?; Sind wir im Ausgangspunkt ujMl
suchen wir ein Ziel? Liegt das Ziel vielleich,l!
im Ausgangspunkt?,? Sindülles nur mensclw
liehe Projektionen-ihten&ive und extensiyieff
Kehren wir immer wieder zu ?uns selbst
Z^jEÜs^?d!liH oniog Jzi zsiaiannl nadafciiaM
Das sind die Frageneiail iev narioanaM oi(I
Man fragt nur, wo man der Antwort sicher
ist, sonst hätte Fragen keinen Zweck. Oder
darf man auch zwecklos fragen? Dann wird
Fragen zu einer leeren Sprachform. Sprach-
logisch und Sprachgeistgefüllt ist nur die
Frage, die ihrer Gegengestaltung in der Ant-
wortform gewiss ist; denn dasselbe Sprach-
bedürfnis, dieselbe Sprachnotwendigkeit fragt
und antwortet.
Oder fragt der „Geist“?
Geist ist nur als Sprache wahrnehmbar,
wie Zeit nur als Bewegung wahrgenommen
wird. „Geist“ ist als Begriff nur Eigen-
schaftskennzeichnung wie Zeit: die charak-
terisierte Seite eines Vorganges. Also fragt
doch die Sprache. Sie ist immer geistig,
wie Bewegung immer zeitlich ist. Was ist
dann Sprache?
Sprache ist etwas zwischen Menschen und
im Menschen. Zwischen Menschen Mit-
teilungsmittel, im MenschenSinnverbindung.
Sinn hat eine körperliche, seelische und
geistige Bedeutung. Aber jeder Sinn forscht
und alle Sinne forschen. Sie prüfen, ver-
gleichen, stellen fest. Auch wenn die Sinne
fragen, auch wenn der Geist-Sinn fragt,
forschen sie, forscht er. Forschen aber
heisst an der Antwort arbeiten, die Antwort
schaffen.
Gestaltet der Geist-Sinn erst die Frage, so
ist auch die Antwort nur eine Frage der
Zeit. Fragegestaltung und Antwortgestaltung
sind nichts anderes als reine Sprach-
formungen. Sprachfofmungen sind Sinn-
gestaltungen.
Wir fordern einen Sinn und geben einen
Sinn durch die Sinne. Wir wollen Sinn
und gestalten Sinn durch die Worte. „Sinn“
ist der Beziehungswert der Dinge zum
Menschen.
Der Sinn jeder Frage ist der Sinn ihrer
Antwort; das heisst: der Beziehungswert
von Frage und Antwort ist der gleiche.
Der Geist-Sinn, der fragt: gibt es „Gott“?
hat den Gottbegriff bereits gestaltet. Also
ist die Antwort sinngemäss schon erfolgt,
der Beziehungswert schon festgestellt.
Die Frage: woher kommt das Leben? hat
nur „Sinn“, wenn der Sinn wieder sinnlich
antwortet: das Leben kommt aus den Sinnen.
Es ist der Sinn der Sinne, das heisst der
Sinn aller Sinnbeziehungen. — Diese Antwort
bedeutet nicht etwa ein Ausweichen vor
der „wirklichen“ Frage — sie ist ihre „letzte“