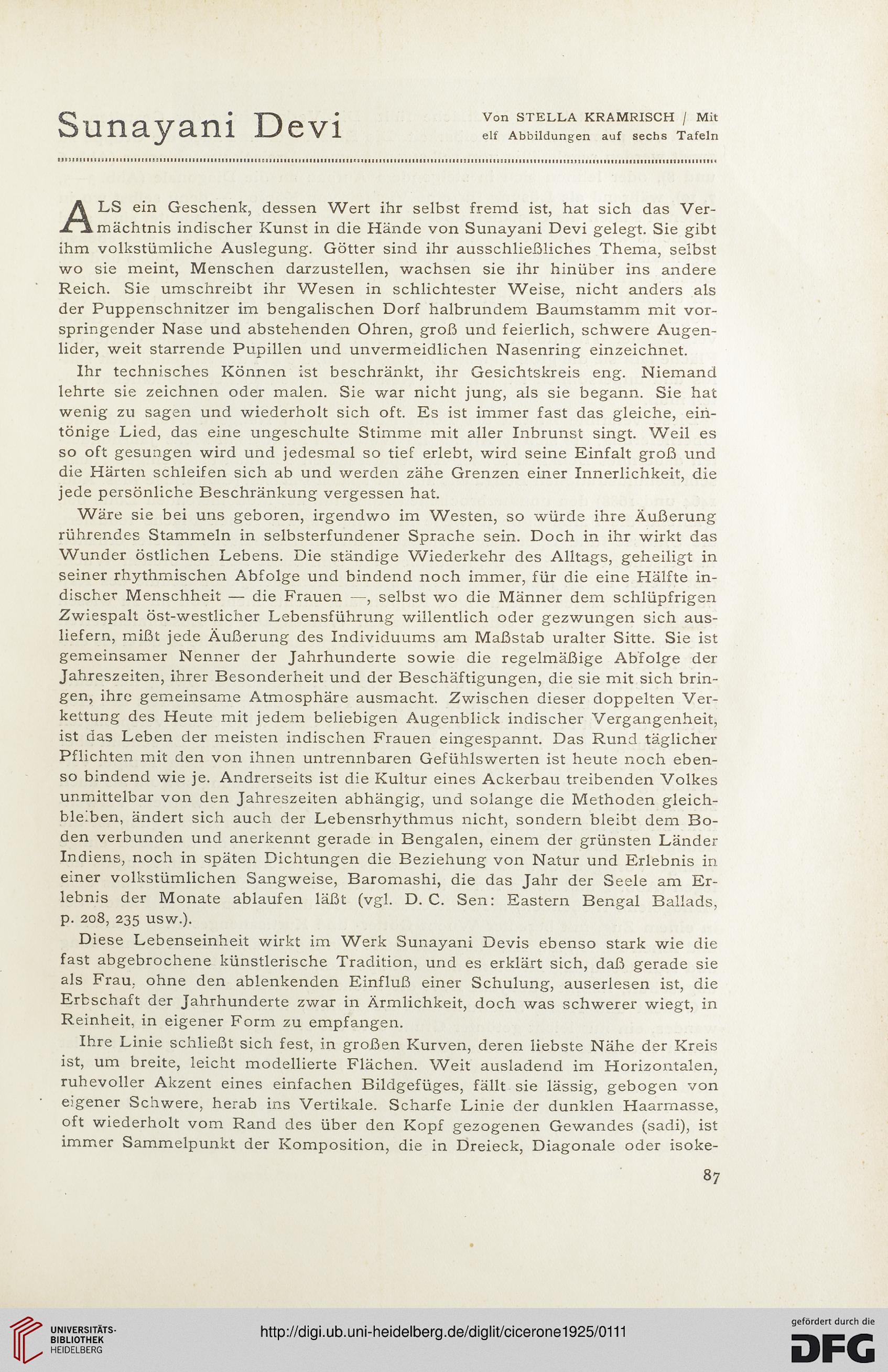Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 17.1925
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.42040#0111
DOI Heft:
Heft 2
DOI Artikel:Kramrisch, Stella: Sunayani Devi
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.42040#0111
Von STELLA KRAMRISCH / Mit
elf Abbildungen auf sechs Tafeln
Sunayani Devi
ALS ein Geschenk, dessen Wert ihr selbst fremd ist, hat sich das Ver-
mächtnis indischer Kunst in die Hände von Sunayani Devi gelegt. Sie gibt
ihm volkstümliche Auslegung. Götter sind ihr ausschließliches Thema, selbst
wo sie meint, Menschen darzustellen, wachsen sie ihr hinüber ins andere
Reich. Sie umschreibt ihr Wesen in schlichtester Weise, nicht anders als
der Puppenschnitzer im bengalischen Dorf halbrundem Baumstamm mit vor-
springender Nase und abstehenden Ohren, groß und feierlich, schwere Augen-
lider, weit starrende Pupillen und unvermeidlichen Nasenring einzeichnet.
Ihr technisches Können ist beschränkt, ihr Gesichtskreis eng. Niemand
lehrte sie zeichnen oder malen. Sie war nicht jung, als sie begann. Sie hat
wenig zu sagen und wiederholt sich oft. Es ist immer fast das gleiche, ein-
tönige Lied, das eine ungeschulte Stimme mit aller Inbrunst singt. Weil es
so oft gesungen wird und jedesmal so tief erlebt, wird seine Einfalt groß und
die Härten schleifen sich ab und werden zähe Grenzen einer Innerlichkeit, die
jede persönliche Beschränkung vergessen hat.
Wäre sie bei uns geboren, irgendwo im Westen, so würde ihre Äußerung
rührendes Stammeln in selbsterfundener Sprache sein. Doch in ihr wirkt das
Wunder östlichen Lebens. Die ständige Wiederkehr des Alltags, geheiligt in
seiner rhythmischen Abfolge und bindend noch immer, für die eine Hälfte in-
discher Menschheit — die Frauen —, selbst wo die Männer dem schlüpfrigen
Zwiespalt öst-westlicher Lebensführung willentlich oder gezwungen sich aus-
liefern, mißt jede Äußerung des Individuums am Maßstab uralter Sitte. Sie ist
gemeinsamer Nenner der Jahrhunderte sowie die regelmäßige Abfolge der
Jahreszeiten, ihrer Besonderheit und der Beschäftigungen, die sie mit sich brin-
gen, ihre gemeinsame Atmosphäre ausmacht. Zwischen dieser doppelten Ver-
kettung des Heute mit jedem beliebigen Augenblick indischer Vergangenheit,
ist das Leben der meisten indischen Frauen eingespannt. Das Rund täglicher
Pflichten mit den von ihnen untrennbaren Gefühlswerten ist heute noch eben-
so bindend wie je. Andrerseits ist die Kultur eines Ackerbau treibenden Volkes
unmittelbar von den Jahreszeiten abhängig, und solange die Methoden gleich-
bleiben, ändert sich auch der Lebensrhythmus nicht, sondern bleibt dem Bo-
den verbunden und anerkennt gerade in Bengalen, einem der grünsten Länder
Indiens, noch in späten Dichtungen die Beziehung von Natur und Erlebnis in
einer volkstümlichen Sangweise, Baromashi, die das Jahr der Seele am Er-
lebnis der Monate ablaufen läßt (vgl. D. C. Sen: Eastern Bengal Ballads,
p. 208, 235 usw.).
Diese Lebenseinheit wirkt im Werk Sunayani Devis ebenso stark wie die
fast abgebrochene künstlerische Tradition, und es erklärt sich, daß gerade sie
als Frau, ohne den ablenkenden Einfluß einer Schulung, auserlesen ist, die
Erbschaft der Jahrhunderte zwar in Ärmlichkeit, doch was schwerer wiegt, in
Reinheit, in eigener Form zu empfangen.
Ihre Linie schließt sich fest, in großen Kurven, deren liebste Nähe der Kreis
ist, um breite, leicht modellierte Flächen. Weit ausladend im Horizontalen,
ruhevoller Akzent eines einfachen Bildgefüges, fällt sie lässig, gebogen von
eigener Schwere, herab ins Vertikale. Scharfe Linie der dunklen Haarmasse,
oft wiederholt vom Rand des über den Kopf gezogenen Gewandes (sadi), ist
immer Sammelpunkt der Komposition, die in Dreieck, Diagonale oder isoke-
87
elf Abbildungen auf sechs Tafeln
Sunayani Devi
ALS ein Geschenk, dessen Wert ihr selbst fremd ist, hat sich das Ver-
mächtnis indischer Kunst in die Hände von Sunayani Devi gelegt. Sie gibt
ihm volkstümliche Auslegung. Götter sind ihr ausschließliches Thema, selbst
wo sie meint, Menschen darzustellen, wachsen sie ihr hinüber ins andere
Reich. Sie umschreibt ihr Wesen in schlichtester Weise, nicht anders als
der Puppenschnitzer im bengalischen Dorf halbrundem Baumstamm mit vor-
springender Nase und abstehenden Ohren, groß und feierlich, schwere Augen-
lider, weit starrende Pupillen und unvermeidlichen Nasenring einzeichnet.
Ihr technisches Können ist beschränkt, ihr Gesichtskreis eng. Niemand
lehrte sie zeichnen oder malen. Sie war nicht jung, als sie begann. Sie hat
wenig zu sagen und wiederholt sich oft. Es ist immer fast das gleiche, ein-
tönige Lied, das eine ungeschulte Stimme mit aller Inbrunst singt. Weil es
so oft gesungen wird und jedesmal so tief erlebt, wird seine Einfalt groß und
die Härten schleifen sich ab und werden zähe Grenzen einer Innerlichkeit, die
jede persönliche Beschränkung vergessen hat.
Wäre sie bei uns geboren, irgendwo im Westen, so würde ihre Äußerung
rührendes Stammeln in selbsterfundener Sprache sein. Doch in ihr wirkt das
Wunder östlichen Lebens. Die ständige Wiederkehr des Alltags, geheiligt in
seiner rhythmischen Abfolge und bindend noch immer, für die eine Hälfte in-
discher Menschheit — die Frauen —, selbst wo die Männer dem schlüpfrigen
Zwiespalt öst-westlicher Lebensführung willentlich oder gezwungen sich aus-
liefern, mißt jede Äußerung des Individuums am Maßstab uralter Sitte. Sie ist
gemeinsamer Nenner der Jahrhunderte sowie die regelmäßige Abfolge der
Jahreszeiten, ihrer Besonderheit und der Beschäftigungen, die sie mit sich brin-
gen, ihre gemeinsame Atmosphäre ausmacht. Zwischen dieser doppelten Ver-
kettung des Heute mit jedem beliebigen Augenblick indischer Vergangenheit,
ist das Leben der meisten indischen Frauen eingespannt. Das Rund täglicher
Pflichten mit den von ihnen untrennbaren Gefühlswerten ist heute noch eben-
so bindend wie je. Andrerseits ist die Kultur eines Ackerbau treibenden Volkes
unmittelbar von den Jahreszeiten abhängig, und solange die Methoden gleich-
bleiben, ändert sich auch der Lebensrhythmus nicht, sondern bleibt dem Bo-
den verbunden und anerkennt gerade in Bengalen, einem der grünsten Länder
Indiens, noch in späten Dichtungen die Beziehung von Natur und Erlebnis in
einer volkstümlichen Sangweise, Baromashi, die das Jahr der Seele am Er-
lebnis der Monate ablaufen läßt (vgl. D. C. Sen: Eastern Bengal Ballads,
p. 208, 235 usw.).
Diese Lebenseinheit wirkt im Werk Sunayani Devis ebenso stark wie die
fast abgebrochene künstlerische Tradition, und es erklärt sich, daß gerade sie
als Frau, ohne den ablenkenden Einfluß einer Schulung, auserlesen ist, die
Erbschaft der Jahrhunderte zwar in Ärmlichkeit, doch was schwerer wiegt, in
Reinheit, in eigener Form zu empfangen.
Ihre Linie schließt sich fest, in großen Kurven, deren liebste Nähe der Kreis
ist, um breite, leicht modellierte Flächen. Weit ausladend im Horizontalen,
ruhevoller Akzent eines einfachen Bildgefüges, fällt sie lässig, gebogen von
eigener Schwere, herab ins Vertikale. Scharfe Linie der dunklen Haarmasse,
oft wiederholt vom Rand des über den Kopf gezogenen Gewandes (sadi), ist
immer Sammelpunkt der Komposition, die in Dreieck, Diagonale oder isoke-
87