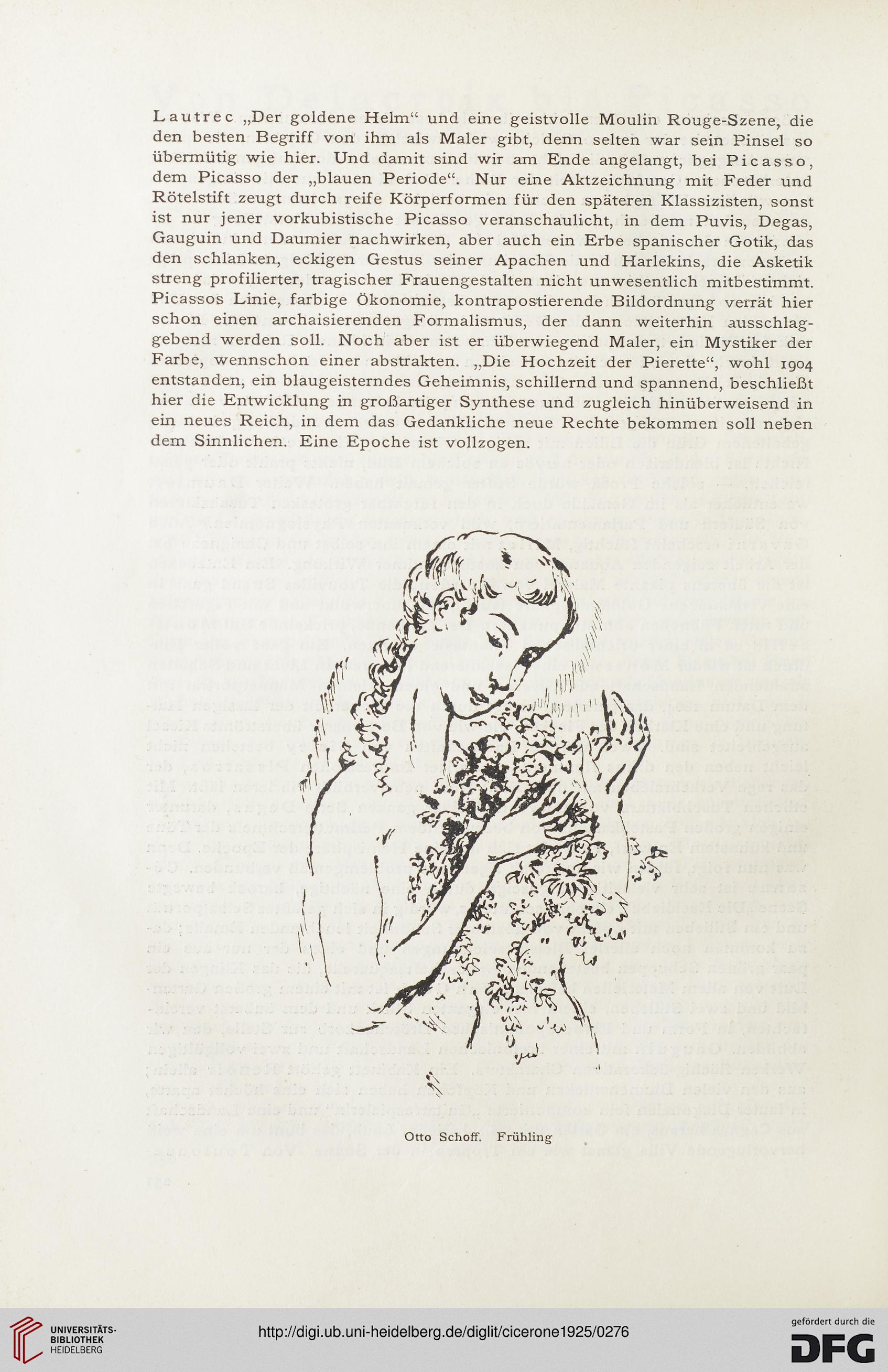Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 17.1925
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.42040#0276
DOI Heft:
Heft 5
DOI Artikel:Wolfradt, Willi: Von Delacroix bis Picasso: Ausstellung bei Hugo Perls in Berlin
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.42040#0276
Lautrec »Der goldene Helm“ und eine geistvolle Moulin Rouge-Szene, die
den besten Begriff von ihm als Maler gibt, denn selten war sein Pinsel so
übermütig wie hier. Und damit sind wir am Ende angelangt, bei Picasso,
dem Picasso der „blauen Periode“. Nur eine Aktzeichnung mit Feder und
Rötelstift zeugt durch reife Körperformen für den späteren Klassizisten, sonst
ist nur jener vorkubistische Picasso veranschaulicht, in dem Puvis, Degas,
Gauguin und Daumier nachwirken, aber auch ein Erbe spanischer Gotik, das
den schlanken, eckigen Gestus seiner Apachen und Harlekins, die Asketik
streng profilierter, tragischer Frauengestalten nicht unwesentlich mitbestimmt.
Picassos Linie, farbige Ökonomie, kontrapostierende Bildordnung verrät hier
schon einen archaisierenden Formalismus, der dann weiterhin ausschlag-
gebend werden soll. Noch aber ist er überwiegend Maler, ein Mystiker der
Farbe, wennschon einer abstrakten. „Die Hochzeit der Pierette“, wohl 1904
entstanden, ein blaugeisterndes Geheimnis, schillernd und spannend, beschließt
hier die Entwicklung in großartiger Synthese und zugleich hinüberweisend in
ein neues Reich, in dem das Gedankliche neue Rechte bekommen soll neben
dem Sinnlichen. Eine Epoche ist vollzogen.
Otto Schoff. Frühling
den besten Begriff von ihm als Maler gibt, denn selten war sein Pinsel so
übermütig wie hier. Und damit sind wir am Ende angelangt, bei Picasso,
dem Picasso der „blauen Periode“. Nur eine Aktzeichnung mit Feder und
Rötelstift zeugt durch reife Körperformen für den späteren Klassizisten, sonst
ist nur jener vorkubistische Picasso veranschaulicht, in dem Puvis, Degas,
Gauguin und Daumier nachwirken, aber auch ein Erbe spanischer Gotik, das
den schlanken, eckigen Gestus seiner Apachen und Harlekins, die Asketik
streng profilierter, tragischer Frauengestalten nicht unwesentlich mitbestimmt.
Picassos Linie, farbige Ökonomie, kontrapostierende Bildordnung verrät hier
schon einen archaisierenden Formalismus, der dann weiterhin ausschlag-
gebend werden soll. Noch aber ist er überwiegend Maler, ein Mystiker der
Farbe, wennschon einer abstrakten. „Die Hochzeit der Pierette“, wohl 1904
entstanden, ein blaugeisterndes Geheimnis, schillernd und spannend, beschließt
hier die Entwicklung in großartiger Synthese und zugleich hinüberweisend in
ein neues Reich, in dem das Gedankliche neue Rechte bekommen soll neben
dem Sinnlichen. Eine Epoche ist vollzogen.
Otto Schoff. Frühling