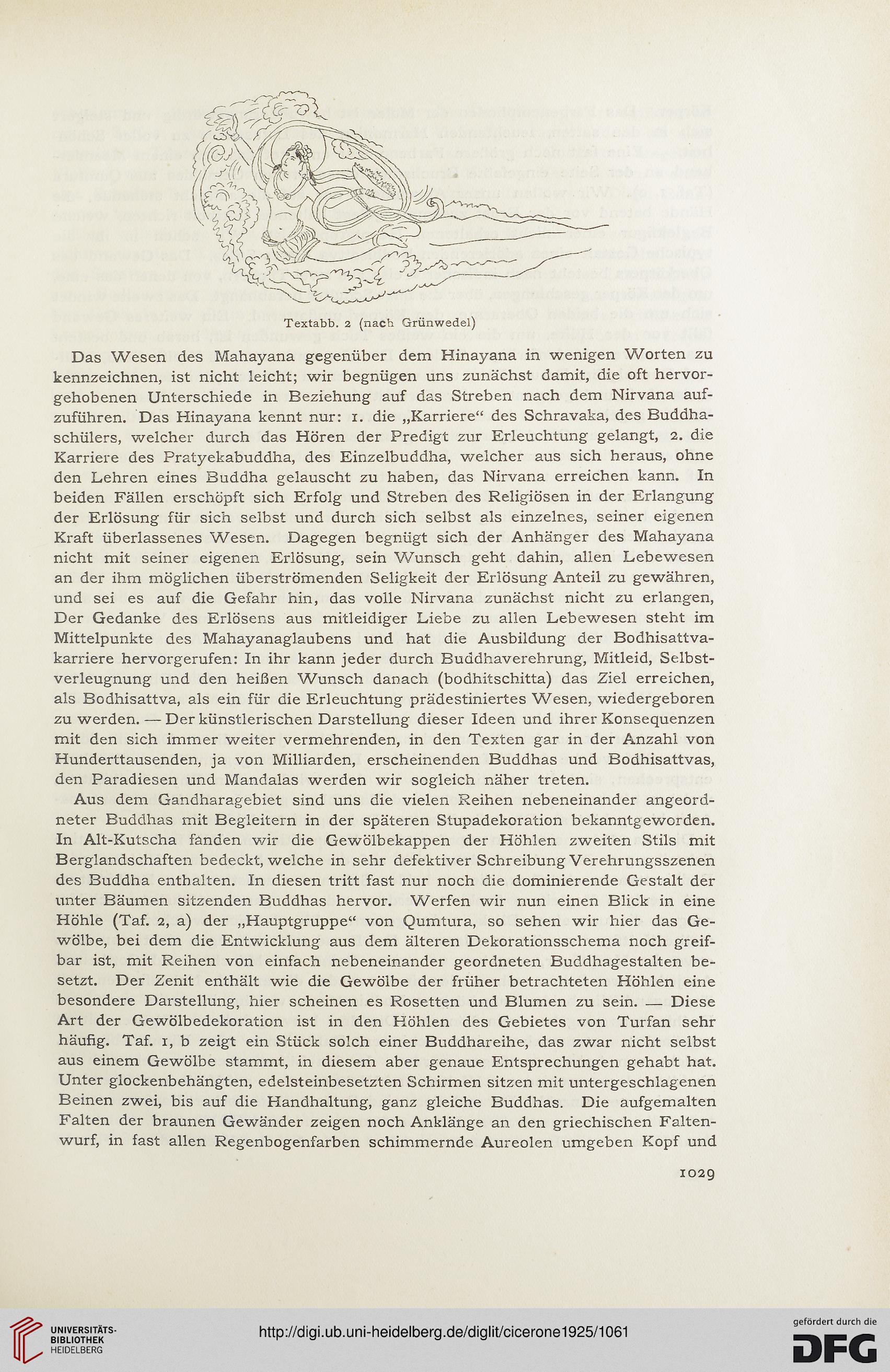Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 17.1925
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.42040#1061
DOI Heft:
Heft 21
DOI Artikel:Waldschmidt, Ernst: Die uigurisch-chinesische Epoche in der Kunst der Oase von Turfan
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.42040#1061
Textabb. 2 (nach Grünwedel)
Das Wesen des Mahayana gegenüber dem Hinayana in wenigen Worten zu
kennzeichnen, ist nicht leicht; wir begnügen uns zunächst damit, die oft hervor-
gehobenen Unterschiede in Beziehung auf das Streben nach dem Nirvana auf-
zuführen. Das Hinayana kennt nur: i. die „Karriere“ des Schravaka, des Buddha-
schülers, welcher durch das Hören der Predigt zur Erleuchtung gelangt, 2. die
Karriere des Pratyekabuddha, des Einzelbuddha, welcher aus sich heraus, ohne
den Lehren eines Buddha gelauscht zu haben, das Nirvana erreichen kann. In
beiden Fällen erschöpft sich Erfolg und Streben des Religiösen in der Erlangung
der Erlösung für sich selbst und durch sich selbst als einzelnes, seiner eigenen
Kraft überlassenes Wesen. Dagegen begnügt sich der Anhänger des Mahayana
nicht mit seiner eigenen Erlösung, sein "Wunsch geht dahin, allen Lebewesen
an der ihm möglichen überströmenden Seligkeit der Erlösung Anteil zu gewähren,
und sei es auf die Gefahr hin, das volle Nirvana zunächst nicht zu erlangen,
Der Gedanke des Erlösens aus mitleidiger Liebe zu allen Lebewesen steht im
Mittelpunkte des Mahayanaglaubens und hat die Ausbildung der Bodhisattva-
karriere hervorgerufen: In ihr kann jeder durch Buddhaverehrung, Mitleid, Selbst-
verleugnung und den heißen Wunsch danach (bodhitschitta) das Ziel erreichen,
als Bodhisattva, als ein für die Erleuchtung prädestiniertes Wesen, wiedergeboren
zu werden. — Der künstlerischen Darstellung dieser Ideen und ihrer Konsequenzen
mit den sich immer weiter vermehrenden, in den Texten gar in der Anzahl von
Hunderttausenden, ja von Milliarden, erscheinenden Buddhas und Bodhisattvas,
den Paradiesen und Mandalas werden wir sogleich näher treten.
Aus dem Gandharagebiet sind uns die vielen Reihen nebeneinander angeord-
neter Buddhas mit Begleitern in der späteren Stupadekoration bekanntgeworden.
In Alt-Kutscha fanden wir die Gewölbekappen der Höhlen zweiten Stils mit
Berglandschaften bedeckt, welche in sehr defektiver Schreibung Verehrungsszenen
des Buddha enthalten. In diesen tritt fast nur noch die dominierende Gestalt der
unter Bäumen sitzenden Buddhas hervor. Werfen wir nun einen Blick in eine
Höhle (Taf. 2, a) der „Hauptgruppe“ von Qumtura, so sehen wir hier das Ge-
wölbe, bei dem die Entwicklung aus dem älteren Dekorationsschema noch greif-
bar ist, mit Reihen von einfach nebeneinander geordneten Buddhagestalten be-
setzt. Der Zenit enthält wie die Gewölbe der früher betrachteten Höhlen eine
besondere Darstellung, hier scheinen es Rosetten und Blumen zu sein. — Diese
Art der Gewölbedekoration ist in den Höhlen des Gebietes von Turfan sehr
häufig. Taf. 1, b zeigt ein Stück solch einer Buddhareihe, das zwar nicht selbst
aus einem Gewölbe stammt, in diesem aber genaue Entsprechungen gehabt hat.
Unter glockenbehängten, edelsteinbesetzten Schirmen sitzen mit untergeschlagenen
Beinen zwei, bis auf die Handhaltung, ganz gleiche Buddhas. Die aufgemalten
Falten der braunen Gewänder zeigen noch Anklänge an den griechischen Falten-
wurf, in fast allen Regenbogenfarben schimmernde Aureolen umgeben Kopf und
1029
Das Wesen des Mahayana gegenüber dem Hinayana in wenigen Worten zu
kennzeichnen, ist nicht leicht; wir begnügen uns zunächst damit, die oft hervor-
gehobenen Unterschiede in Beziehung auf das Streben nach dem Nirvana auf-
zuführen. Das Hinayana kennt nur: i. die „Karriere“ des Schravaka, des Buddha-
schülers, welcher durch das Hören der Predigt zur Erleuchtung gelangt, 2. die
Karriere des Pratyekabuddha, des Einzelbuddha, welcher aus sich heraus, ohne
den Lehren eines Buddha gelauscht zu haben, das Nirvana erreichen kann. In
beiden Fällen erschöpft sich Erfolg und Streben des Religiösen in der Erlangung
der Erlösung für sich selbst und durch sich selbst als einzelnes, seiner eigenen
Kraft überlassenes Wesen. Dagegen begnügt sich der Anhänger des Mahayana
nicht mit seiner eigenen Erlösung, sein "Wunsch geht dahin, allen Lebewesen
an der ihm möglichen überströmenden Seligkeit der Erlösung Anteil zu gewähren,
und sei es auf die Gefahr hin, das volle Nirvana zunächst nicht zu erlangen,
Der Gedanke des Erlösens aus mitleidiger Liebe zu allen Lebewesen steht im
Mittelpunkte des Mahayanaglaubens und hat die Ausbildung der Bodhisattva-
karriere hervorgerufen: In ihr kann jeder durch Buddhaverehrung, Mitleid, Selbst-
verleugnung und den heißen Wunsch danach (bodhitschitta) das Ziel erreichen,
als Bodhisattva, als ein für die Erleuchtung prädestiniertes Wesen, wiedergeboren
zu werden. — Der künstlerischen Darstellung dieser Ideen und ihrer Konsequenzen
mit den sich immer weiter vermehrenden, in den Texten gar in der Anzahl von
Hunderttausenden, ja von Milliarden, erscheinenden Buddhas und Bodhisattvas,
den Paradiesen und Mandalas werden wir sogleich näher treten.
Aus dem Gandharagebiet sind uns die vielen Reihen nebeneinander angeord-
neter Buddhas mit Begleitern in der späteren Stupadekoration bekanntgeworden.
In Alt-Kutscha fanden wir die Gewölbekappen der Höhlen zweiten Stils mit
Berglandschaften bedeckt, welche in sehr defektiver Schreibung Verehrungsszenen
des Buddha enthalten. In diesen tritt fast nur noch die dominierende Gestalt der
unter Bäumen sitzenden Buddhas hervor. Werfen wir nun einen Blick in eine
Höhle (Taf. 2, a) der „Hauptgruppe“ von Qumtura, so sehen wir hier das Ge-
wölbe, bei dem die Entwicklung aus dem älteren Dekorationsschema noch greif-
bar ist, mit Reihen von einfach nebeneinander geordneten Buddhagestalten be-
setzt. Der Zenit enthält wie die Gewölbe der früher betrachteten Höhlen eine
besondere Darstellung, hier scheinen es Rosetten und Blumen zu sein. — Diese
Art der Gewölbedekoration ist in den Höhlen des Gebietes von Turfan sehr
häufig. Taf. 1, b zeigt ein Stück solch einer Buddhareihe, das zwar nicht selbst
aus einem Gewölbe stammt, in diesem aber genaue Entsprechungen gehabt hat.
Unter glockenbehängten, edelsteinbesetzten Schirmen sitzen mit untergeschlagenen
Beinen zwei, bis auf die Handhaltung, ganz gleiche Buddhas. Die aufgemalten
Falten der braunen Gewänder zeigen noch Anklänge an den griechischen Falten-
wurf, in fast allen Regenbogenfarben schimmernde Aureolen umgeben Kopf und
1029