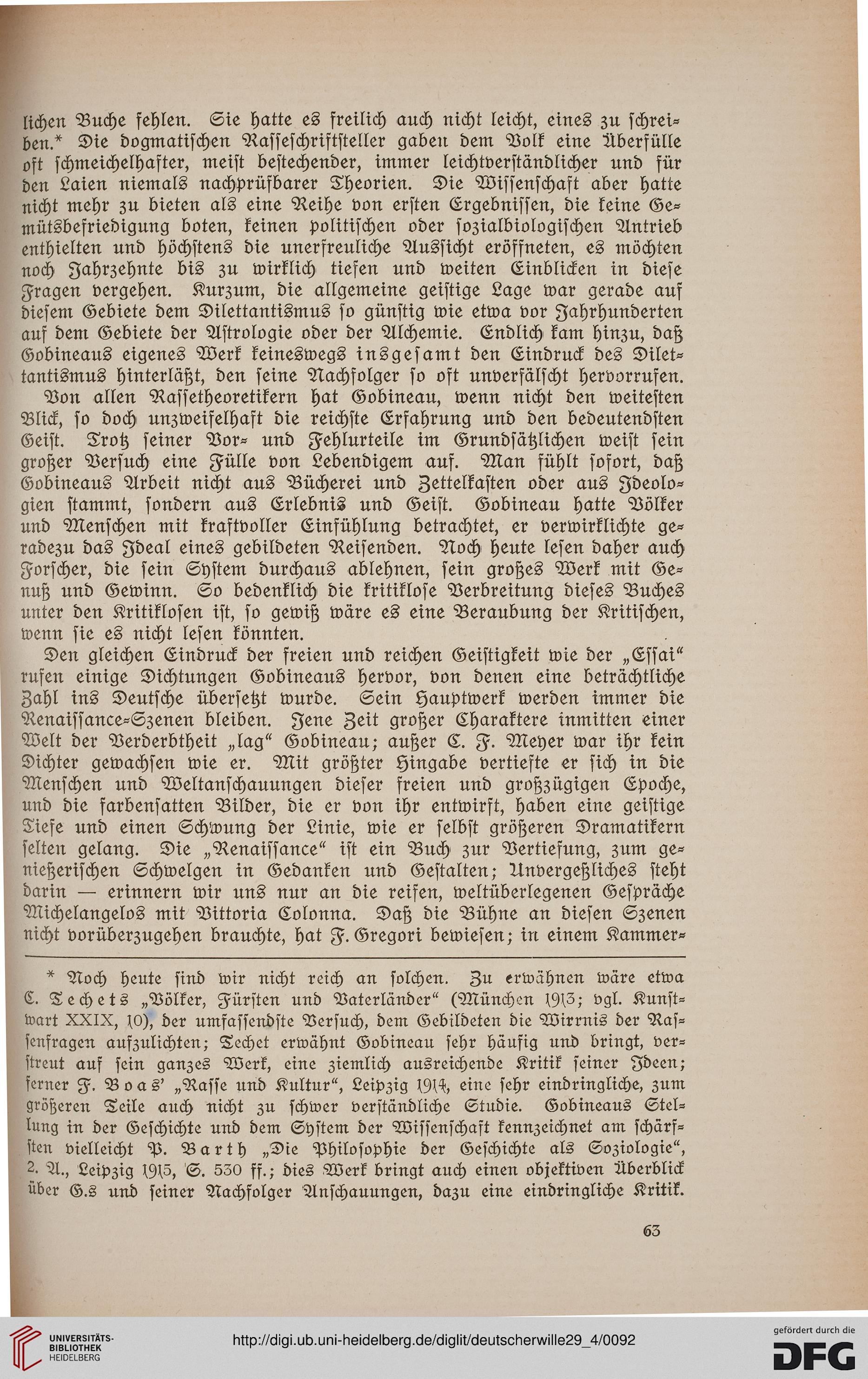lichen Buche fehlen. Sie hatte es freilich auch nicht leicht, eines zu schrei-
ben? Die dogmatischen Rasseschriftsteller gaben dem Volk eine Äberfülle
oft schmeichelhafter, meist bestechender, immer leichtverständlicher und für
den Laien niemals nachprüfbarer Theorien. Die Wissenschast aber hatte
nicht mehr zu bieten als eine Reihe von ersten Ergebnissen, die keine Ge-
mütsbefriedigung boten, keinen politischen oder sozialbiologischen Antrieb
enthielten und Höchstens die unerfreuliche Aussicht eröffneten, es möchten
noch Iahrzehnte bis zu wirklich tiesen und weiten Einblicken in diese
Fragen vergehen. Kurzum, die allgemeine geistige Lage war gerade auf
diesem Gebiete dem Dilettantismus so günstig wie etwa vor Iahrhunderten
auf dem Gebiete der Astrologie oder der Alchemie. Endlich kam hinzu, daß
Gobineaus eigenes Werk keineswegs insgesamt den Eindruck des Dilet-
tantismus hinterläßt, den seine Nachfolger so oft unverfälscht hervorrufen.
Von allen Rassetheoretikern hat Gobineau, wenn nicht den weitesten
Blick, so doch unzweifelhaft die reichste Erfahrung und den bedeutendsten
Geist. Trotz seiner Vor- und Fehlurteile im Grundsätzlichen weist sein
großer Versuch eine Fülle von Lebendigem auf. Man fühlt sofort, daß
Gobineaus Arbeit nicht aus Bücherei und Zettelkasten oder aus Ideolo-
gien stammt, sondern aus Erlebnis und Geist. Gobineau hatte Völker
und Menschen mit kraftvoller Einfühlung betrachtet, er verwirklichte ge-
radezu das Ideal eines gebildeten Reisenden. Noch heute lesen daher auch
Forscher, die sein System durchaus ablehnen, sein großes Werk mit Ge-
nuß und Gewinn. So bedenklich die kritiklose Verbreitung dieses Buches
unter den Kritiklosen ist, so gewiß wäre es eine Beraubung der Kritischen,
wenn sie es nicht lesen könnten.
Den gleichen Eindruck der freien und reichen Geistigkeit wie der „Essai"
rufen einige Dichtungen Gobineaus hervor, von denen eine beträchtliche
Zahl ins Deutsche übersetzt wurde. Sein Hauptwerk werden immer die
Renaissance-Szenen bleiben. Iene Zeit großer Eharaktere inmitten einer
Welt der Verderbtheit „lag" Gobineau; außer C. F. Meyer war ihr kein
Dichter gewachsen wie er. Mit größter tzingabe vertieste er sich in die
Menschen und Weltanschauungen dieser freien und großzügigen Epoche,
und die farbensatten Bilder, die er von ihr entwirft, haben eine geistige
Tiese und einen Schwung der Linie, wie er selbst größeren Dramatikern
selten gelang. Die „Renaissance" ist ein Buch zur Vertiefung, zum ge-
nießerischen Schwelgen in Gedanken und Gestalten; Unvergeßliches steht
darin — erinnern wir uns nur an die reifen, weltüberlegenen Gespräche
Michelangelos mit Vittoria Colonna. Daß die Bühne an diesen Szenen
nicht vorüberzugehen brauchte, hat F. Gregori bewiesen; in einem Kammer-
* Noch heute sind wir nicht reich an solchen. Zu erwähnen wäre etwa
C. Techets „Völker, Fürsten und Vaterländer" (München M3; vgl. Kunst-
wart XXIX, (0), der umfassendste Versuch, dem Gebildeten die Wirrnis der Ras-
senfragen aufzulichten; Techet erwähnt Gobineau sehr häufig und bringt, ver-
streut auf sein ganzes Werk, eine ziemlich ausreichende Kritik seiner Ideen;
ferner F. Boas' „Rasse und Kultur", Leipzig (9^, eine sehr eindringliche, zum
größeren Teile auch nicht zu schwer verständliche Studie. Gobineaus Stel-
lung in der Geschichte und dem System der Wissenschaft kennzeichnet am schärf-
sten vielleicht P. Barth „Die Philosophie der Geschichte als Soziologie",
2. A., Leipzig Gto, S. 530 ff.; dies Werk bringt auch einen objektiven Aberblick
nber G.s und seiner Nachfolger Anschauungen, dazu eine eindringliche Kritik.
63
ben? Die dogmatischen Rasseschriftsteller gaben dem Volk eine Äberfülle
oft schmeichelhafter, meist bestechender, immer leichtverständlicher und für
den Laien niemals nachprüfbarer Theorien. Die Wissenschast aber hatte
nicht mehr zu bieten als eine Reihe von ersten Ergebnissen, die keine Ge-
mütsbefriedigung boten, keinen politischen oder sozialbiologischen Antrieb
enthielten und Höchstens die unerfreuliche Aussicht eröffneten, es möchten
noch Iahrzehnte bis zu wirklich tiesen und weiten Einblicken in diese
Fragen vergehen. Kurzum, die allgemeine geistige Lage war gerade auf
diesem Gebiete dem Dilettantismus so günstig wie etwa vor Iahrhunderten
auf dem Gebiete der Astrologie oder der Alchemie. Endlich kam hinzu, daß
Gobineaus eigenes Werk keineswegs insgesamt den Eindruck des Dilet-
tantismus hinterläßt, den seine Nachfolger so oft unverfälscht hervorrufen.
Von allen Rassetheoretikern hat Gobineau, wenn nicht den weitesten
Blick, so doch unzweifelhaft die reichste Erfahrung und den bedeutendsten
Geist. Trotz seiner Vor- und Fehlurteile im Grundsätzlichen weist sein
großer Versuch eine Fülle von Lebendigem auf. Man fühlt sofort, daß
Gobineaus Arbeit nicht aus Bücherei und Zettelkasten oder aus Ideolo-
gien stammt, sondern aus Erlebnis und Geist. Gobineau hatte Völker
und Menschen mit kraftvoller Einfühlung betrachtet, er verwirklichte ge-
radezu das Ideal eines gebildeten Reisenden. Noch heute lesen daher auch
Forscher, die sein System durchaus ablehnen, sein großes Werk mit Ge-
nuß und Gewinn. So bedenklich die kritiklose Verbreitung dieses Buches
unter den Kritiklosen ist, so gewiß wäre es eine Beraubung der Kritischen,
wenn sie es nicht lesen könnten.
Den gleichen Eindruck der freien und reichen Geistigkeit wie der „Essai"
rufen einige Dichtungen Gobineaus hervor, von denen eine beträchtliche
Zahl ins Deutsche übersetzt wurde. Sein Hauptwerk werden immer die
Renaissance-Szenen bleiben. Iene Zeit großer Eharaktere inmitten einer
Welt der Verderbtheit „lag" Gobineau; außer C. F. Meyer war ihr kein
Dichter gewachsen wie er. Mit größter tzingabe vertieste er sich in die
Menschen und Weltanschauungen dieser freien und großzügigen Epoche,
und die farbensatten Bilder, die er von ihr entwirft, haben eine geistige
Tiese und einen Schwung der Linie, wie er selbst größeren Dramatikern
selten gelang. Die „Renaissance" ist ein Buch zur Vertiefung, zum ge-
nießerischen Schwelgen in Gedanken und Gestalten; Unvergeßliches steht
darin — erinnern wir uns nur an die reifen, weltüberlegenen Gespräche
Michelangelos mit Vittoria Colonna. Daß die Bühne an diesen Szenen
nicht vorüberzugehen brauchte, hat F. Gregori bewiesen; in einem Kammer-
* Noch heute sind wir nicht reich an solchen. Zu erwähnen wäre etwa
C. Techets „Völker, Fürsten und Vaterländer" (München M3; vgl. Kunst-
wart XXIX, (0), der umfassendste Versuch, dem Gebildeten die Wirrnis der Ras-
senfragen aufzulichten; Techet erwähnt Gobineau sehr häufig und bringt, ver-
streut auf sein ganzes Werk, eine ziemlich ausreichende Kritik seiner Ideen;
ferner F. Boas' „Rasse und Kultur", Leipzig (9^, eine sehr eindringliche, zum
größeren Teile auch nicht zu schwer verständliche Studie. Gobineaus Stel-
lung in der Geschichte und dem System der Wissenschaft kennzeichnet am schärf-
sten vielleicht P. Barth „Die Philosophie der Geschichte als Soziologie",
2. A., Leipzig Gto, S. 530 ff.; dies Werk bringt auch einen objektiven Aberblick
nber G.s und seiner Nachfolger Anschauungen, dazu eine eindringliche Kritik.
63