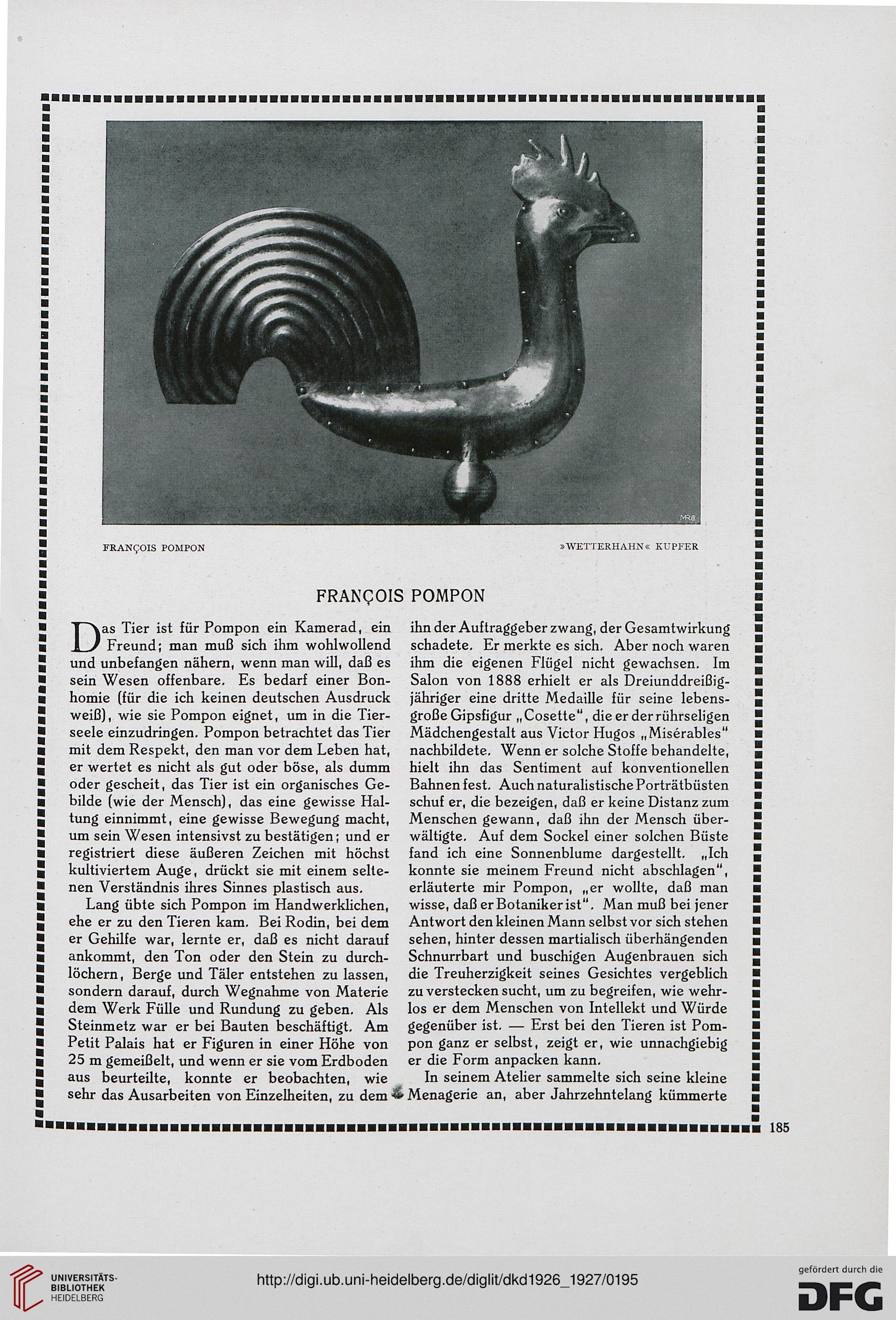FRANCJOIS POMPON
»WETTEKHAHN « KI'PFER
FRANCOI
Das Tier ist für Pompon ein Kamerad, ein
Freund; man muß sich ihm wohlwollend
und unbefangen nähern, wenn man will, daß es
sein Wesen offenbare. Es bedarf einer Bon-
homie (für die ich keinen deutschen Ausdruck
weiß), wie sie Pompon eignet, um in die Tier-
seele einzudringen. Pompon betrachtet das Tier
mit dem Respekt, den man vor dem Leben hat,
er wertet es nicht als gut oder böse, als dumm
oder gescheit, das Tier ist ein organisches Ge-
bilde (wie der Mensch), das eine gewisse Hal-
tung einnimmt, eine gewisse Bewegung macht,
um sein Wesen intensivst zu bestätigen; und er
registriert diese äußeren Zeichen mit höchst
kultiviertem Auge, drückt sie mit einem selte-
nen Verständnis ihres Sinnes plastisch aus.
Lang übte sich Pompon im Handwerklichen,
ehe er zu den Tieren kam. Bei Rodin, bei dem
er Gehilfe war, lernte er, daß es nicht darauf
ankommt, den Ton oder den Stein zu durch-
löchern, Berge und Täler entstehen zu lassen,
sondern darauf, durch Wegnahme von Materie
dem Werk Fülle und Rundung zu geben. Als
Steinmetz war er bei Bauten beschäftigt. Am
Petit Palais hat er Figuren in einer Höhe von
25 m gemeißelt, und wenn er sie vom Erdboden
aus beurteilte, konnte er beobachten, wie
sehr das Ausarbeiten von Einzelheiten, zu dem ■
POMPON
ihn der Auftraggeber zwang, der Gesamtwirkung
schadete. Er merkte es sich. Aber noch waren
ihm die eigenen Flügel nicht gewachsen. Im
Salon von 1888 erhielt er als Dreiunddreißig-
jähriger eine dritte Medaille für seine lebens-
große Gipsfigur „Cosette", die er der rührseligen
Mädchengestalt aus Victor Hugos „Miserables"
nachbildete. Wenn er solche Stoffe behandelte,
hielt ihn das Sentiment auf konventionellen
Bahnen fest. Auch naturalistische Porträtbüsten
schuf er, die bezeigen, daß er keine Distanz zum
Menschen gewann, daß ihn der Mensch über-
wältigte. Auf dem Sockel einer solchen Büste
fand ich eine Sonnenblume dargestellt. „Ich
konnte sie meinem Freund nicht abschlagen",
erläuterte mir Pompon, „er wollte, daß man
wisse, daß er Botaniker ist". Man muß bei jener
Antwort den kleinen Mann selbst vor sich stehen
sehen, hinter dessen martialisch überhängenden
Schnurrbart und buschigen Augenbrauen sich
die Treuherzigkeit seines Gesichtes vergeblich
zu verstecken sucht, um zu begreifen, wie wehr-
los er dem Menschen von Intellekt und Würde
gegenüber ist. — Erst bei den Tieren ist Pom-
pon ganz er selbst, zeigt er, wie unnachgiebig
er die Form anpacken kann.
In seinem Atelier sammelte sich seine kleine
Menagerie an, aber Jahrzehntelang kümmerte
»WETTEKHAHN « KI'PFER
FRANCOI
Das Tier ist für Pompon ein Kamerad, ein
Freund; man muß sich ihm wohlwollend
und unbefangen nähern, wenn man will, daß es
sein Wesen offenbare. Es bedarf einer Bon-
homie (für die ich keinen deutschen Ausdruck
weiß), wie sie Pompon eignet, um in die Tier-
seele einzudringen. Pompon betrachtet das Tier
mit dem Respekt, den man vor dem Leben hat,
er wertet es nicht als gut oder böse, als dumm
oder gescheit, das Tier ist ein organisches Ge-
bilde (wie der Mensch), das eine gewisse Hal-
tung einnimmt, eine gewisse Bewegung macht,
um sein Wesen intensivst zu bestätigen; und er
registriert diese äußeren Zeichen mit höchst
kultiviertem Auge, drückt sie mit einem selte-
nen Verständnis ihres Sinnes plastisch aus.
Lang übte sich Pompon im Handwerklichen,
ehe er zu den Tieren kam. Bei Rodin, bei dem
er Gehilfe war, lernte er, daß es nicht darauf
ankommt, den Ton oder den Stein zu durch-
löchern, Berge und Täler entstehen zu lassen,
sondern darauf, durch Wegnahme von Materie
dem Werk Fülle und Rundung zu geben. Als
Steinmetz war er bei Bauten beschäftigt. Am
Petit Palais hat er Figuren in einer Höhe von
25 m gemeißelt, und wenn er sie vom Erdboden
aus beurteilte, konnte er beobachten, wie
sehr das Ausarbeiten von Einzelheiten, zu dem ■
POMPON
ihn der Auftraggeber zwang, der Gesamtwirkung
schadete. Er merkte es sich. Aber noch waren
ihm die eigenen Flügel nicht gewachsen. Im
Salon von 1888 erhielt er als Dreiunddreißig-
jähriger eine dritte Medaille für seine lebens-
große Gipsfigur „Cosette", die er der rührseligen
Mädchengestalt aus Victor Hugos „Miserables"
nachbildete. Wenn er solche Stoffe behandelte,
hielt ihn das Sentiment auf konventionellen
Bahnen fest. Auch naturalistische Porträtbüsten
schuf er, die bezeigen, daß er keine Distanz zum
Menschen gewann, daß ihn der Mensch über-
wältigte. Auf dem Sockel einer solchen Büste
fand ich eine Sonnenblume dargestellt. „Ich
konnte sie meinem Freund nicht abschlagen",
erläuterte mir Pompon, „er wollte, daß man
wisse, daß er Botaniker ist". Man muß bei jener
Antwort den kleinen Mann selbst vor sich stehen
sehen, hinter dessen martialisch überhängenden
Schnurrbart und buschigen Augenbrauen sich
die Treuherzigkeit seines Gesichtes vergeblich
zu verstecken sucht, um zu begreifen, wie wehr-
los er dem Menschen von Intellekt und Würde
gegenüber ist. — Erst bei den Tieren ist Pom-
pon ganz er selbst, zeigt er, wie unnachgiebig
er die Form anpacken kann.
In seinem Atelier sammelte sich seine kleine
Menagerie an, aber Jahrzehntelang kümmerte