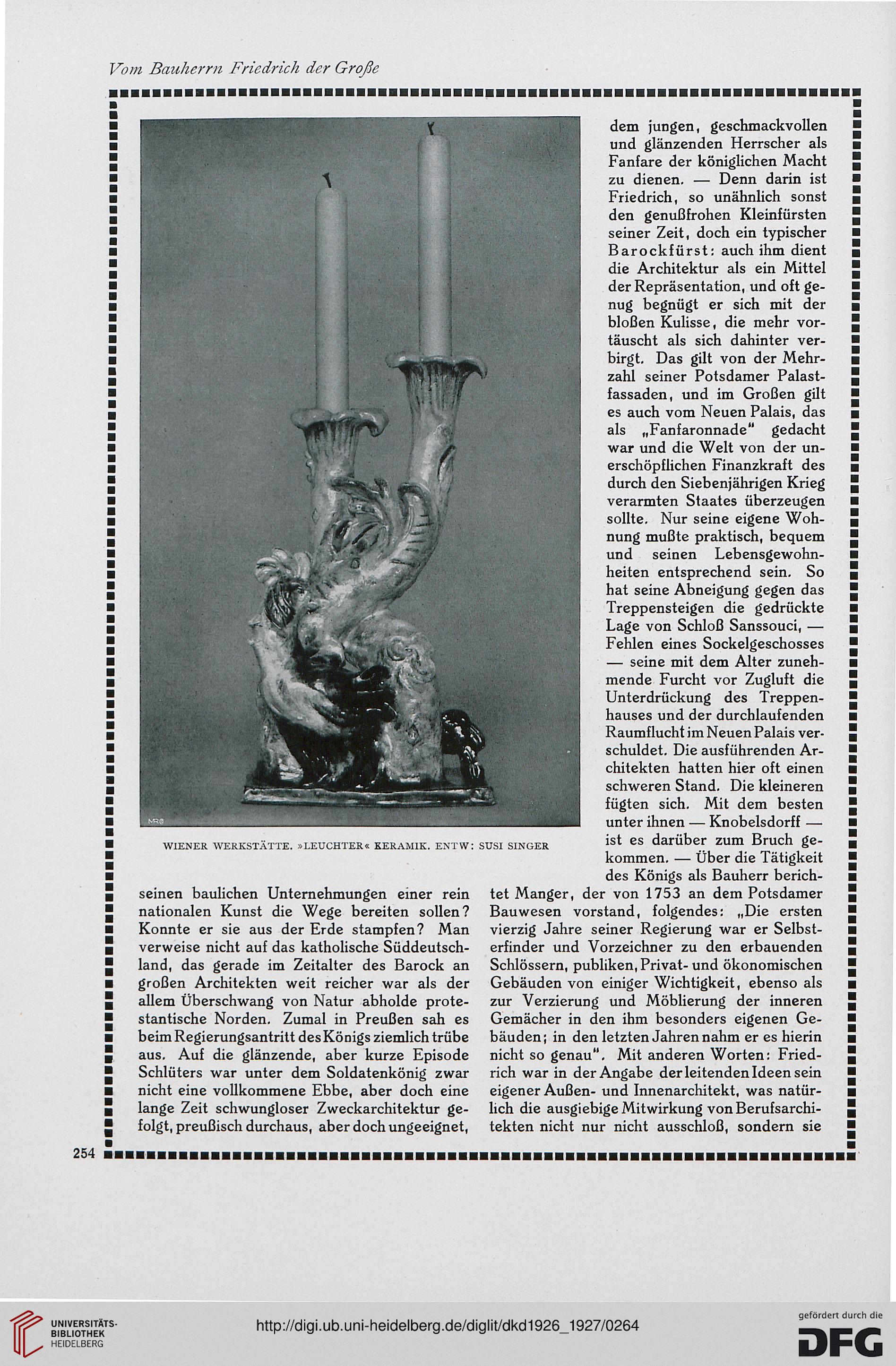Vom Bauherrn Friedrich der Große
WIENER WERKSTATTE. »LEUCHTER« KERAMIK. EXTW: SUSI SINGER
seinen baulichen Unternehmungen einer rein
nationalen Kunst die Wege bereiten sollen?
Konnte er sie aus der Erde stampfen? Man
verweise nicht auf das katholische Süddeutsch-
land, das gerade im Zeitalter des Barock an
großen Architekten weit reicher war als der
allem Überschwang von Natur abholde prote-
stantische Norden. Zumal in Preußen sah es
beim Regierungsantritt des Königs ziemlich trübe
aus. Auf die glänzende, aber kurze Episode
Schlüters war unter dem Soldatenkönig zwar
nicht eine vollkommene Ebbe, aber doch eine
lange Zeit schwungloser Zweckarchitektur ge-
folgt, preußisch durchaus, aber doch ungeeignet,
dem jungen, geschmackvollen
und glänzenden Herrscher als
Fanfare der königlichen Macht
zu dienen. —• Denn darin ist
Friedrich, so unähnlich sonst
den genußfrohen Kleinfürsten
seiner Zeit, doch ein typischer
Barockfürst: auch ihm dient
die Architektur als ein Mittel
der Repräsentation, und oft ge-
nug begnügt er sich mit der
bloßen Kulisse, die mehr vor-
täuscht als sich dahinter ver-
birgt. Das gilt von der Mehr-
zahl seiner Potsdamer Palast-
fassaden, und im Großen gilt
es auch vom Neuen Palais, das
als „Fanfaronnade" gedacht
war und die Welt von der un-
erschöpflichen Finanzkraft des
durch den Siebenjährigen Krieg
verarmten Staates überzeugen
sollte. Nur seine eigene Woh-
nung mußte praktisch, bequem
und seinen Lebensgewohn-
heiten entsprechend sein. So
hat seine Abneigung gegen das
Treppensteigen die gedrückte
Lage von Schloß Sanssouci, —
Fehlen eines Sockelgeschosses
— seine mit dem Alter zuneh-
mende Furcht vor Zugluft die
Unterdrückung des Treppen-
hauses und der durchlaufenden
Raumflucht im Neuen Palais ver-
schuldet. Die ausführenden Ar-
chitekten hatten hier oft einen
schweren Stand. Die kleineren
fügten sich. Mit dem besten
unter ihnen — Knobeisdorff —
ist es darüber zum Bruch ge-
kommen. — Über die Tätigkeit
des Königs als Bauherr berich-
tet Manger, der von 1753 an dem Potsdamer
Bauwesen vorstand, folgendes: „Die ersten
vierzig Jahre seiner Regierung war er Selbst-
erfinder und Vorzeichner zu den erbauenden
Schlössern, publiken, Privat- und ökonomischen
Gebäuden von einiger Wichtigkeit, ebenso als
zur Verzierung und Möblierung der inneren
Gemächer in den ihm besonders eigenen Ge-
bäuden; in den letzten Jahren nahm er es hierin
nicht so genau". Mit anderen Worten: Fried-
rich war in der Angabe der leitenden Ideen sein
eigener Außen- und Innenarchitekt, was natür-
lich die ausgiebige Mitwirkung von Berufsarchi-
tekten nicht nur nicht ausschloß, sondern sie
254
WIENER WERKSTATTE. »LEUCHTER« KERAMIK. EXTW: SUSI SINGER
seinen baulichen Unternehmungen einer rein
nationalen Kunst die Wege bereiten sollen?
Konnte er sie aus der Erde stampfen? Man
verweise nicht auf das katholische Süddeutsch-
land, das gerade im Zeitalter des Barock an
großen Architekten weit reicher war als der
allem Überschwang von Natur abholde prote-
stantische Norden. Zumal in Preußen sah es
beim Regierungsantritt des Königs ziemlich trübe
aus. Auf die glänzende, aber kurze Episode
Schlüters war unter dem Soldatenkönig zwar
nicht eine vollkommene Ebbe, aber doch eine
lange Zeit schwungloser Zweckarchitektur ge-
folgt, preußisch durchaus, aber doch ungeeignet,
dem jungen, geschmackvollen
und glänzenden Herrscher als
Fanfare der königlichen Macht
zu dienen. —• Denn darin ist
Friedrich, so unähnlich sonst
den genußfrohen Kleinfürsten
seiner Zeit, doch ein typischer
Barockfürst: auch ihm dient
die Architektur als ein Mittel
der Repräsentation, und oft ge-
nug begnügt er sich mit der
bloßen Kulisse, die mehr vor-
täuscht als sich dahinter ver-
birgt. Das gilt von der Mehr-
zahl seiner Potsdamer Palast-
fassaden, und im Großen gilt
es auch vom Neuen Palais, das
als „Fanfaronnade" gedacht
war und die Welt von der un-
erschöpflichen Finanzkraft des
durch den Siebenjährigen Krieg
verarmten Staates überzeugen
sollte. Nur seine eigene Woh-
nung mußte praktisch, bequem
und seinen Lebensgewohn-
heiten entsprechend sein. So
hat seine Abneigung gegen das
Treppensteigen die gedrückte
Lage von Schloß Sanssouci, —
Fehlen eines Sockelgeschosses
— seine mit dem Alter zuneh-
mende Furcht vor Zugluft die
Unterdrückung des Treppen-
hauses und der durchlaufenden
Raumflucht im Neuen Palais ver-
schuldet. Die ausführenden Ar-
chitekten hatten hier oft einen
schweren Stand. Die kleineren
fügten sich. Mit dem besten
unter ihnen — Knobeisdorff —
ist es darüber zum Bruch ge-
kommen. — Über die Tätigkeit
des Königs als Bauherr berich-
tet Manger, der von 1753 an dem Potsdamer
Bauwesen vorstand, folgendes: „Die ersten
vierzig Jahre seiner Regierung war er Selbst-
erfinder und Vorzeichner zu den erbauenden
Schlössern, publiken, Privat- und ökonomischen
Gebäuden von einiger Wichtigkeit, ebenso als
zur Verzierung und Möblierung der inneren
Gemächer in den ihm besonders eigenen Ge-
bäuden; in den letzten Jahren nahm er es hierin
nicht so genau". Mit anderen Worten: Fried-
rich war in der Angabe der leitenden Ideen sein
eigener Außen- und Innenarchitekt, was natür-
lich die ausgiebige Mitwirkung von Berufsarchi-
tekten nicht nur nicht ausschloß, sondern sie
254