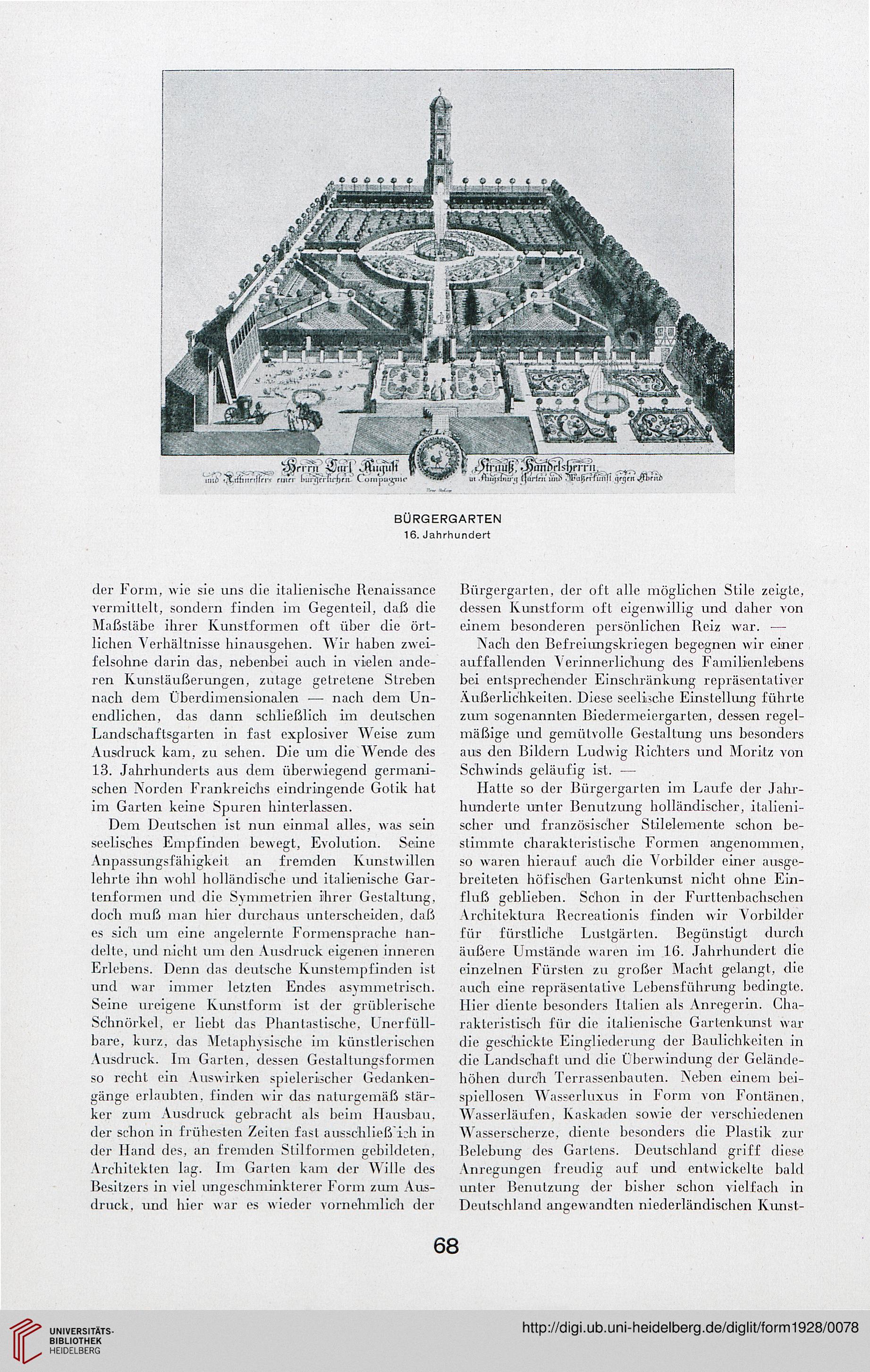1
der Form, wie sie uns die italienische Renaissance
vermittelt, sondern finden im Gegenteil, daß die
Maßstäbe ihrer Kunstformen oft über die ört-
lichen Verhältnisse hinausgehen. Wir haben zwei-
felsohne darin das, nebenbei auch in vielen ande-
ren Kunstäußerungen, zutage getretene Streben
nach dem Überdimensionalen — nach dem Un-
endlichen, das dann schließlich im deutschen
Landschaftsgarten in fast explosiver Weise zum
Ausdruck kam, zu sehen. Die um die Wende des
13. Jahrhunderts aus dem überwiegend germani-
schen Norden Frankreichs eindringende Gotik hat
im Garten keine Spuren hinterlassen.
Dem Deutschen ist nun einmal alles, was sein
seelisches Empfinden bewegt, Evolution. Seine
Anpassungsfähigkeil an fremden Kunstwillen
lehrte ihn wohl holländische und italienische Gar-
tenformen und die Symmetrien ihrer Gestaltung,
doch muß man hier durchaus unterscheiden, daß
es sich um eine angelernte Formensprache han-
delte, und nicht um den Ausdruck eigenen inneren
Erlebens. Denn das deutsche Kunstempfinden ist
und war immer letzten Endes asymmetrisch.
Seine ureigene Kunstform ist der grüblerische
Schnörkel, er liebt das Phantastische, Unerfüll-
bare, kurz, das Metaphysische im künstlerischen
Ausdruck. Im Garten, dessen Gestaltungsformen
so recht ein Auswirken spielerischer Gedanken-
gänge erlaubten, finden wir das naturgemäß stär-
ker zum Ausdruck gebracht als beim Hausbau,
der schon in frühesten Zeiten fast ausschließ'ich in
der Hand des, an fremden Slilformen gebildeten,
Architekten lag. Im Garten kam der Wille des
Besitzers in viel ungeschminkterer Form zum Aus-
druck, und liier war es wieder vornehmlich der
Bürgergarien, der oft alle möglichen Stile zeigte,
dessen Kunstform oft eigenwillig und daher von
einem besonderen persönlichen Reiz war. —
Nach den Befreiungskriegen begegnen wir einer
auffallenden \erinnerlichung des Familienlebens
bei entsprechender Einschränkung repräsentativer
Äußerlichkeiten. Diese seelische Einstellung führte
zum sogenannten Biedermeiergarlen, dessen regel-
mäßige und gemütvolle Gestallung uns besonders
aus den Bildern Ludwig Richters und Moritz von
Schwinds geläufig ist. —
Hatte so der Bürgergarten im Laufe der Jahr-
hunderte unter Benutzung holländischer, italieni-
scher und französischer Stilelemente schon be-
stimmte charakteristische Formen angenommen,
so waren hierauf auch die Vorbilder einer ausge-
breiteten höfischen Gartenkunst nicht ohne Ein-
fluß geblieben. Schon in der Furtlenbachschen
Architektura Becreationis finden wir Vorbilder
für fürstliche Lustgärten. Begünstigt durch
äußere Umstände waren im 16. Jahrhundert die
einzelnen Fürsten zu großer Macht gelangt, die
auch eine repräsentative Lebensführung bedingte.
Iiier diente besonders Italien als Anregerin. Cha-
rakteristisch für die italienische Gartenkunst war
die geschickte Eingliederung der Baulichkeiten in
die Landschaft und die Überwindung der Gelände-
höhen durch Terrassenbaulen. Neben einem bei-
spiellosen Wasserluxus in Form von Fontänen.
Wasserläufen, Kaskaden sowie der verschiedenen
Wasserscherze, diente besonders die Plastik zur
Belebung des Gartens. Deutschland grill' diese
Anregungen freudig auf und entwickelte bald
unter Benutzung der bisher schon vielfach in
Deutschland angewandten niederländischen Kunst-
68
der Form, wie sie uns die italienische Renaissance
vermittelt, sondern finden im Gegenteil, daß die
Maßstäbe ihrer Kunstformen oft über die ört-
lichen Verhältnisse hinausgehen. Wir haben zwei-
felsohne darin das, nebenbei auch in vielen ande-
ren Kunstäußerungen, zutage getretene Streben
nach dem Überdimensionalen — nach dem Un-
endlichen, das dann schließlich im deutschen
Landschaftsgarten in fast explosiver Weise zum
Ausdruck kam, zu sehen. Die um die Wende des
13. Jahrhunderts aus dem überwiegend germani-
schen Norden Frankreichs eindringende Gotik hat
im Garten keine Spuren hinterlassen.
Dem Deutschen ist nun einmal alles, was sein
seelisches Empfinden bewegt, Evolution. Seine
Anpassungsfähigkeil an fremden Kunstwillen
lehrte ihn wohl holländische und italienische Gar-
tenformen und die Symmetrien ihrer Gestaltung,
doch muß man hier durchaus unterscheiden, daß
es sich um eine angelernte Formensprache han-
delte, und nicht um den Ausdruck eigenen inneren
Erlebens. Denn das deutsche Kunstempfinden ist
und war immer letzten Endes asymmetrisch.
Seine ureigene Kunstform ist der grüblerische
Schnörkel, er liebt das Phantastische, Unerfüll-
bare, kurz, das Metaphysische im künstlerischen
Ausdruck. Im Garten, dessen Gestaltungsformen
so recht ein Auswirken spielerischer Gedanken-
gänge erlaubten, finden wir das naturgemäß stär-
ker zum Ausdruck gebracht als beim Hausbau,
der schon in frühesten Zeiten fast ausschließ'ich in
der Hand des, an fremden Slilformen gebildeten,
Architekten lag. Im Garten kam der Wille des
Besitzers in viel ungeschminkterer Form zum Aus-
druck, und liier war es wieder vornehmlich der
Bürgergarien, der oft alle möglichen Stile zeigte,
dessen Kunstform oft eigenwillig und daher von
einem besonderen persönlichen Reiz war. —
Nach den Befreiungskriegen begegnen wir einer
auffallenden \erinnerlichung des Familienlebens
bei entsprechender Einschränkung repräsentativer
Äußerlichkeiten. Diese seelische Einstellung führte
zum sogenannten Biedermeiergarlen, dessen regel-
mäßige und gemütvolle Gestallung uns besonders
aus den Bildern Ludwig Richters und Moritz von
Schwinds geläufig ist. —
Hatte so der Bürgergarten im Laufe der Jahr-
hunderte unter Benutzung holländischer, italieni-
scher und französischer Stilelemente schon be-
stimmte charakteristische Formen angenommen,
so waren hierauf auch die Vorbilder einer ausge-
breiteten höfischen Gartenkunst nicht ohne Ein-
fluß geblieben. Schon in der Furtlenbachschen
Architektura Becreationis finden wir Vorbilder
für fürstliche Lustgärten. Begünstigt durch
äußere Umstände waren im 16. Jahrhundert die
einzelnen Fürsten zu großer Macht gelangt, die
auch eine repräsentative Lebensführung bedingte.
Iiier diente besonders Italien als Anregerin. Cha-
rakteristisch für die italienische Gartenkunst war
die geschickte Eingliederung der Baulichkeiten in
die Landschaft und die Überwindung der Gelände-
höhen durch Terrassenbaulen. Neben einem bei-
spiellosen Wasserluxus in Form von Fontänen.
Wasserläufen, Kaskaden sowie der verschiedenen
Wasserscherze, diente besonders die Plastik zur
Belebung des Gartens. Deutschland grill' diese
Anregungen freudig auf und entwickelte bald
unter Benutzung der bisher schon vielfach in
Deutschland angewandten niederländischen Kunst-
68