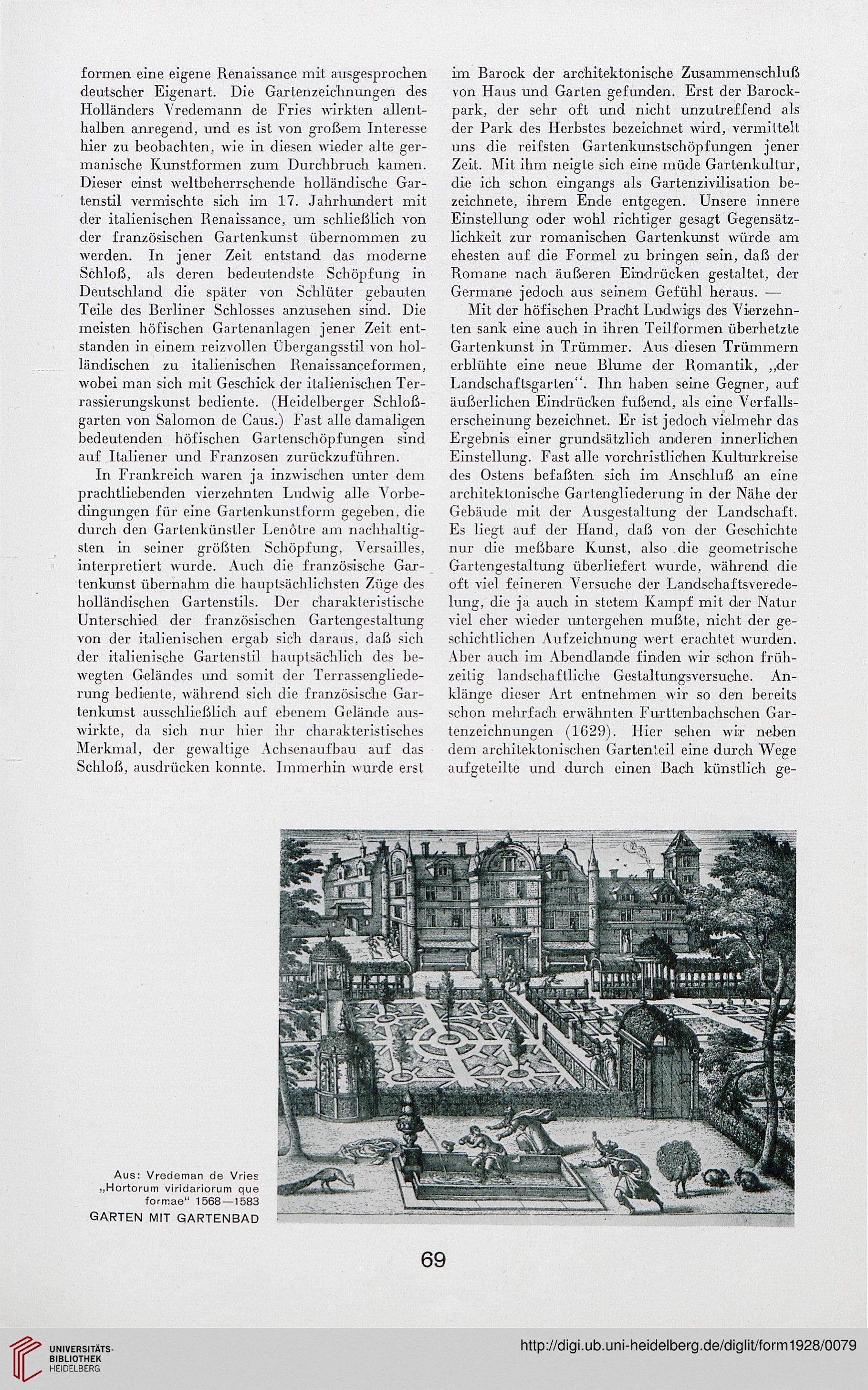formen eine eigene Renaissance mit ausgesprochen
deutscher Eigenart. Die Gartenzeichnungen des
Holländers Vredemann de Fries wirkten allent-
halben anregend, und es ist von großem Interesse
hier zu beobachten, wie in diesen wieder alte ger-
manische Kunstformen zum Durchbruch kamen.
Dieser einst weltbeherrschende holländische Gar-
tenstil vermischte sich im 17. Jahrhundert mit
der italienischen Renaissance, um schließlich von
der französischen Gartenkunst übernommen zu
werden. In jener Zeit entstand das moderne
Schloß, als deren bedeutendste Schöpfung in
Deutschland die später von Schlüter gebauten
Teile des Rerliner Schlosses anzusehen sind. Die
meisten höfischen Gartenanlagen jener Zeit ent-
standen in einem reizvollen Übergangsstil von hol-
ländischen zu italienischen Renaissanceformen,
wobei man sich mit Geschick der italienischen Ter-
rassierungskunst bediente. (Heidelberger Schloß-
garten von Salomon de Caus.) Fast alle damaligen
bedeutenden höfischen Gartenschöpfungen sind
auf Italiener und Franzosen zurückzuführen.
In Frankreich waren ja inzwischen unter dem
prachtliebenden vierzehnten Ludwig alle Vorbe-
dingungen für eine Gartenkunstform gegeben, die
durch den Gartenkünsller Lenötre am nachhaltig-
sten in seiner größten Schöpfung, Versailles,
interpretiert wurde. Auch die französische Gar-
tenkunst übernahm die hauptsächlichsten Züge des
holländischen Gartenstils. Der charakteristische
Unterschied der französischen Gartengestaltung
von der italienischen ergab sich daraus, daß sich
der italienische Gartenstil hauptsächlich des be-
wegten Geländes und somit der Terrassengliede-
rung bediente, während sich die französische Gar-
tenkunst ausschließlich auf ebenem Gelände aus-
wirkte, da sich nur hier ihr charakteristisches
Merkmal, der gewaltige Achsenaufbau auf das
Schloß, ausdrücken konnte. Immerhin wurde erst
im Barock der architektonische Zusammenschluß
von Haus und Garten gefunden. Erst der Barock-
park, der sehr oft und nicht unzutreffend als
der Park des Herbstes bezeichnet wird, vermittelt
uns die reifsten Gartenkunstschöpfungen jener
Zeit. Mit ihm neigte sich eine müde Gartenkullur,
die ich schon eingangs als Gartenzivilisation be-
zeichnete, ihrem Ende entgegen. Unsere innere
Einstellung oder wohl richtiger gesagt Gegensätz-
lichkeit zur romanischen Gartenkunst würde am
ehesten auf die Formel zu bringen sein, daß der
Romane nach äußeren Eindrücken gestaltet, der
Germane jedoch aus seinem Gefühl heraus. —
Mit der höfischen Pracht Ludwigs des Vierzehn-
ten sank eine auch in ihren Teilformen überhetzte
Gartenkunst in Trümmer. Aus diesen Trümmern
erblühte eine neue Blume der Romantik, „der
Landschaftsgarten". Ihn haben seine Gegner, auf
äußerlichen Eindrücken fußend, als eine Verfalls-
erscheinung bezeichnet. Er ist jedoch vielmehr das
Ergebnis einer grundsätzlich anderen innerliehen
Einstellung. Fast alle vorchristlichen Kulturkreise
des Ostens befaßten sich im Anschluß an eine
architektonische Gartengliederung in der Nähe der
Gebäude mit der Ausgestaltung der Landschaft.
Es liegt auf der Hand, daß von der Geschichte
nur die meßbare Kunst, also .die geometrische
Gartengestaltung überliefert wurde, während die
oft viel feineren Versuche der Landschaftsverede-
lung, die ja auch in stetem Kampf mit der Natur
viel eher wieder untergehen mußte, nicht der ge-
schichtlichen Aufzeichnung wert erachtet wurden.
Aber auch im Abendlande finden wir schon früh-
zeilig landschaftliche Gestaltungsversuche. An-
klänge dieser Art entnehmen wir so den bereits
schon mehrfach erwähnten Furtlenbachschen Gar-
tenzeichnungen (1629). Hier sehen wir neben
dem architektonischen Gartenleil eine durch Wege
aufgeteilte und durch einen Bach künstlich ge-
frir
Aus: Vredeman de Wies
„Hortorum viridariorum que
formae" 1568 — 1583
GARTEN MIT GARTENBAD
69
deutscher Eigenart. Die Gartenzeichnungen des
Holländers Vredemann de Fries wirkten allent-
halben anregend, und es ist von großem Interesse
hier zu beobachten, wie in diesen wieder alte ger-
manische Kunstformen zum Durchbruch kamen.
Dieser einst weltbeherrschende holländische Gar-
tenstil vermischte sich im 17. Jahrhundert mit
der italienischen Renaissance, um schließlich von
der französischen Gartenkunst übernommen zu
werden. In jener Zeit entstand das moderne
Schloß, als deren bedeutendste Schöpfung in
Deutschland die später von Schlüter gebauten
Teile des Rerliner Schlosses anzusehen sind. Die
meisten höfischen Gartenanlagen jener Zeit ent-
standen in einem reizvollen Übergangsstil von hol-
ländischen zu italienischen Renaissanceformen,
wobei man sich mit Geschick der italienischen Ter-
rassierungskunst bediente. (Heidelberger Schloß-
garten von Salomon de Caus.) Fast alle damaligen
bedeutenden höfischen Gartenschöpfungen sind
auf Italiener und Franzosen zurückzuführen.
In Frankreich waren ja inzwischen unter dem
prachtliebenden vierzehnten Ludwig alle Vorbe-
dingungen für eine Gartenkunstform gegeben, die
durch den Gartenkünsller Lenötre am nachhaltig-
sten in seiner größten Schöpfung, Versailles,
interpretiert wurde. Auch die französische Gar-
tenkunst übernahm die hauptsächlichsten Züge des
holländischen Gartenstils. Der charakteristische
Unterschied der französischen Gartengestaltung
von der italienischen ergab sich daraus, daß sich
der italienische Gartenstil hauptsächlich des be-
wegten Geländes und somit der Terrassengliede-
rung bediente, während sich die französische Gar-
tenkunst ausschließlich auf ebenem Gelände aus-
wirkte, da sich nur hier ihr charakteristisches
Merkmal, der gewaltige Achsenaufbau auf das
Schloß, ausdrücken konnte. Immerhin wurde erst
im Barock der architektonische Zusammenschluß
von Haus und Garten gefunden. Erst der Barock-
park, der sehr oft und nicht unzutreffend als
der Park des Herbstes bezeichnet wird, vermittelt
uns die reifsten Gartenkunstschöpfungen jener
Zeit. Mit ihm neigte sich eine müde Gartenkullur,
die ich schon eingangs als Gartenzivilisation be-
zeichnete, ihrem Ende entgegen. Unsere innere
Einstellung oder wohl richtiger gesagt Gegensätz-
lichkeit zur romanischen Gartenkunst würde am
ehesten auf die Formel zu bringen sein, daß der
Romane nach äußeren Eindrücken gestaltet, der
Germane jedoch aus seinem Gefühl heraus. —
Mit der höfischen Pracht Ludwigs des Vierzehn-
ten sank eine auch in ihren Teilformen überhetzte
Gartenkunst in Trümmer. Aus diesen Trümmern
erblühte eine neue Blume der Romantik, „der
Landschaftsgarten". Ihn haben seine Gegner, auf
äußerlichen Eindrücken fußend, als eine Verfalls-
erscheinung bezeichnet. Er ist jedoch vielmehr das
Ergebnis einer grundsätzlich anderen innerliehen
Einstellung. Fast alle vorchristlichen Kulturkreise
des Ostens befaßten sich im Anschluß an eine
architektonische Gartengliederung in der Nähe der
Gebäude mit der Ausgestaltung der Landschaft.
Es liegt auf der Hand, daß von der Geschichte
nur die meßbare Kunst, also .die geometrische
Gartengestaltung überliefert wurde, während die
oft viel feineren Versuche der Landschaftsverede-
lung, die ja auch in stetem Kampf mit der Natur
viel eher wieder untergehen mußte, nicht der ge-
schichtlichen Aufzeichnung wert erachtet wurden.
Aber auch im Abendlande finden wir schon früh-
zeilig landschaftliche Gestaltungsversuche. An-
klänge dieser Art entnehmen wir so den bereits
schon mehrfach erwähnten Furtlenbachschen Gar-
tenzeichnungen (1629). Hier sehen wir neben
dem architektonischen Gartenleil eine durch Wege
aufgeteilte und durch einen Bach künstlich ge-
frir
Aus: Vredeman de Wies
„Hortorum viridariorum que
formae" 1568 — 1583
GARTEN MIT GARTENBAD
69