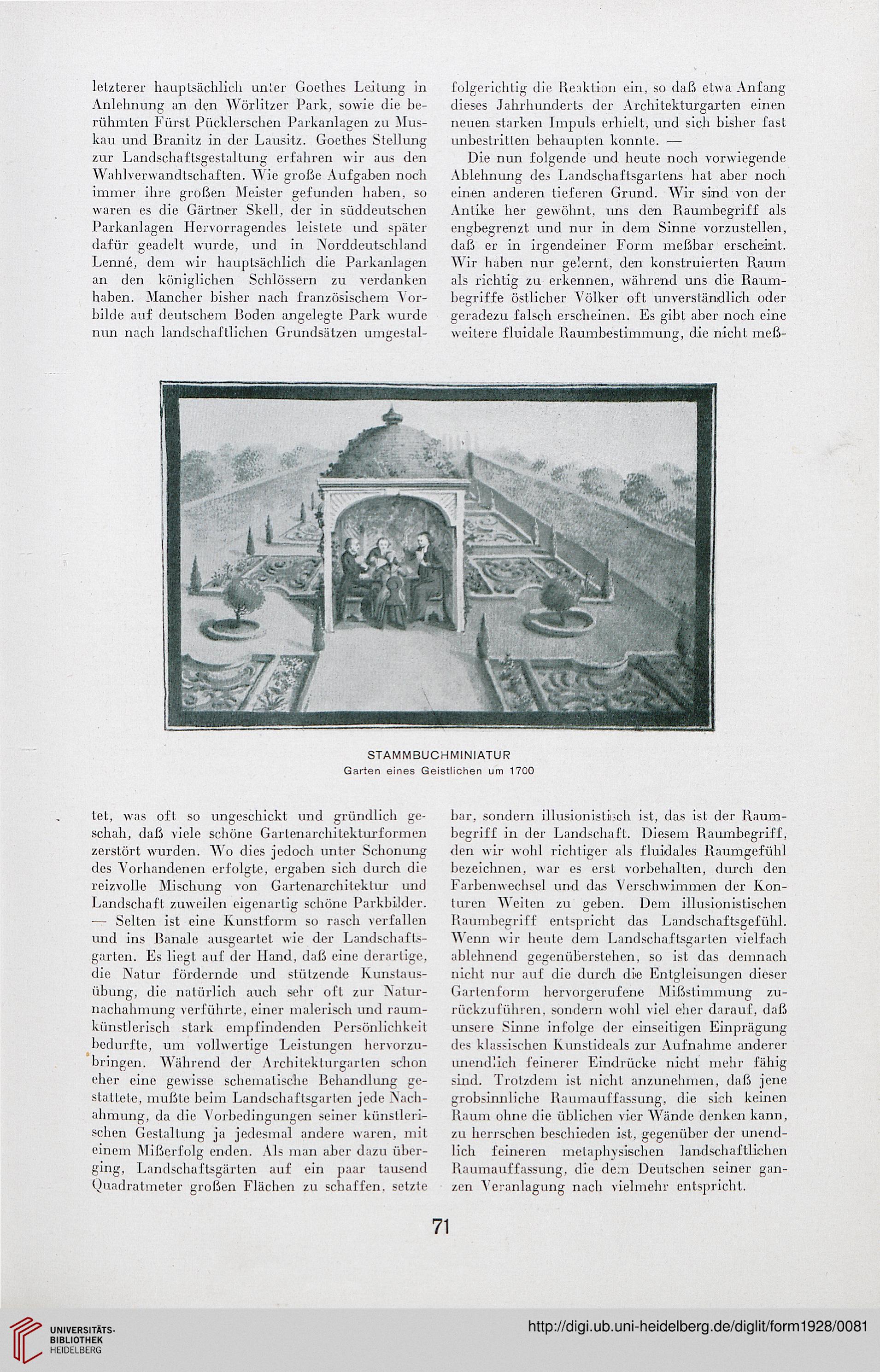letzterer hauptsächlich unler Goethes Leitung in
Anlehnung an den Wörlitzer Park, sowie die be-
rühmten Fürst Pücklerschen Parkanlagen zu Mus-
kau und Branitz in der Lausitz. Goethes Stellung
zur Landschaftsgestaltung erfahren wir aus den
Wahlverwandtschaften. Wie große Aufgaben nocii
immer ihre großen Meister gefunden haben, so
waren es die Gärtner Skell, der in süddeutschen
Parkanlagen Hervorragendes leistete und später
dafür geadelt wurde, und in Norddeutschland
Lenne, dem wir hauptsächlich die Parkanlagen
an den königlichen Schlössern zu verdanken
haben. Mancher bisher nach französischem A or-
bilde auf deutschem Boden angelegte Park wurde
nun nach landschaftlichen Grundsätzen umgestal-
folgerichlig die Reaktion ein, so daß etwa Anfang
dieses Jahrhunderts der Architekturgarten einen
neuen starken Impuls erhielt, und sich bisher fast
unbestritten behaupten konnte. —
Die nun folgende und heute noch vorwiegende
Ablehnung des Landschaftsgartens hat aber noch
einen anderen tieferen Grund. Wir sind von der
Antike her gewöhnt, uns den Raumbegriff als
ensbesrenzt und nur in dem Sinne vorzustellen,
DO '
daß er in irgendeiner Form meßbar erscheint.
Wir haben nur gelernt, den konstruierten Raum
als richtig zu erkennen, während uns die Raum-
begriffe östlicher Völker oft unverständlich oder
geradezu falsch erscheinen. Es gibt aber noch eine
weitere fluidale Raumbeslimmung, die nicht meß-
tet, was oft so ungeschickt und gründlich ge-
schah, daß viele schöne Gartenarchitekturformen
zerstört wurden. Wo dies jedoch unter Schonung
des Vorhandenen erfolgte, ergaben sich durch die
reizvolle Mischung von Gartenarchitektur und
Landschaft zuweilen eigenartig schöne Parkbilder.
— Sellen ist eine Kunstform so rasch verfallen
und ins Banale ausgeartet wie der Landschafts-
garten. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige,
die Natur fördernde und stützende Kunstaus-
übung, die natürlich auch sehr oft zur Natur-
nachahmung verführte, einer malerisch und raum-
künstlerisch stark empfindenden Persönlichkeit
bedurfte, um vollwertige Leistungen hervorzu-
bringen. Während der Archilekturgarlen schon
eher eine gewisse schemalische Behandlung ge-
staltete, mußte beim Landschaftsgarten jede Nach-
ahmung, da die Vorbedingungen seiner künstleri-
schen Gestallung ja jedesmal andere waren, mit
einem Mißerfolg enden. Als man aber dazu über-
ging, Landschaftsgärteh auf ein paar tausend
Quadratmeter großen Flächen zu schaffen, setzte
bar, sondern illusionistisch ist, das ist der Raum-
begriff in der Landschaft. Diesem Raumbegriff,
den wir wohl richtiger als fluidales Raumgefühl
bezeichnen, war es erst vorbehalten, durch den
Farbenwechsel und das Verschwimmen der Kon-
turen Weiten zu geben. Dem illusionistischen
Raumbegriff entspricht das Landschaftsgefühl.
Wenn wir beute dem Landschaf Isgarten vielfach
ablehnend gegenüberstehen, so ist das demnach
nicht nur auf die durch die Entgleisungen dieser
Garlenform hervorgerufene Mißstimmung zu-
rückzuführen, sondern wohl viel eher darauf, daß
unsere Sinne infolge der einseitigen Einprägung
des klassischen Kunslideals zur Aufnahme anderer
unendlich feinerer Eindrücke nicht mehr fähig
sind. Trotzdem ist nicht anzunehmen, daß jene
grobsinnliche Raumauffassung, die sich keinen
Raum ohne die üblichen vier Wände denken kann,
zu herrschen beschieden ist, gegenüber der unend-
lich feineren metaphysischen landschaftlichen
Raumauffassung, die dem Deutschen seiner gan-
zen Veranlagung nach vielmehr entspricht.
71
Anlehnung an den Wörlitzer Park, sowie die be-
rühmten Fürst Pücklerschen Parkanlagen zu Mus-
kau und Branitz in der Lausitz. Goethes Stellung
zur Landschaftsgestaltung erfahren wir aus den
Wahlverwandtschaften. Wie große Aufgaben nocii
immer ihre großen Meister gefunden haben, so
waren es die Gärtner Skell, der in süddeutschen
Parkanlagen Hervorragendes leistete und später
dafür geadelt wurde, und in Norddeutschland
Lenne, dem wir hauptsächlich die Parkanlagen
an den königlichen Schlössern zu verdanken
haben. Mancher bisher nach französischem A or-
bilde auf deutschem Boden angelegte Park wurde
nun nach landschaftlichen Grundsätzen umgestal-
folgerichlig die Reaktion ein, so daß etwa Anfang
dieses Jahrhunderts der Architekturgarten einen
neuen starken Impuls erhielt, und sich bisher fast
unbestritten behaupten konnte. —
Die nun folgende und heute noch vorwiegende
Ablehnung des Landschaftsgartens hat aber noch
einen anderen tieferen Grund. Wir sind von der
Antike her gewöhnt, uns den Raumbegriff als
ensbesrenzt und nur in dem Sinne vorzustellen,
DO '
daß er in irgendeiner Form meßbar erscheint.
Wir haben nur gelernt, den konstruierten Raum
als richtig zu erkennen, während uns die Raum-
begriffe östlicher Völker oft unverständlich oder
geradezu falsch erscheinen. Es gibt aber noch eine
weitere fluidale Raumbeslimmung, die nicht meß-
tet, was oft so ungeschickt und gründlich ge-
schah, daß viele schöne Gartenarchitekturformen
zerstört wurden. Wo dies jedoch unter Schonung
des Vorhandenen erfolgte, ergaben sich durch die
reizvolle Mischung von Gartenarchitektur und
Landschaft zuweilen eigenartig schöne Parkbilder.
— Sellen ist eine Kunstform so rasch verfallen
und ins Banale ausgeartet wie der Landschafts-
garten. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige,
die Natur fördernde und stützende Kunstaus-
übung, die natürlich auch sehr oft zur Natur-
nachahmung verführte, einer malerisch und raum-
künstlerisch stark empfindenden Persönlichkeit
bedurfte, um vollwertige Leistungen hervorzu-
bringen. Während der Archilekturgarlen schon
eher eine gewisse schemalische Behandlung ge-
staltete, mußte beim Landschaftsgarten jede Nach-
ahmung, da die Vorbedingungen seiner künstleri-
schen Gestallung ja jedesmal andere waren, mit
einem Mißerfolg enden. Als man aber dazu über-
ging, Landschaftsgärteh auf ein paar tausend
Quadratmeter großen Flächen zu schaffen, setzte
bar, sondern illusionistisch ist, das ist der Raum-
begriff in der Landschaft. Diesem Raumbegriff,
den wir wohl richtiger als fluidales Raumgefühl
bezeichnen, war es erst vorbehalten, durch den
Farbenwechsel und das Verschwimmen der Kon-
turen Weiten zu geben. Dem illusionistischen
Raumbegriff entspricht das Landschaftsgefühl.
Wenn wir beute dem Landschaf Isgarten vielfach
ablehnend gegenüberstehen, so ist das demnach
nicht nur auf die durch die Entgleisungen dieser
Garlenform hervorgerufene Mißstimmung zu-
rückzuführen, sondern wohl viel eher darauf, daß
unsere Sinne infolge der einseitigen Einprägung
des klassischen Kunslideals zur Aufnahme anderer
unendlich feinerer Eindrücke nicht mehr fähig
sind. Trotzdem ist nicht anzunehmen, daß jene
grobsinnliche Raumauffassung, die sich keinen
Raum ohne die üblichen vier Wände denken kann,
zu herrschen beschieden ist, gegenüber der unend-
lich feineren metaphysischen landschaftlichen
Raumauffassung, die dem Deutschen seiner gan-
zen Veranlagung nach vielmehr entspricht.
71