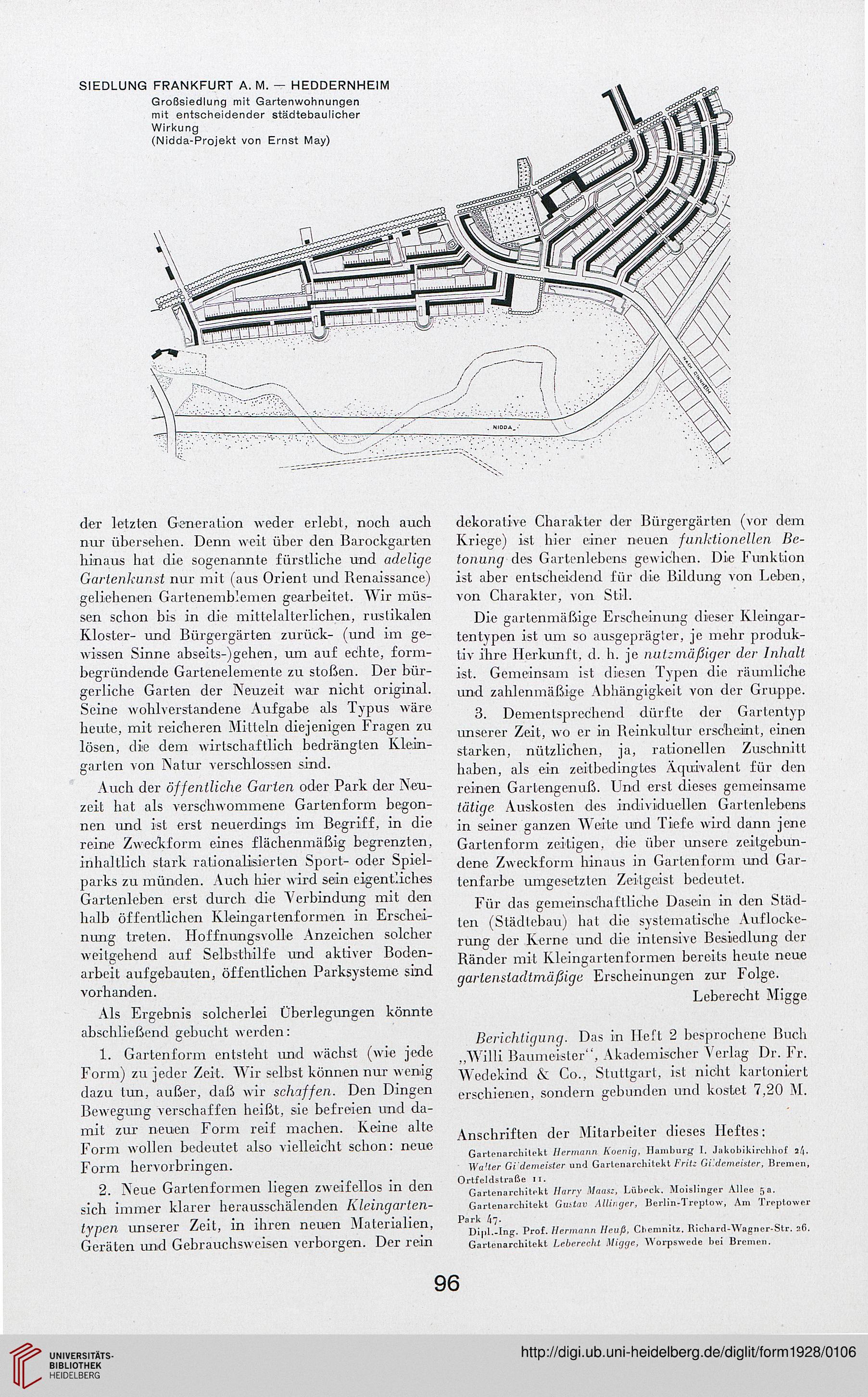der letzten Generation weder erlebt, noch auch
nur übersehen. Denn weit über den Barockgarten
hinaus hat die sogenannte fürstliche und adelige
Gartenkunst nur mit (aus Orient und Renaissance)
geliehenen Gartenemblemen gearbeitet. Wir müs-
sen schon bis in die mittelalterlichen, rustikalen
Kloster- und Bürgergärten zurück- (und im ge-
wissen Sinne abseits-)gehen, um auf echte, form-
begründende Gartenelemente zu stoßen. Der bür-
gerliche Garten der Neirzeit war nicht original.
Seine wohlverstandene Aufgabe als Typus wäre
heute, mit reicheren Mitteln diejenigen Fragen zu
lösen, die dem wirtschaftlich bedrängten Klein-
garten von Natur verschlossen sind.
Auch der öffentliche Garten oder Park der Neu-
zeit hat als verschwommene Gartenform begon-
nen und ist erst neuerdings im Begriff, in die
reine Zweckform eines flächenmäßig begrenzten,
inhaltlich stark rationalisierten Sport- oder Spiel-
parks zu münden. Auch hier wird sein eigentliches
Garlenleben erst durch die V erbindung mit den
halb öffentlichen Kleingartenformen in Erschei-
nung treten. Hoffnungsvolle Anzeichen solcher
weitgehend auf Selbsthilfe und aktiver Boden-
arbeit aufgebauten, öffentlichen Parksysteme sind
vorhanden.
Als Ergebnis solcherlei Überlegungen könnte
abschließend gebucht werden:
1. Gartenform entsteht und wächst (wie jede
Form) zu jeder Zeit. Wir selbst können nur wenig
dazu tun, außer, daß wir schaffen. Den Dingen
Bewegung verschaffen heißt, sie befreien und da-
mit zur neuen Form reif machen. Keine alte
Form wollen bedeutet also vielleicht schon: neue
Form hervorbringen.
2. Neue Garlenformen liegen zweifellos in den
sich immer klarer herausschälenden Kleingarten-
typen unserer Zeit, in ihren neuen Materialien,
Geräten und Gebrauchsweisen verborgen. Der rein
dekorative Charakter der Bürgergärten (vor dem
Kriege) ist hier einer neuen funktionellen Be-
tonung des Gartenlebens gewichen. Die Funktion
ist aber entscheidend für die Bildung von Leben,
von Charakter, von Stil.
Die gartenmäßige Erscheinung dieser Kleingar-
tenlvpen ist um so ausgeprägter, je mehr produk-
tiv ihre Herkunft, d. h. je nutzmäßiger der Inhalt
ist. Gemeinsam ist diesen Typen die räumliche
und zahlenmäßige Abhängigkeit von der Gruppe.
3. Dementsprechend dürfte der Garlentyp
unserer Zeit, wo er in Reinkultur erscheint, einen
starken, nützlichen, ja, rationellen Zuschnitt
haben, als ein zeilbedingtes Äquivalent für den
reinen Garlengenuß. Und erst dieses gemeinsame
tätige Auskosten des individuellen Garlenlebens
in seiner ganzen Weite und Tiefe wird dann jene
Garten form zeitigen, die über unsere zeitgebun-
dene Zweckform hinaus in Garlenform und Gar-
tenfarbe umgesetzten Zeilgeist bedeutet.
Für das gemeinschaftliche Dasein in den Städ-
ten (Städtebau) hat die systematische Auflocke-
rung der Kerne und die intensive Besiedlung der
Ränder mit Kleingartenformen bereits heute neue
garleusladtmäßige Erscheinungen zur Folge.
Leberecht Migge
Berichtigung. Das in Heft 2 besprochene Buch
„Willi Baumeister", Akademischer Verlag Dr. Fr.
Wedekind & Co., Stuttgart, ist nicht kartoniert
erschienen, sondern gebunden und kostet 7,20 M.
Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes:
Gartenarchitekt Hermann Koenuj, Hamburg I. Jakobikirchhof it\.
Wa'ter Gi'demeister und Gartenarchitekt FriU Gi'.demeüter, Bremen,
Ortfeldstraße Ii.
Gartenarchitekt Harry Maas:, Lübeck. Moislinger Allee 5a.
Gartenarchitekt Gustav Allinger, Berlin-Treptow, Am Treptower
Park 47.
Dipl.-Ing. Prof. Hermann Heuß, Chemnitz. Ricliard-Wagner-Str. 36.
Gartenarchitekt Leberecht Miqqe, Worpswede bei Bremen.
96
nur übersehen. Denn weit über den Barockgarten
hinaus hat die sogenannte fürstliche und adelige
Gartenkunst nur mit (aus Orient und Renaissance)
geliehenen Gartenemblemen gearbeitet. Wir müs-
sen schon bis in die mittelalterlichen, rustikalen
Kloster- und Bürgergärten zurück- (und im ge-
wissen Sinne abseits-)gehen, um auf echte, form-
begründende Gartenelemente zu stoßen. Der bür-
gerliche Garten der Neirzeit war nicht original.
Seine wohlverstandene Aufgabe als Typus wäre
heute, mit reicheren Mitteln diejenigen Fragen zu
lösen, die dem wirtschaftlich bedrängten Klein-
garten von Natur verschlossen sind.
Auch der öffentliche Garten oder Park der Neu-
zeit hat als verschwommene Gartenform begon-
nen und ist erst neuerdings im Begriff, in die
reine Zweckform eines flächenmäßig begrenzten,
inhaltlich stark rationalisierten Sport- oder Spiel-
parks zu münden. Auch hier wird sein eigentliches
Garlenleben erst durch die V erbindung mit den
halb öffentlichen Kleingartenformen in Erschei-
nung treten. Hoffnungsvolle Anzeichen solcher
weitgehend auf Selbsthilfe und aktiver Boden-
arbeit aufgebauten, öffentlichen Parksysteme sind
vorhanden.
Als Ergebnis solcherlei Überlegungen könnte
abschließend gebucht werden:
1. Gartenform entsteht und wächst (wie jede
Form) zu jeder Zeit. Wir selbst können nur wenig
dazu tun, außer, daß wir schaffen. Den Dingen
Bewegung verschaffen heißt, sie befreien und da-
mit zur neuen Form reif machen. Keine alte
Form wollen bedeutet also vielleicht schon: neue
Form hervorbringen.
2. Neue Garlenformen liegen zweifellos in den
sich immer klarer herausschälenden Kleingarten-
typen unserer Zeit, in ihren neuen Materialien,
Geräten und Gebrauchsweisen verborgen. Der rein
dekorative Charakter der Bürgergärten (vor dem
Kriege) ist hier einer neuen funktionellen Be-
tonung des Gartenlebens gewichen. Die Funktion
ist aber entscheidend für die Bildung von Leben,
von Charakter, von Stil.
Die gartenmäßige Erscheinung dieser Kleingar-
tenlvpen ist um so ausgeprägter, je mehr produk-
tiv ihre Herkunft, d. h. je nutzmäßiger der Inhalt
ist. Gemeinsam ist diesen Typen die räumliche
und zahlenmäßige Abhängigkeit von der Gruppe.
3. Dementsprechend dürfte der Garlentyp
unserer Zeit, wo er in Reinkultur erscheint, einen
starken, nützlichen, ja, rationellen Zuschnitt
haben, als ein zeilbedingtes Äquivalent für den
reinen Garlengenuß. Und erst dieses gemeinsame
tätige Auskosten des individuellen Garlenlebens
in seiner ganzen Weite und Tiefe wird dann jene
Garten form zeitigen, die über unsere zeitgebun-
dene Zweckform hinaus in Garlenform und Gar-
tenfarbe umgesetzten Zeilgeist bedeutet.
Für das gemeinschaftliche Dasein in den Städ-
ten (Städtebau) hat die systematische Auflocke-
rung der Kerne und die intensive Besiedlung der
Ränder mit Kleingartenformen bereits heute neue
garleusladtmäßige Erscheinungen zur Folge.
Leberecht Migge
Berichtigung. Das in Heft 2 besprochene Buch
„Willi Baumeister", Akademischer Verlag Dr. Fr.
Wedekind & Co., Stuttgart, ist nicht kartoniert
erschienen, sondern gebunden und kostet 7,20 M.
Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes:
Gartenarchitekt Hermann Koenuj, Hamburg I. Jakobikirchhof it\.
Wa'ter Gi'demeister und Gartenarchitekt FriU Gi'.demeüter, Bremen,
Ortfeldstraße Ii.
Gartenarchitekt Harry Maas:, Lübeck. Moislinger Allee 5a.
Gartenarchitekt Gustav Allinger, Berlin-Treptow, Am Treptower
Park 47.
Dipl.-Ing. Prof. Hermann Heuß, Chemnitz. Ricliard-Wagner-Str. 36.
Gartenarchitekt Leberecht Miqqe, Worpswede bei Bremen.
96