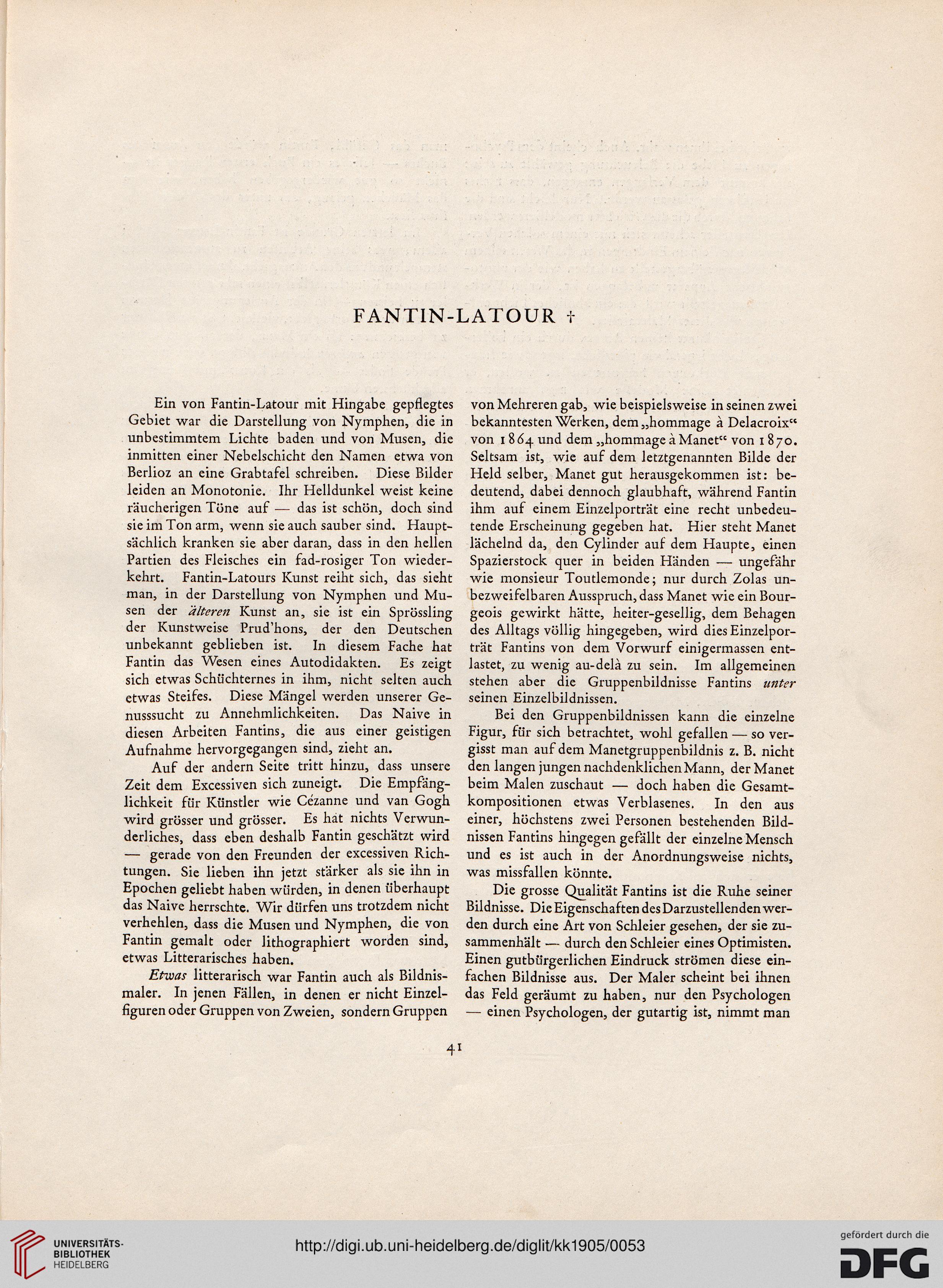FANTIN-LATOUR
Ein von Fantin-Latour mit Hingabe gepflegtes
Gebiet war die Darstellung von Nymphen, die in
unbestimmtem Lichte baden vind von Musen, die
inmitten einer Nebelschicht den Namen etwa von
Berlioz an eine Grabtafel schreiben. Diese Bilder
leiden an Monotonie. Ihr Helldunkel weist keine
räucherigen Töne auf — das ist schön, doch sind
sie im Ton arm, wenn sie auch sauber sind. Haupt-
sächlich kranken sie aber daran, dass in den hellen
Partien des Fleisches ein fad-rosiger Ton wieder-
kehrt. Fantin-Latours Kunst reiht sich, das sieht
man, in der Darstellung von Nymphen und Mu-
sen der älteren Kunst an, sie ist ein Sprössling
der Kunstweise Prud'hons, der den Deutschen
unbekannt geblieben ist. In diesem Fache hat
Fantin das Wesen eines Autodidakten. Es zeigt
sich etwas Schüchternes in ihm, nicht selten auch
etwas Steifes. Diese Mängel werden unserer Ge-
nusssucht zu Annehmlichkeiten. Das Naive in
diesen Arbeiten Fantins, die aus einer geistigen
Aufnahme hervorgegangen sind, zieht an.
Auf der andern Seite tritt hinzu, dass unsere
Zeit dem Excessiven sich zuneigt. Die Empfäng-
lichkeit für Künstler wie Cezanne und van Gogh
wird grösser und grösser. Es hat nichts Verwun-
derliches, dass eben deshalb Fantin geschätzt wird
— gerade von den Freunden der excessiven Rich-
tungen. Sie lieben ihn jetzt stärker als sie ihn in
Epochen geliebt haben würden, in denen überhaupt
das Naive herrschte. Wir dürfen uns trotzdem nicht
verhehlen, dass die Musen und Nymphen, die von
Fantin gemalt oder lithographiert worden sind,
etwas Litterarisches haben.
Etwas litterarisch war Fantin auch als Bildnis-
maler. In jenen Fällen, in denen er nicht Einzel-
figuren oder Gruppen von Zweien, sondern Gruppen
von Mehreren gab, wie beispielsweise in seinen zwei
bekanntesten Werken, dem „hommage ä Delacroix"
von i 864 und dem „hommage ä Manet" von 1870.
Seltsam ist, wie auf dem letztgenannten Bilde der
Held selber, Manet gut herausgekommen ist: be-
deutend, dabei dennoch glaubhaft, während Fantin
ihm auf einem Einzelporträt eine recht unbedeu-
tende Erscheinung gegeben hat. Hier steht Manet
lächelnd da, den Cylinder auf dem Haupte, einen
Spazierstock quer in beiden Händen — ungefähr
wie monsieur Toutlemonde; nur durch Zolas un-
bezweifelbaren Ausspruch, dass Manet wie ein Bour-
geois gewirkt hätte, heiter-gesellig, dem Behagen
des Alltags völlig hingegeben, wird dies Einzelpor-
trät Fantins von dem Vorwurf einigermassen ent-
lastet, zu wenig au-delä zu sein. Im allgemeinen
stehen aber die Gruppenbildnisse Fantins unter
seinen Einzelbildnissen.
Bei den Gruppenbildnissen kann die einzelne
Figur, für sich betrachtet, wohl gefallen — so ver-
gisst man auf dem Manetgruppenbildnis z. B. nicht
den langen jungen nachdenklichen Mann, der Manet
beim Malen zuschaut — doch haben die Gesamt-
kompositionen etwas Verblasenes. In den aus
einer, höchstens zwei Personen bestehenden Bild-
nissen Fantins hingegen gefällt der einzelne Mensch
und es ist auch in der Anordnungsweise nichts,
was missfallen könnte.
Die grosse Qualität Fantins ist die Ruhe seiner
Bildnisse. Die Eigenschaften des Darzustellenden wer-
den durch eine Art von Schleier gesehen, der sie zu-
sammenhält — durch den Schleier eines Optimisten.
Einen gutbürgerlichen Eindruck strömen diese ein-
fachen Bildnisse aus. Der Maler scheint bei ihnen
das Feld geräumt zu haben, nur den Psychologen
— einen Psychologen, der gutartig ist, nimmt man
41
Ein von Fantin-Latour mit Hingabe gepflegtes
Gebiet war die Darstellung von Nymphen, die in
unbestimmtem Lichte baden vind von Musen, die
inmitten einer Nebelschicht den Namen etwa von
Berlioz an eine Grabtafel schreiben. Diese Bilder
leiden an Monotonie. Ihr Helldunkel weist keine
räucherigen Töne auf — das ist schön, doch sind
sie im Ton arm, wenn sie auch sauber sind. Haupt-
sächlich kranken sie aber daran, dass in den hellen
Partien des Fleisches ein fad-rosiger Ton wieder-
kehrt. Fantin-Latours Kunst reiht sich, das sieht
man, in der Darstellung von Nymphen und Mu-
sen der älteren Kunst an, sie ist ein Sprössling
der Kunstweise Prud'hons, der den Deutschen
unbekannt geblieben ist. In diesem Fache hat
Fantin das Wesen eines Autodidakten. Es zeigt
sich etwas Schüchternes in ihm, nicht selten auch
etwas Steifes. Diese Mängel werden unserer Ge-
nusssucht zu Annehmlichkeiten. Das Naive in
diesen Arbeiten Fantins, die aus einer geistigen
Aufnahme hervorgegangen sind, zieht an.
Auf der andern Seite tritt hinzu, dass unsere
Zeit dem Excessiven sich zuneigt. Die Empfäng-
lichkeit für Künstler wie Cezanne und van Gogh
wird grösser und grösser. Es hat nichts Verwun-
derliches, dass eben deshalb Fantin geschätzt wird
— gerade von den Freunden der excessiven Rich-
tungen. Sie lieben ihn jetzt stärker als sie ihn in
Epochen geliebt haben würden, in denen überhaupt
das Naive herrschte. Wir dürfen uns trotzdem nicht
verhehlen, dass die Musen und Nymphen, die von
Fantin gemalt oder lithographiert worden sind,
etwas Litterarisches haben.
Etwas litterarisch war Fantin auch als Bildnis-
maler. In jenen Fällen, in denen er nicht Einzel-
figuren oder Gruppen von Zweien, sondern Gruppen
von Mehreren gab, wie beispielsweise in seinen zwei
bekanntesten Werken, dem „hommage ä Delacroix"
von i 864 und dem „hommage ä Manet" von 1870.
Seltsam ist, wie auf dem letztgenannten Bilde der
Held selber, Manet gut herausgekommen ist: be-
deutend, dabei dennoch glaubhaft, während Fantin
ihm auf einem Einzelporträt eine recht unbedeu-
tende Erscheinung gegeben hat. Hier steht Manet
lächelnd da, den Cylinder auf dem Haupte, einen
Spazierstock quer in beiden Händen — ungefähr
wie monsieur Toutlemonde; nur durch Zolas un-
bezweifelbaren Ausspruch, dass Manet wie ein Bour-
geois gewirkt hätte, heiter-gesellig, dem Behagen
des Alltags völlig hingegeben, wird dies Einzelpor-
trät Fantins von dem Vorwurf einigermassen ent-
lastet, zu wenig au-delä zu sein. Im allgemeinen
stehen aber die Gruppenbildnisse Fantins unter
seinen Einzelbildnissen.
Bei den Gruppenbildnissen kann die einzelne
Figur, für sich betrachtet, wohl gefallen — so ver-
gisst man auf dem Manetgruppenbildnis z. B. nicht
den langen jungen nachdenklichen Mann, der Manet
beim Malen zuschaut — doch haben die Gesamt-
kompositionen etwas Verblasenes. In den aus
einer, höchstens zwei Personen bestehenden Bild-
nissen Fantins hingegen gefällt der einzelne Mensch
und es ist auch in der Anordnungsweise nichts,
was missfallen könnte.
Die grosse Qualität Fantins ist die Ruhe seiner
Bildnisse. Die Eigenschaften des Darzustellenden wer-
den durch eine Art von Schleier gesehen, der sie zu-
sammenhält — durch den Schleier eines Optimisten.
Einen gutbürgerlichen Eindruck strömen diese ein-
fachen Bildnisse aus. Der Maler scheint bei ihnen
das Feld geräumt zu haben, nur den Psychologen
— einen Psychologen, der gutartig ist, nimmt man
41