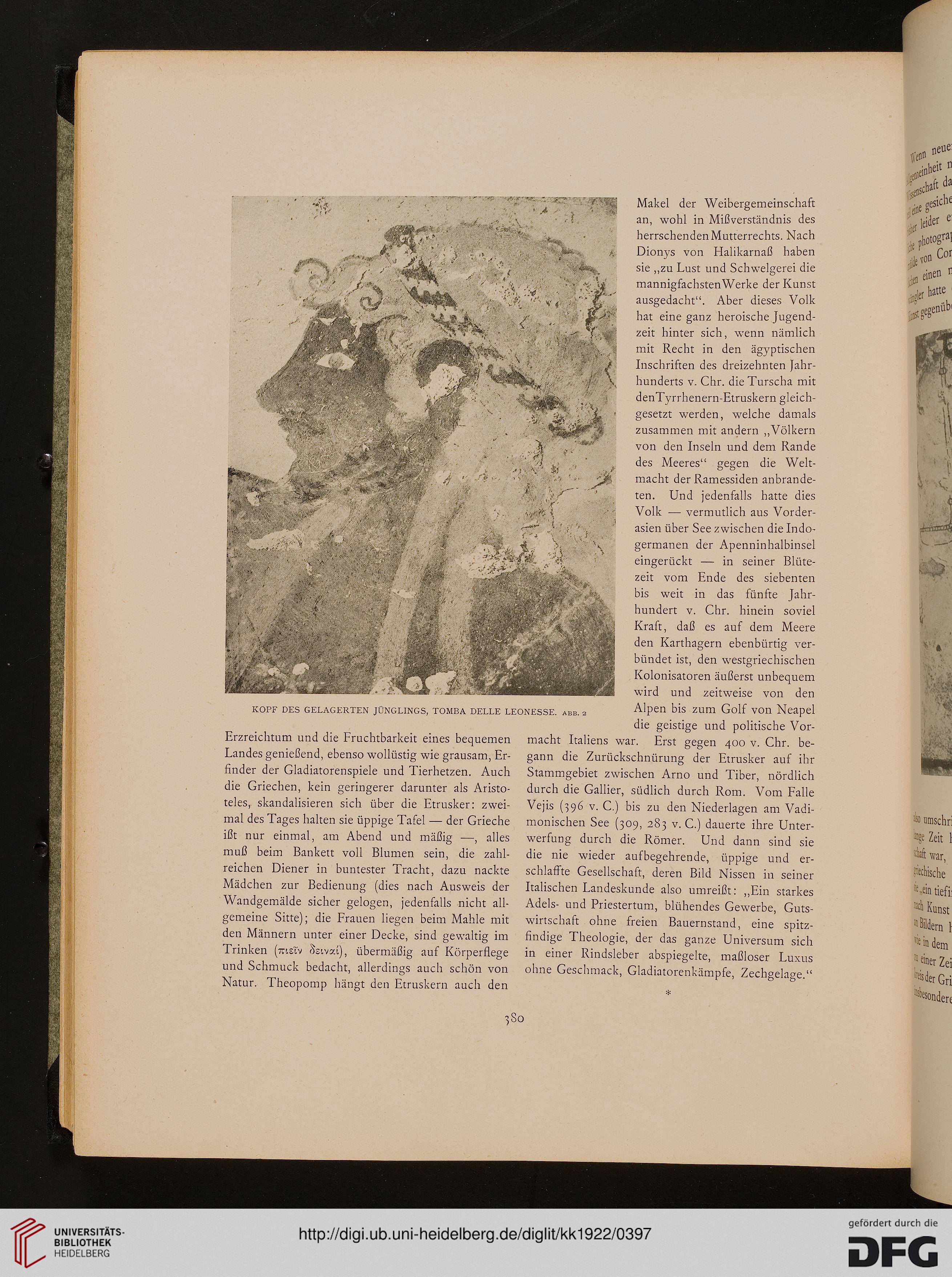KOPF DES GELAGERTEN JÜNGLINGS, TOMBA DELLE LEONESSE, abb. 2
Erzreichtum und die Fruchtbarkeit eines bequemen
Landes genießend, ebenso wollüstig wie grausam, Er-
finder der Gladiatorenspiele und Tierhetzen. Auch
die Griechen, kein geringerer darunter als Aristo-
teles, skandalisieren sich über die Etrusker: zwei-
mal des Tages halten sie üppige Tafel — der Grieche
ißt nur einmal, am Abend und mäßig —, alles
muß beim Bankett voll Blumen sein, die zahl-
reichen Diener in buntester Tracht, dazu nackte
Mädchen zur Bedienung (dies nach Ausweis der
Wandgemälde sicher gelogen, jedenfalls nicht all-
gemeine Sitte); die Frauen liegen beim Mahle mit
den Männern unter einer Decke, sind gewaltig im
Trinken (msiv Ssivai), übermäßig auf Körperflege
und Schmuck bedacht, allerdings auch schön von
Natur. Theopomp hängt den Etruskern auch den
Makel der Weibergemeinschaft
an, wohl in Mißverständnis des
herrschenden Mutterrechts. Nach
Dionys von Halikarnaß haben
sie „zu Lust und Schwelgerei die
mannigfachsten Werke der Kunst
ausgedacht". Aber dieses Volk
hat eine ganz heroische Jugend-
zeit hinter sich, wenn nämlich
mit Recht in den ägyptischen
Inschriften des dreizehnten Jahr-
hunderts v. Chr. die Turscha mit
denTyrrhenern-Etruskern gleich-
gesetzt werden, welche damals
zusammen mit andern „Völkern
von den Inseln und dem Rande
des Meeres" gegen die Welt-
macht der Ramessiden anbrande-
ten. Und jedenfalls hatte dies
Volk — vermutlich aus Vorder-
asien über See zwischen die Indo-
germanen der Apenninhalbinsel
eingerückt — in seiner Blüte-
zeit vom Ende des siebenten
bis weit in das fünfte Jahr-
hundert v. Chr. hinein soviel
Kraft, daß es auf dem Meere
den Karthagern ebenbürtig ver-
bündet ist, den westgriechischen
Kolonisatoren äußerst unbequem
wird und zeitweise von den
Alpen bis zum Golf von Neapel
die geistige und politische Vor-
macht Italiens war. Erst gegen 400 v. Chr. be-
gann die Zurückschnürung der Etrusker auf ihr
Stammgebiet zwischen Arno und Tiber, nördlich
durch die Gallier, südlich durch Rom. Vom Falle
Vejis (396 v. C.) bis zu den Niederlagen am Vadi-
monischen See (309, 283 v. C.) dauerte ihre Unter-
werfung durch die Römer. Und dann sind sie
die nie wieder aufbegehrende, üppige und er-
schlaffte Gesellschaft, deren Bild Nissen in seiner
Italischen Landeskunde also umreißt: „Ein starkes
Adels- und Priestertum, blühendes Gewerbe, Guts-
wirtschaft ohne freien Bauernstand, eine spitz-
findige Theologie, der das ganze Universum sich
in einer Rindsleber abspiegelte, maßloser Luxus
ohne Geschmack, Gladiatorenkämpfe, Zechgelage."
3 So
Erzreichtum und die Fruchtbarkeit eines bequemen
Landes genießend, ebenso wollüstig wie grausam, Er-
finder der Gladiatorenspiele und Tierhetzen. Auch
die Griechen, kein geringerer darunter als Aristo-
teles, skandalisieren sich über die Etrusker: zwei-
mal des Tages halten sie üppige Tafel — der Grieche
ißt nur einmal, am Abend und mäßig —, alles
muß beim Bankett voll Blumen sein, die zahl-
reichen Diener in buntester Tracht, dazu nackte
Mädchen zur Bedienung (dies nach Ausweis der
Wandgemälde sicher gelogen, jedenfalls nicht all-
gemeine Sitte); die Frauen liegen beim Mahle mit
den Männern unter einer Decke, sind gewaltig im
Trinken (msiv Ssivai), übermäßig auf Körperflege
und Schmuck bedacht, allerdings auch schön von
Natur. Theopomp hängt den Etruskern auch den
Makel der Weibergemeinschaft
an, wohl in Mißverständnis des
herrschenden Mutterrechts. Nach
Dionys von Halikarnaß haben
sie „zu Lust und Schwelgerei die
mannigfachsten Werke der Kunst
ausgedacht". Aber dieses Volk
hat eine ganz heroische Jugend-
zeit hinter sich, wenn nämlich
mit Recht in den ägyptischen
Inschriften des dreizehnten Jahr-
hunderts v. Chr. die Turscha mit
denTyrrhenern-Etruskern gleich-
gesetzt werden, welche damals
zusammen mit andern „Völkern
von den Inseln und dem Rande
des Meeres" gegen die Welt-
macht der Ramessiden anbrande-
ten. Und jedenfalls hatte dies
Volk — vermutlich aus Vorder-
asien über See zwischen die Indo-
germanen der Apenninhalbinsel
eingerückt — in seiner Blüte-
zeit vom Ende des siebenten
bis weit in das fünfte Jahr-
hundert v. Chr. hinein soviel
Kraft, daß es auf dem Meere
den Karthagern ebenbürtig ver-
bündet ist, den westgriechischen
Kolonisatoren äußerst unbequem
wird und zeitweise von den
Alpen bis zum Golf von Neapel
die geistige und politische Vor-
macht Italiens war. Erst gegen 400 v. Chr. be-
gann die Zurückschnürung der Etrusker auf ihr
Stammgebiet zwischen Arno und Tiber, nördlich
durch die Gallier, südlich durch Rom. Vom Falle
Vejis (396 v. C.) bis zu den Niederlagen am Vadi-
monischen See (309, 283 v. C.) dauerte ihre Unter-
werfung durch die Römer. Und dann sind sie
die nie wieder aufbegehrende, üppige und er-
schlaffte Gesellschaft, deren Bild Nissen in seiner
Italischen Landeskunde also umreißt: „Ein starkes
Adels- und Priestertum, blühendes Gewerbe, Guts-
wirtschaft ohne freien Bauernstand, eine spitz-
findige Theologie, der das ganze Universum sich
in einer Rindsleber abspiegelte, maßloser Luxus
ohne Geschmack, Gladiatorenkämpfe, Zechgelage."
3 So