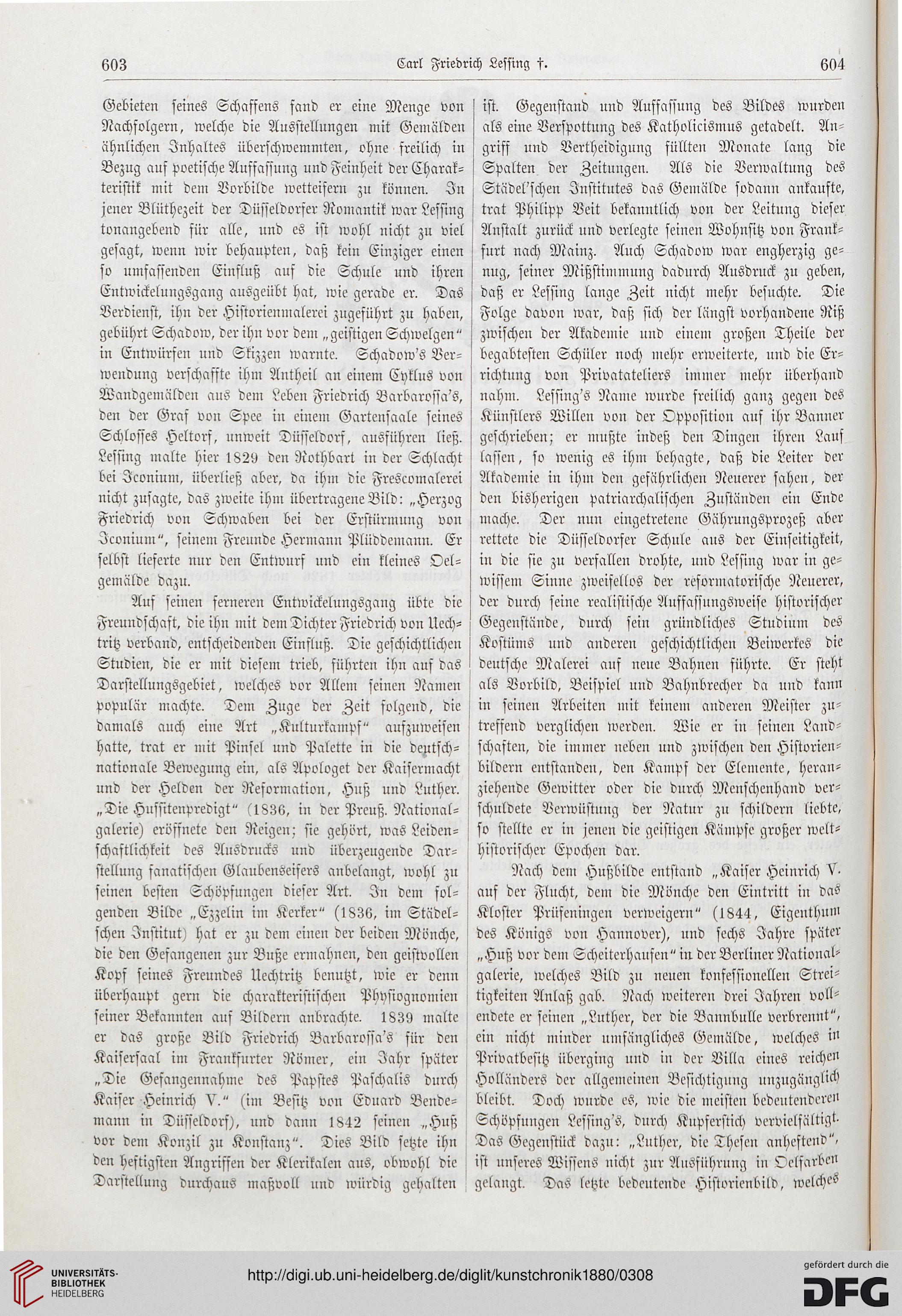603
Carl Frredrich Lessing 1",
604
Gebieten seines Schaffens fand er eine Menge von
Nachfolgern, welche die Ausstellungen mit Gemälden
ähnlichen Jnhaltes überschwemmten, ohne freilich in
Bezug auf poetische Auffassung und Feinheit der Charak-
teristik mit dem Vorbilde wctteifern zu können. Än
jener Blüthezeit der Düsseldorfer Romantik war Lessing
tonangebend für alle, und es ist wohl nicht zu viel
gesagt, wenn wir behauptcn, daß kein Einziger einen
so umfassenden Einfluß aus die Schule und ihren
Entwickelungsgang ausgeübt hat, wie gerade er. Das
Verdienst, ihn der Historienmalerei zugeführt zu haben,
gebührt Schadow, der ihn vor dem „geistigen Schwelgen"
in Entwürfen und Skizzen warnte. Schadow'S Ver-
wendung verschaffte ihm Antheil an einem Cyklns von
Wandgemälden aus dem Leben Friedrich Barbarossa's,
den der Graf von Spee in einem Gartensaale seines
Schlosses Heltorf, nnweit Dnsseldorf, ausführen ließ.
Lessing malte hier 1829 den Rothbart in der Schlacht
bei Jconium, überließ aber, da ihm die Frescomalerei
nicht zusagte, das zweite ihm übertrageneBild: „Herzog
Friedrich von Schwaben bei der Erstürmung von
Jconium", seinem Freunde Hermann Plüddemann. Er
selbst lieferte nur den Entwurf uud ein kleines Oel-
gemälde dazu.
Auf seinen ferneren Entwickelungsgang übte die
Freundschast, die ihn mit dem Dichter Friedrich von Uech-
tritz verband, entscheidenden Einfluß. Die geschichtlichen
Studien, die er mit diesem trieb, führten ihn auf das
Darstcllungsgebiet, welches vor Allem seincn Nanien
populär machte. Dem Zuge der Zeit solgend, die
damals auch eine Art „Kulturkampf" aufzuweisen
hatte, trat er mit Pinsel und Palette in die de)itsch-
nationale Bewegung ein, als Apologet der Kaisermacht
und der Helden der Reformation, Huß und Luther.
„Die Hussitenpredigt" (1836, in der Preuß. National-
galerie) eröffnete den Reigen; sie gehört, was Leiden-
schaftlichkeit des Ausdrucks und überzeugende Dar-
stellung fanatischen Glaubenseifers anbelangt, wohl zu
seinen besten Schöpfungen dieser Art. Jn dem sol-
genden Bilde „Ezzelin im Kerker" (1836, im Städel-
schen Jnstitut) hat er zu dem eineu der beiden Mönche,
die den Gefangenen zur Buße ermahnen, den geistvollen
Kopf seines Freundes Uechtritz benutzt, wie er denn
überhaupt gern die charakteristischen Physiognomien
seiner Bekannten auf Bildern anbrachte. 1839 malte
er das große Bild Friedrich Barbarossa's sür den
Kaisersaal im Frankfurter Römer, ein Jahr später
„Die Gefangennahme des Papstes Paschalis durch
Kaiser Heinrich V." (im Besitz von Eduard Bende- ^
mann in Düsseldorf), und dann 1842 seinen „Huß
vor dem Konzil zu Konstanz". Dies Bild setzte ihn
den heftigsten Angrifsen der Klerikalen aus, obwohl dic
Darjtellung durchaus maßvoll nnd würdig gehalten
ist. Gegenstand und Aufsassung des Bildes wurden
als eine Verspottung des Katholicismus getadelt. An-
griff nnd Vertheidigung füllten Monate lang die
Spalten der Zeitungen. Als die Verwaltung des
Städel'schen Jnstitutes das Gemälde sodann ankaufte,
trat Philipp Veit bckanutlich von der Leitung dieser
Anstalt zurück und verlegte seinen Wohnsitz von Frank-
surt nach Mainz. Anch Schadow war engherzig ge-
nug, seiner Mißstimmung dadurch Ausdruck zu geben,
daß er Lessing lange Zeit nicht mehr besuchte. Die
Folge davon war, daß sich dcr längst vorhandene Riß
zwischen der Akademie und einem großen Theile der
begabtesten Schüler noch mehr erweiterte, und die Er-
richtnng von Privatateliers immer mehr überhand
nahni. Lessing's Name wurde freilich ganz gegen des
Künstlers Willen von der Opposition auf ihr Banncr
geschrieben; er mußte indeß dcn Dingen ihren Lauf
lassen, so wenig es ihm behagte, daß die Leiter der
Akademie in ihm dcn gefährlichen Neuerer sahen, der
den bisherigen patriarchalischen Zuständen ein Ende
mache. Der nun eingetretene Gährungsprozeß aber
rettete die Düsseldorfer Schule aus der Einseitigkeit,
in die sie zu versallen drohte, und Lessing war in ge-
wissem Sinne zwcifellos der reformatorische Neuercr,
der durch seine realistische Anffassungsweise histvrischer
Gegenstände, durch sein gründliches Studium des
Kostünis und anderen gcschichtlichen Beiwerkcs dic
deutsche Malerei auf neuc Bahnen führte. Er steht
als Vorbild, Beispicl und Bahnbrecher da und kann
in seinen Arbeiten mit keinem anderen Meister zn-
trefsend verglichen werden. Wie er in seincn Land-
schaften, die immer neben und zwischcn den Historien-
bildern entstanden, den Kampf der Elemcnte, heran-
ziehende Gewitter odcr die durch Mcnschcnhand vcr-
schuldete Verwüstung der Natur zu schildern licbte,
^ so stelltc er in jenen die geistigen Kämpfe großer wclt-
historischer Epochcn dar.
Nach dem Hußbilde entstand „Kaiser Heinrich V.
auf der Flucht, dem die Mönche dcn Eintritt in das
Kloster Prüfeningcn verweigern" (1844, Eigenthuin
des Königs von Hannover), und sechs Jahre später
„Huß vor dem Scheiterhaufeu" iu dcr Berliuer National-
galerie, welches Bild zu neuen kvnfessionellen Strei-
tigkeiten Anlaß gab. Nach wciteren drei Jahrcn voll-
cndete er seinen „Luther, der die Bannbulle verbrennt",
ein nicht niinder nmfängliches Gcmälde, welches in
Privatbesitz überging und in der Villa eincs reichen
Holländers der allgcmeinen Besichtignng unzugänglich
bleibt. Doch tvurde es, wie die meisten bedcntendcrc»
Schopfungen Lessing's, durch Knpferstich verviclsältigt-
Das Gegenstück dazu: „Luther, die Thescn anhcftciid",
ist unseres Wissens nicht zur Ausführuug in Oelfarbcn
gelangt. Das lctztc bedeutende Historienbild, welchcs
Carl Frredrich Lessing 1",
604
Gebieten seines Schaffens fand er eine Menge von
Nachfolgern, welche die Ausstellungen mit Gemälden
ähnlichen Jnhaltes überschwemmten, ohne freilich in
Bezug auf poetische Auffassung und Feinheit der Charak-
teristik mit dem Vorbilde wctteifern zu können. Än
jener Blüthezeit der Düsseldorfer Romantik war Lessing
tonangebend für alle, und es ist wohl nicht zu viel
gesagt, wenn wir behauptcn, daß kein Einziger einen
so umfassenden Einfluß aus die Schule und ihren
Entwickelungsgang ausgeübt hat, wie gerade er. Das
Verdienst, ihn der Historienmalerei zugeführt zu haben,
gebührt Schadow, der ihn vor dem „geistigen Schwelgen"
in Entwürfen und Skizzen warnte. Schadow'S Ver-
wendung verschaffte ihm Antheil an einem Cyklns von
Wandgemälden aus dem Leben Friedrich Barbarossa's,
den der Graf von Spee in einem Gartensaale seines
Schlosses Heltorf, nnweit Dnsseldorf, ausführen ließ.
Lessing malte hier 1829 den Rothbart in der Schlacht
bei Jconium, überließ aber, da ihm die Frescomalerei
nicht zusagte, das zweite ihm übertrageneBild: „Herzog
Friedrich von Schwaben bei der Erstürmung von
Jconium", seinem Freunde Hermann Plüddemann. Er
selbst lieferte nur den Entwurf uud ein kleines Oel-
gemälde dazu.
Auf seinen ferneren Entwickelungsgang übte die
Freundschast, die ihn mit dem Dichter Friedrich von Uech-
tritz verband, entscheidenden Einfluß. Die geschichtlichen
Studien, die er mit diesem trieb, führten ihn auf das
Darstcllungsgebiet, welches vor Allem seincn Nanien
populär machte. Dem Zuge der Zeit solgend, die
damals auch eine Art „Kulturkampf" aufzuweisen
hatte, trat er mit Pinsel und Palette in die de)itsch-
nationale Bewegung ein, als Apologet der Kaisermacht
und der Helden der Reformation, Huß und Luther.
„Die Hussitenpredigt" (1836, in der Preuß. National-
galerie) eröffnete den Reigen; sie gehört, was Leiden-
schaftlichkeit des Ausdrucks und überzeugende Dar-
stellung fanatischen Glaubenseifers anbelangt, wohl zu
seinen besten Schöpfungen dieser Art. Jn dem sol-
genden Bilde „Ezzelin im Kerker" (1836, im Städel-
schen Jnstitut) hat er zu dem eineu der beiden Mönche,
die den Gefangenen zur Buße ermahnen, den geistvollen
Kopf seines Freundes Uechtritz benutzt, wie er denn
überhaupt gern die charakteristischen Physiognomien
seiner Bekannten auf Bildern anbrachte. 1839 malte
er das große Bild Friedrich Barbarossa's sür den
Kaisersaal im Frankfurter Römer, ein Jahr später
„Die Gefangennahme des Papstes Paschalis durch
Kaiser Heinrich V." (im Besitz von Eduard Bende- ^
mann in Düsseldorf), und dann 1842 seinen „Huß
vor dem Konzil zu Konstanz". Dies Bild setzte ihn
den heftigsten Angrifsen der Klerikalen aus, obwohl dic
Darjtellung durchaus maßvoll nnd würdig gehalten
ist. Gegenstand und Aufsassung des Bildes wurden
als eine Verspottung des Katholicismus getadelt. An-
griff nnd Vertheidigung füllten Monate lang die
Spalten der Zeitungen. Als die Verwaltung des
Städel'schen Jnstitutes das Gemälde sodann ankaufte,
trat Philipp Veit bckanutlich von der Leitung dieser
Anstalt zurück und verlegte seinen Wohnsitz von Frank-
surt nach Mainz. Anch Schadow war engherzig ge-
nug, seiner Mißstimmung dadurch Ausdruck zu geben,
daß er Lessing lange Zeit nicht mehr besuchte. Die
Folge davon war, daß sich dcr längst vorhandene Riß
zwischen der Akademie und einem großen Theile der
begabtesten Schüler noch mehr erweiterte, und die Er-
richtnng von Privatateliers immer mehr überhand
nahni. Lessing's Name wurde freilich ganz gegen des
Künstlers Willen von der Opposition auf ihr Banncr
geschrieben; er mußte indeß dcn Dingen ihren Lauf
lassen, so wenig es ihm behagte, daß die Leiter der
Akademie in ihm dcn gefährlichen Neuerer sahen, der
den bisherigen patriarchalischen Zuständen ein Ende
mache. Der nun eingetretene Gährungsprozeß aber
rettete die Düsseldorfer Schule aus der Einseitigkeit,
in die sie zu versallen drohte, und Lessing war in ge-
wissem Sinne zwcifellos der reformatorische Neuercr,
der durch seine realistische Anffassungsweise histvrischer
Gegenstände, durch sein gründliches Studium des
Kostünis und anderen gcschichtlichen Beiwerkcs dic
deutsche Malerei auf neuc Bahnen führte. Er steht
als Vorbild, Beispicl und Bahnbrecher da und kann
in seinen Arbeiten mit keinem anderen Meister zn-
trefsend verglichen werden. Wie er in seincn Land-
schaften, die immer neben und zwischcn den Historien-
bildern entstanden, den Kampf der Elemcnte, heran-
ziehende Gewitter odcr die durch Mcnschcnhand vcr-
schuldete Verwüstung der Natur zu schildern licbte,
^ so stelltc er in jenen die geistigen Kämpfe großer wclt-
historischer Epochcn dar.
Nach dem Hußbilde entstand „Kaiser Heinrich V.
auf der Flucht, dem die Mönche dcn Eintritt in das
Kloster Prüfeningcn verweigern" (1844, Eigenthuin
des Königs von Hannover), und sechs Jahre später
„Huß vor dem Scheiterhaufeu" iu dcr Berliuer National-
galerie, welches Bild zu neuen kvnfessionellen Strei-
tigkeiten Anlaß gab. Nach wciteren drei Jahrcn voll-
cndete er seinen „Luther, der die Bannbulle verbrennt",
ein nicht niinder nmfängliches Gcmälde, welches in
Privatbesitz überging und in der Villa eincs reichen
Holländers der allgcmeinen Besichtignng unzugänglich
bleibt. Doch tvurde es, wie die meisten bedcntendcrc»
Schopfungen Lessing's, durch Knpferstich verviclsältigt-
Das Gegenstück dazu: „Luther, die Thescn anhcftciid",
ist unseres Wissens nicht zur Ausführuug in Oelfarbcn
gelangt. Das lctztc bedeutende Historienbild, welchcs