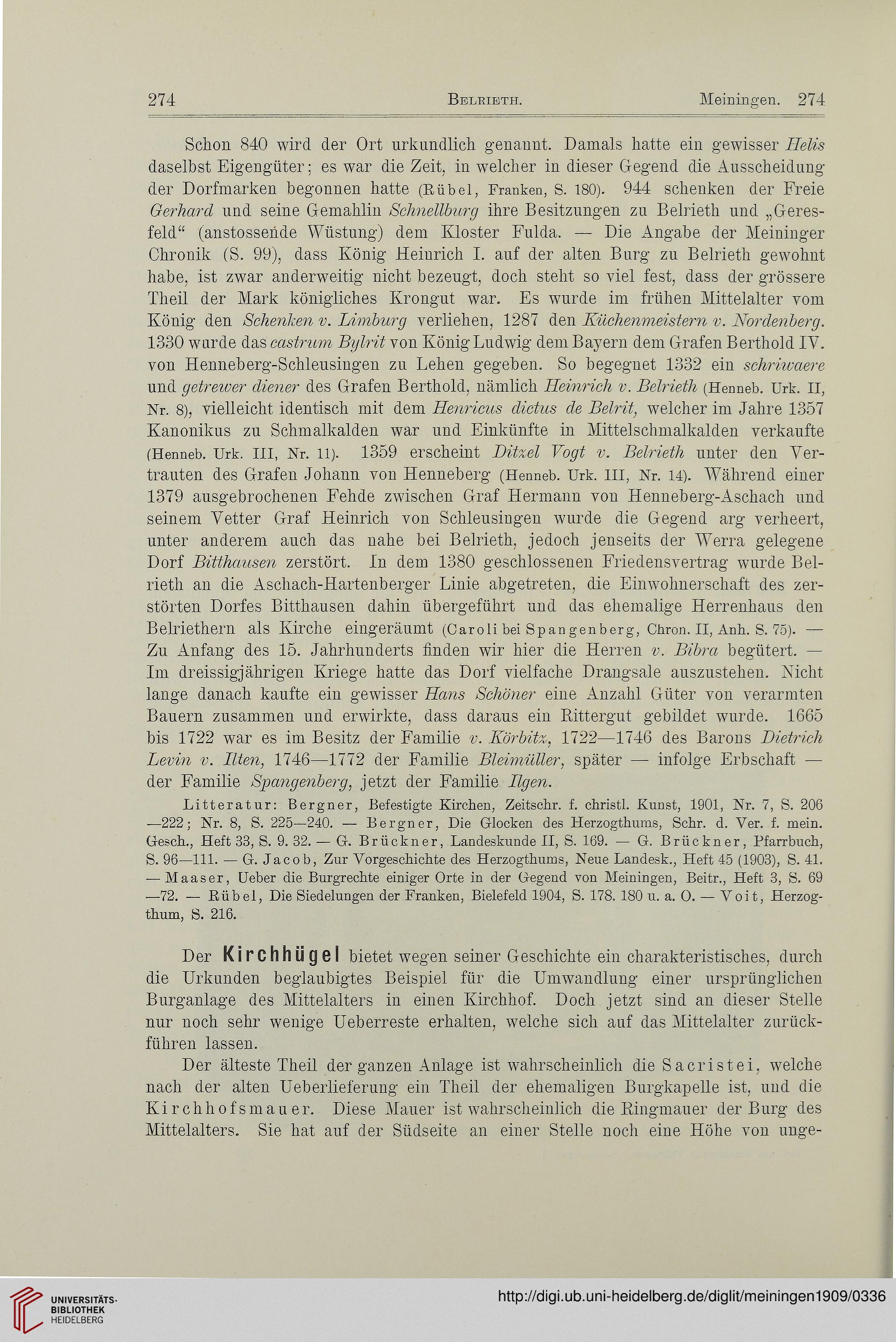274
Belrieth.
Meiningen. 274
Schon 840 wird der Ort urkundlich genannt. Damals hatte ein gewisser Helis
daselbst Eigengüter; es war die Zeit, in welcher in dieser Gegend die Ausscheidung
der Dorfmarken begonnen hatte (Rübel, Franken, S. 180). 944 schenken der Freie
Gerhard und seine Gemahlin Schnellburg ihre Besitzungen zu Belrieth und „Geres-
feld" (anstossende Wüstung) dem Kloster Fulda. — Die Angabe der Meininger
Chronik (S. 99). dass König Heinrich I. auf der alten Burg zu Belrieth gewohnt
habe, ist zwar anderweitig nicht bezeugt, doch steht so viel fest, dass der grössere
Theil der Mark königliches Krongut war. Es wurde im frühen Mittelalter vom
König den Schenken v. Limburg verliehen, 1287 den Küchenmeistern v. Nordenberg.
1330 wurde das Castrum Bylrit von König Ludwig dem Bayern dem Grafen Berthold IV.
von Henneberg-Schleusingen zu Lehen gegeben. So begegnet 1332 ein schrhcaere
und getreiver diener des Grafen Berthold, nämlich Heinrich v. Belrieth (Henneb. Urk. II,
Nr. 8), vielleicht identisch mit dem Henricus dictus de Belrit, welcher im Jahre 1357
Kanonikus zu Schmalkalden war und Einkünfte in Mittelschmalkalden verkaufte
(Henneb. Urk. III, Nr. 11). 1359 erscheint Ditxel Vogt v. Belrieth unter den Ver-
trauten des Grafen Johann von Henneberg (Henneb. Urk. III, Nr. 14). Während einer
1379 ausgebrochenen Fehde zwischen Graf Hermann von Henneberg-Aschach und
seinem Vetter Graf Heinrich von Schleusingen wurde die Gegend arg verheert,
unter anderem auch das nahe bei Belrieth, jedoch jenseits der Werra gelegene
Dorf Bitthausen zerstört. In dem 1380 geschlossenen Friedensvertrag wurde Bel-
rieth an die Aschach-Hartenberger Linie abgetreten, die Einwohnerschaft des zer-
störten Dorfes Bitthausen dahin übergeführt und das ehemalige Herrenhaus den
Belriethern als Kirche eingeräumt (Caroli bei Spangenberg, Chron. H, Anh. S. 75). —
Zu Anfang des 15. Jahrhunderts finden wir hier die Herren v. Bibra begütert. —
Im dreissigjährigen Kriege hatte das Dorf vielfache Drangsale auszustehen. Nicht
lange danach kaufte ein gewisser Hans Schöner eine Anzahl Güter von verarmten
Bauern zusammen und erwirkte, dass daraus ein Rittergut gebildet wurde. 1665
bis 1722 war es im Besitz der Familie v. Körbitz, 1722—1746 des Barons Dietrich
Levin v. Ilten, 1746—1772 der Familie Bleimüller, später — infolge Erbschaft —
der Familie Spangenberg, jetzt der Familie Ilgen.
Litteratur: Bergner, Befestigte Kirchen, Zeitschr. f. christl. Kunst, 1901, Nr. 7, S. 206
—222; Nr. 8, S. 225-240. — Bergner, Die Glocken des Herzogthums, Sehr. d. Ver. f. mein.
Gesch., Heft 33, S. 9. 32. — G. Brückner, Landeskunde II, S. 169. — G. Brückner, Pfarrbuch,
S. 96—111. — G. Jacob, Zur Vorgeschichte des Herzogthums, Neue Landesk., Heft 45 (1903), S. 41.
— Maaser, Ueber die Burgrechte einiger Orte in der Gegend von Meiningen, Beitr., Heft 3, S. 69
—72. — Eübel, Die Siedelungen der Franken, Bielefeld 1904, S. 178. 180 u. a. O. — Voit, Herzog-
thum, S. 216.
Der Kirchhügel bietet wegen seiner Geschichte ein charakteristisches, durch
die Urkunden beglaubigtes Beispiel für die Umwandlung einer ursprünglichen
Burganlage des Mittelalters in einen Kirchhof. Doch jetzt sind an dieser Stelle
nur noch sehr wenige Ueberreste erhalten, welche sich auf das Mittelalter zurück-
führen lassen.
Der älteste Theil der ganzen Anlage ist wahrscheinlich die Sacristei, welche
nach der alten Ueberlieferung ein Theil der ehemaligen Burgkapelle ist, und die
Kirchhofsinauer. Diese Mauer ist wahrscheinlich die Ringmauer der Burg des
Mittelalters. Sie hat auf der Südseite an einer Stelle noch eine Höhe von unge-
Belrieth.
Meiningen. 274
Schon 840 wird der Ort urkundlich genannt. Damals hatte ein gewisser Helis
daselbst Eigengüter; es war die Zeit, in welcher in dieser Gegend die Ausscheidung
der Dorfmarken begonnen hatte (Rübel, Franken, S. 180). 944 schenken der Freie
Gerhard und seine Gemahlin Schnellburg ihre Besitzungen zu Belrieth und „Geres-
feld" (anstossende Wüstung) dem Kloster Fulda. — Die Angabe der Meininger
Chronik (S. 99). dass König Heinrich I. auf der alten Burg zu Belrieth gewohnt
habe, ist zwar anderweitig nicht bezeugt, doch steht so viel fest, dass der grössere
Theil der Mark königliches Krongut war. Es wurde im frühen Mittelalter vom
König den Schenken v. Limburg verliehen, 1287 den Küchenmeistern v. Nordenberg.
1330 wurde das Castrum Bylrit von König Ludwig dem Bayern dem Grafen Berthold IV.
von Henneberg-Schleusingen zu Lehen gegeben. So begegnet 1332 ein schrhcaere
und getreiver diener des Grafen Berthold, nämlich Heinrich v. Belrieth (Henneb. Urk. II,
Nr. 8), vielleicht identisch mit dem Henricus dictus de Belrit, welcher im Jahre 1357
Kanonikus zu Schmalkalden war und Einkünfte in Mittelschmalkalden verkaufte
(Henneb. Urk. III, Nr. 11). 1359 erscheint Ditxel Vogt v. Belrieth unter den Ver-
trauten des Grafen Johann von Henneberg (Henneb. Urk. III, Nr. 14). Während einer
1379 ausgebrochenen Fehde zwischen Graf Hermann von Henneberg-Aschach und
seinem Vetter Graf Heinrich von Schleusingen wurde die Gegend arg verheert,
unter anderem auch das nahe bei Belrieth, jedoch jenseits der Werra gelegene
Dorf Bitthausen zerstört. In dem 1380 geschlossenen Friedensvertrag wurde Bel-
rieth an die Aschach-Hartenberger Linie abgetreten, die Einwohnerschaft des zer-
störten Dorfes Bitthausen dahin übergeführt und das ehemalige Herrenhaus den
Belriethern als Kirche eingeräumt (Caroli bei Spangenberg, Chron. H, Anh. S. 75). —
Zu Anfang des 15. Jahrhunderts finden wir hier die Herren v. Bibra begütert. —
Im dreissigjährigen Kriege hatte das Dorf vielfache Drangsale auszustehen. Nicht
lange danach kaufte ein gewisser Hans Schöner eine Anzahl Güter von verarmten
Bauern zusammen und erwirkte, dass daraus ein Rittergut gebildet wurde. 1665
bis 1722 war es im Besitz der Familie v. Körbitz, 1722—1746 des Barons Dietrich
Levin v. Ilten, 1746—1772 der Familie Bleimüller, später — infolge Erbschaft —
der Familie Spangenberg, jetzt der Familie Ilgen.
Litteratur: Bergner, Befestigte Kirchen, Zeitschr. f. christl. Kunst, 1901, Nr. 7, S. 206
—222; Nr. 8, S. 225-240. — Bergner, Die Glocken des Herzogthums, Sehr. d. Ver. f. mein.
Gesch., Heft 33, S. 9. 32. — G. Brückner, Landeskunde II, S. 169. — G. Brückner, Pfarrbuch,
S. 96—111. — G. Jacob, Zur Vorgeschichte des Herzogthums, Neue Landesk., Heft 45 (1903), S. 41.
— Maaser, Ueber die Burgrechte einiger Orte in der Gegend von Meiningen, Beitr., Heft 3, S. 69
—72. — Eübel, Die Siedelungen der Franken, Bielefeld 1904, S. 178. 180 u. a. O. — Voit, Herzog-
thum, S. 216.
Der Kirchhügel bietet wegen seiner Geschichte ein charakteristisches, durch
die Urkunden beglaubigtes Beispiel für die Umwandlung einer ursprünglichen
Burganlage des Mittelalters in einen Kirchhof. Doch jetzt sind an dieser Stelle
nur noch sehr wenige Ueberreste erhalten, welche sich auf das Mittelalter zurück-
führen lassen.
Der älteste Theil der ganzen Anlage ist wahrscheinlich die Sacristei, welche
nach der alten Ueberlieferung ein Theil der ehemaligen Burgkapelle ist, und die
Kirchhofsinauer. Diese Mauer ist wahrscheinlich die Ringmauer der Burg des
Mittelalters. Sie hat auf der Südseite an einer Stelle noch eine Höhe von unge-