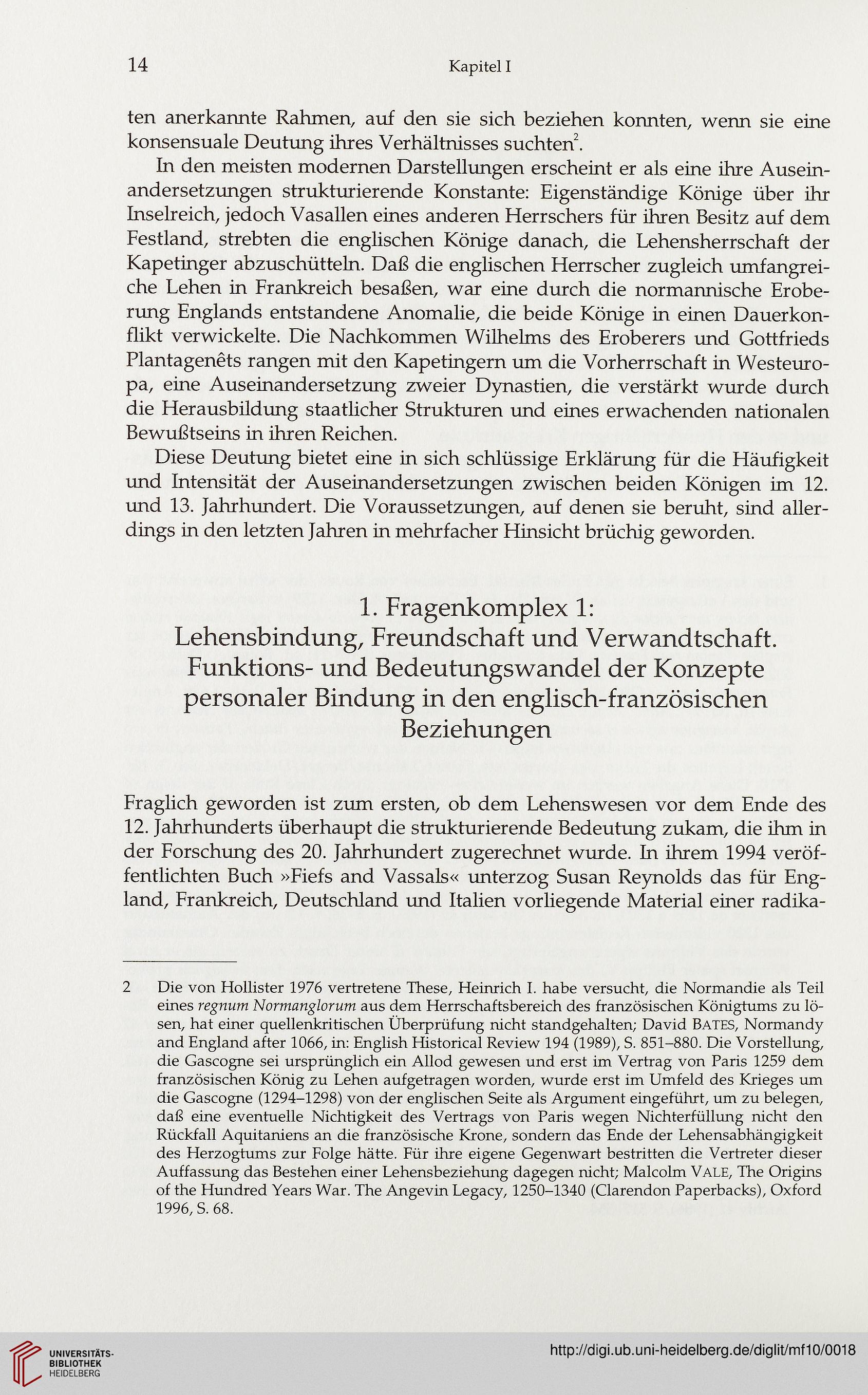14
Kapitel I
ten anerkannte Rahmen, auf den sie sich beziehen konnten, wenn sie eine
konsensuale Deutung ihres Verhältnisses suchten^.
In den meisten modernen Darstellungen erscheint er als eine ihre Ausein-
andersetzungen strukturierende Konstante: Eigenständige Könige über ihr
Inselreich, jedoch Vasallen eines anderen Herrschers für ihren Besitz auf dem
Festland, strebten die englischen Könige danach, die Lehensherrschaft der
Kapetinger abzuschütteln. Daß die englischen Herrscher zugleich umfangrei-
che Lehen in Frankreich besaßen, war eine durch die normannische Erobe-
rung Englands entstandene Anomalie, die beide Könige in einen Dauerkon-
flikt verwickelte. Die Nachkommen Wilhelms des Eroberers und Gottfrieds
Plantagenets rangen mit den Kapetingern um die Vorherrschaft in Westeuro-
pa, eine Auseinandersetzung zweier Dynastien, die verstärkt wurde durch
die Herausbildung staatlicher Strukturen und eines erwachenden nationalen
Bewußtseins in ihren Reichen.
Diese Deutung bietet eine in sich schlüssige Erklärung für die Häufigkeit
und Intensität der Auseinandersetzungen zwischen beiden Königen im 12.
und 13. Jahrhundert. Die Voraussetzungen, auf denen sie beruht, sind aller-
dings in den letzten Jahren in mehrfacher Hinsicht brüchig geworden.
1. Fragenkomplex 1:
Lehensbindung, Freundschaft und Verwandtschaft.
Funktions- und Bedeutungswandel der Konzepte
personaler Bindung in den englisch-französischen
Beziehungen
Fraglich geworden ist zum ersten, ob dem Lehenswesen vor dem Ende des
12. Jahrhunderts überhaupt die strukturierende Bedeutung zukam, die ihm in
der Forschung des 20. Jahrhundert zugerechnet wurde. In ihrem 1994 veröf-
fentlichten Buch »Fiefs and Vassais« unterzog Susan Reynolds das für Eng-
land, Frankreich, Deutschland und Italien vorliegende Material einer radika-
2 Die von Hollister 1976 vertretene These, Heinrich I. habe versucht, die Normandie als Teil
eines rcguuw NormangiorMm aus dem Herrschaftsbereich des französischen Königtums zu lö-
sen, hat einer quellenkritischen Überprüfung nicht standgehalten; David BATES, Normandy
and England after 1066, in: English Historical Review 194 (1989), S. 851-880. Die Vorstellung,
die Gascogne sei ursprünglich ein Allod gewesen und erst im Vertrag von Paris 1259 dem
französischen König zu Lehen aufgetragen worden, wurde erst im Umfeld des Krieges um
die Gascogne (1294-1298) von der englischen Seite als Argument eingeführt, um zu belegen,
daß eine eventuelle Nichtigkeit des Vertrags von Paris wegen Nichterfüllung nicht den
Rückfall Aquitaniens an die französische Krone, sondern das Ende der Lehensabhängigkeit
des Herzogtums zur Folge hätte. Für ihre eigene Gegenwart bestritten die Vertreter dieser
Auffassung das Bestehen einer Lehensbeziehung dagegen nicht; Malcolm VALE, The Origins
of the Hundred Years War. The Angevin Legacy, 1250-1340 (Clarendon Paperbacks), Oxford
1996, S. 68.
Kapitel I
ten anerkannte Rahmen, auf den sie sich beziehen konnten, wenn sie eine
konsensuale Deutung ihres Verhältnisses suchten^.
In den meisten modernen Darstellungen erscheint er als eine ihre Ausein-
andersetzungen strukturierende Konstante: Eigenständige Könige über ihr
Inselreich, jedoch Vasallen eines anderen Herrschers für ihren Besitz auf dem
Festland, strebten die englischen Könige danach, die Lehensherrschaft der
Kapetinger abzuschütteln. Daß die englischen Herrscher zugleich umfangrei-
che Lehen in Frankreich besaßen, war eine durch die normannische Erobe-
rung Englands entstandene Anomalie, die beide Könige in einen Dauerkon-
flikt verwickelte. Die Nachkommen Wilhelms des Eroberers und Gottfrieds
Plantagenets rangen mit den Kapetingern um die Vorherrschaft in Westeuro-
pa, eine Auseinandersetzung zweier Dynastien, die verstärkt wurde durch
die Herausbildung staatlicher Strukturen und eines erwachenden nationalen
Bewußtseins in ihren Reichen.
Diese Deutung bietet eine in sich schlüssige Erklärung für die Häufigkeit
und Intensität der Auseinandersetzungen zwischen beiden Königen im 12.
und 13. Jahrhundert. Die Voraussetzungen, auf denen sie beruht, sind aller-
dings in den letzten Jahren in mehrfacher Hinsicht brüchig geworden.
1. Fragenkomplex 1:
Lehensbindung, Freundschaft und Verwandtschaft.
Funktions- und Bedeutungswandel der Konzepte
personaler Bindung in den englisch-französischen
Beziehungen
Fraglich geworden ist zum ersten, ob dem Lehenswesen vor dem Ende des
12. Jahrhunderts überhaupt die strukturierende Bedeutung zukam, die ihm in
der Forschung des 20. Jahrhundert zugerechnet wurde. In ihrem 1994 veröf-
fentlichten Buch »Fiefs and Vassais« unterzog Susan Reynolds das für Eng-
land, Frankreich, Deutschland und Italien vorliegende Material einer radika-
2 Die von Hollister 1976 vertretene These, Heinrich I. habe versucht, die Normandie als Teil
eines rcguuw NormangiorMm aus dem Herrschaftsbereich des französischen Königtums zu lö-
sen, hat einer quellenkritischen Überprüfung nicht standgehalten; David BATES, Normandy
and England after 1066, in: English Historical Review 194 (1989), S. 851-880. Die Vorstellung,
die Gascogne sei ursprünglich ein Allod gewesen und erst im Vertrag von Paris 1259 dem
französischen König zu Lehen aufgetragen worden, wurde erst im Umfeld des Krieges um
die Gascogne (1294-1298) von der englischen Seite als Argument eingeführt, um zu belegen,
daß eine eventuelle Nichtigkeit des Vertrags von Paris wegen Nichterfüllung nicht den
Rückfall Aquitaniens an die französische Krone, sondern das Ende der Lehensabhängigkeit
des Herzogtums zur Folge hätte. Für ihre eigene Gegenwart bestritten die Vertreter dieser
Auffassung das Bestehen einer Lehensbeziehung dagegen nicht; Malcolm VALE, The Origins
of the Hundred Years War. The Angevin Legacy, 1250-1340 (Clarendon Paperbacks), Oxford
1996, S. 68.