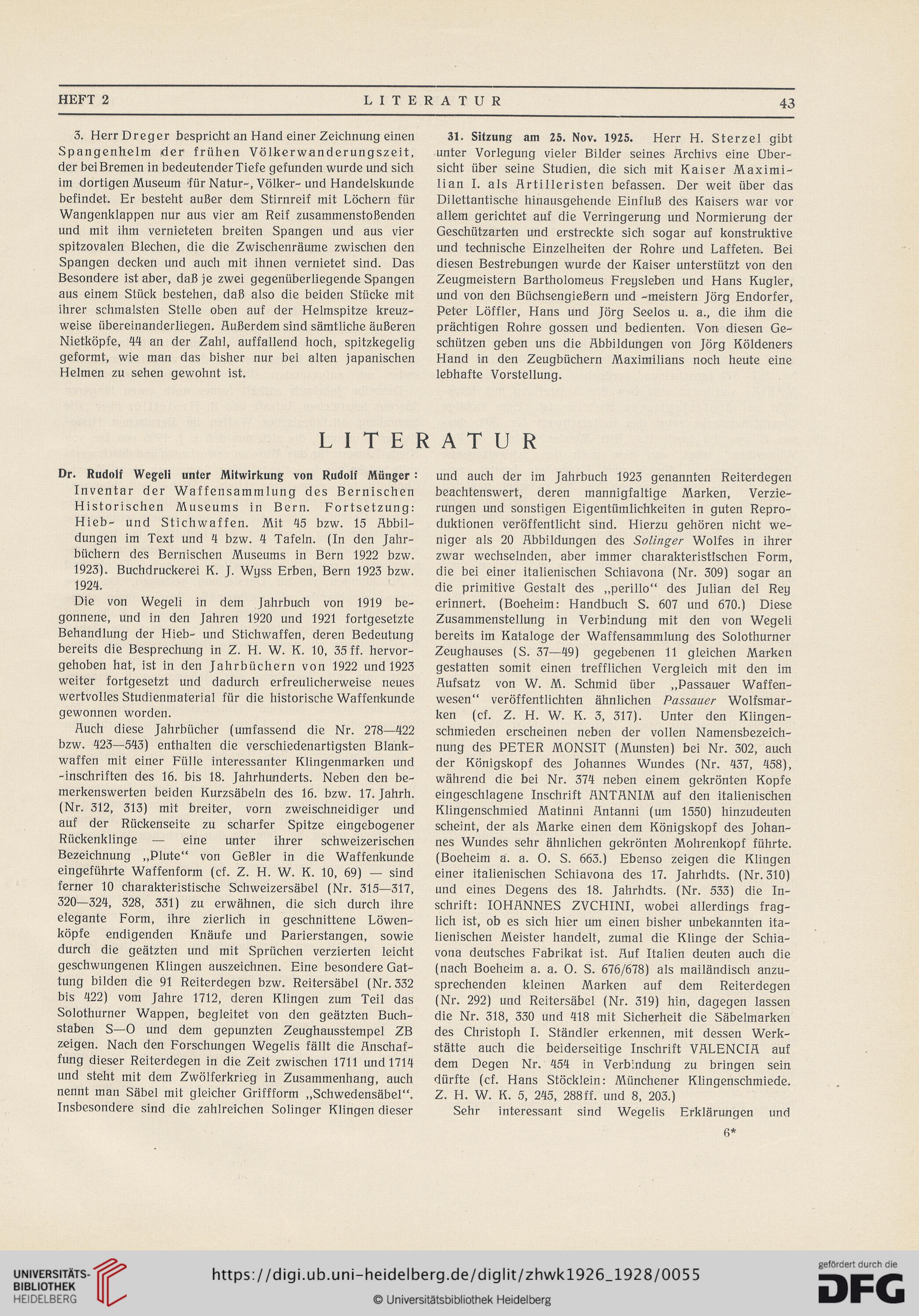HEFT 2
LITERATUR
43
3. HerrDreger bespricht an Hand einer Zeichnung einen
Spangenhelm der frühen Völkerwanderungszeit,
der beiBremen in bedeutender Tiefe gefunden wurde und sich
im dortigen Museum für Natur-, Völker-und Handelskunde
befindet. Er besteht außer dem Stirnreif mit Löchern für
Wangenklappen nur aus vier am Reif zusammenstoßenden
und mit ihm vernieteten breiten Spangen und aus vier
spitzovalen Blechen, die die Zwischenräume zwischen den
Spangen decken und auch mit ihnen vernietet sind. Das
Besondere ist aber, daß je zwei gegenüberliegende Spangen
aus einem Stück bestehen, daß also die beiden Stücke mit
ihrer schmälsten Stelle oben auf der Helmspitze kreuz-
weise übereinanderliegen. Außerdem sind sämtliche äußeren
Nietköpfe, 44 an der Zahl, auffallend hoch, spitzkegelig
geformt, wie man das bisher nur bei alten japanischen
Helmen zu sehen gewohnt ist.
31. Sitzung am 25. Nov. 1925. Herr H. Sterzei gibt
unter Vorlegung vieler Bilder seines Archivs eine Über-
sicht über seine Studien, die sich mit Kaiser Maximi-
lian I. als Artilleristen befassen. Der weit über das
Dilettantische hinausgehende Einfluß des Kaisers war vor
allem gerichtet auf die Verringerung und Normierung der
Geschützarten und erstreckte sich sogar auf konstruktive
und technische Einzelheiten der Rohre und Laffeten. Bei
diesen Bestrebungen wurde der Kaiser unterstützt von den
Zeugmeistern Bartholomeus Freysleben und Hans Kugler,
und von den Büchsengießern und -meistern Jörg Endorfer,
Peter Löffler, Hans und Jörg Seelos u. a., die ihm die
prächtigen Rohre gossen und bedienten. Von diesen Ge-
schützen geben uns die Abbildungen von Jörg Köldeners
Hand in den Zeugbüchern Maximilians noch heute eine
lebhafte Vorstellung.
LITERATUR
Dr. Rudolf Wegeli unter Mitwirkung von Rudolf Münger :
Inventar der Waffensammlung des Bernischen
Historischen Museums in Bern. Fortsetzung:
Hieb- und Stichwaffen. Mit 45 bzw. 15 Abbil-
dungen im Text und 4 bzw. 4 Tafeln. (In den Jahr-
büchern des Bernischen Museums in Bern 1922 bzw.
1923). Buchdruckerei K. J. Wyss Erben, Bern 1923 bzw.
1924.
Die von Wegeli in dem Jahrbuch von 1919 be-
gonnene, und in den Jahren 1920 und 1921 fortgesetzte
Behandlung der Hieb- und Stichwaffen, deren Bedeutung
bereits die Besprechung in Z. H. W. K. 10, 35 ff. hervor-
gehoben hat, ist in den Jahrbüchern von 1922 und 1923
weiter fortgesetzt und dadurch erfreulicherweise neues
wertvolles Studienmaterial für die historische Waffenkunde
gewonnen worden.
Auch diese Jahrbücher (umfassend die Nr. 278—422
bzw. 423—543) enthalten die verschiedenartigsten Blank-
waffen mit einer Fülle interessanter Klingenmarken und
-Inschriften des 16. bis 18. Jahrhunderts. Neben den be-
merkenswerten beiden Kurzsäbeln des 16. bzw. 17. Jahrh.
(Nr. 312, 313) mit breiter, vorn zweischneidiger und
auf der Rückenseite zu scharfer Spitze eingebogener
Rückenklinge — eine unter ihrer schweizerischen
Bezeichnung „Plute“ von Geßler in die Waffenkunde
eingeführte Waffenform (cf. Z. H. W. K. 10, 69) — sind
ferner 10 charakteristische Schweizersäbel (Nr. 315—317,
320—324, 328, 331) zu erwähnen, die sich durch ihre
elegante Form, ihre zierlich in geschnittene Löwen-
köpfe endigenden Knäufe und Parierstangen, sowie
durch die geätzten und mit Sprüchen verzierten leicht
geschwungenen Klingen auszeichnen. Eine besondere Gat-
tung bilden die 91 Reiterdegen bzw. Reitersäbel (Nr. 332
bis 422) vom Jahre 1712, deren Klingen zum Teil das
Solothurner Wappen, begleitet von den geätzten Buch-
staben S—O und dem gepunzten Zeughausstempel ZB
zeigen. Nach den Forschungen Wegelis fällt die Anschaf-
fung dieser Reiterdegen in die Zeit zwischen 1711 und 1714
und steht mit dem Zwölferkrieg in Zusammenhang, auch
nennt man Säbel mit gleicher Griffform „Schwedensäbel“.
Insbesondere sind die zahlreichen Solinger Klingen dieser
und auch der im Jahrbuch 1923 genannten Reiterdegen
beachtenswert, deren mannigfaltige Marken, Verzie-
rungen und sonstigen Eigentümlichkeiten in guten Repro-
duktionen veröffentlicht sind. Hierzu gehören nicht we-
niger als 20 Abbildungen des Solinger Wolfes in ihrer
zwar wechselnden, aber immer charakteristischen Form,
die bei einer italienischen Schiavona (Nr. 309) sogar an
die primitive Gestalt des „perillo“ des Julian del Rey
erinnert. (Boeheim: Handbuch S. 607 und 670.) Diese
Zusammenstellung in Verbindung mit den von Wegeli
bereits im Kataloge der Waffensammlung des Solothurner
Zeughauses (S. 37—49) gegebenen 11 gleichen Marken
gestatten somit einen trefflichen Vergleich mit den im
Aufsatz von W. M. Schmid über „Passauer Waffen-
wesen“ veröffentlichten ähnlichen Passauer Wolfsmar-
ken (cf. Z. H. W. K. 3, 317). Unter den Klingen-
schmieden erscheinen neben der vollen Namensbezeich-
nung des PETER MONSIT (Munsten) bei Nr. 302, auch
der Königskopf des Johannes Wundes (Nr. 437, 458),
während die bei Nr. 374 neben einem gekrönten Kopfe
eingeschlagene Inschrift ANTANIM auf den italienischen
Klingenschmied Matinni Antanni (um 1550) hinzudeuten
scheint, der als Marke einen dem Königskopf des Johan-
nes Wundes sehr ähnlichen gekrönten Mohrenkopf führte.
(Boeheim a. a. O. S. 663.) Ebenso zeigen die Klingen
einer italienischen Schiavona des 17. Jahrhdts. (Nr. 310)
und eines Degens des 18. Jahrhdts. (Nr. 533) die In-
schrift: IOHANNES ZVCHINI, wobei allerdings frag-
lich ist, ob es sich hier um einen bisher unbekannten ita-
lienischen Meister handelt, zumal die Klinge der Schia-
vona deutsches Fabrikat ist. Auf Italien deuten auch die
(nach Boeheim a. a. O. S. 676/678) als mailändisch anzu-
sprechenden kleinen Marken auf dem Reiterdegen
(Nr. 292) und Reitersäbel (Nr. 319) hin, dagegen lassen
die Nr. 318, 330 und 418 mit Sicherheit die Säbelmarken
des Christoph I. Ständler erkennen, mit dessen Werk-
stätte auch die beiderseitige Inschrift VALENCIA auf
dem Degen Nr. 454 in Verbindung zu bringen sein
dürfte (cf. Hans Stöcklein: Münchener Klingenschmiede.
Z. H. W. K. 5, 245, 288ff. und 8, 203.)
Sehr interessant sind Wegelis Erklärungen und
6*
LITERATUR
43
3. HerrDreger bespricht an Hand einer Zeichnung einen
Spangenhelm der frühen Völkerwanderungszeit,
der beiBremen in bedeutender Tiefe gefunden wurde und sich
im dortigen Museum für Natur-, Völker-und Handelskunde
befindet. Er besteht außer dem Stirnreif mit Löchern für
Wangenklappen nur aus vier am Reif zusammenstoßenden
und mit ihm vernieteten breiten Spangen und aus vier
spitzovalen Blechen, die die Zwischenräume zwischen den
Spangen decken und auch mit ihnen vernietet sind. Das
Besondere ist aber, daß je zwei gegenüberliegende Spangen
aus einem Stück bestehen, daß also die beiden Stücke mit
ihrer schmälsten Stelle oben auf der Helmspitze kreuz-
weise übereinanderliegen. Außerdem sind sämtliche äußeren
Nietköpfe, 44 an der Zahl, auffallend hoch, spitzkegelig
geformt, wie man das bisher nur bei alten japanischen
Helmen zu sehen gewohnt ist.
31. Sitzung am 25. Nov. 1925. Herr H. Sterzei gibt
unter Vorlegung vieler Bilder seines Archivs eine Über-
sicht über seine Studien, die sich mit Kaiser Maximi-
lian I. als Artilleristen befassen. Der weit über das
Dilettantische hinausgehende Einfluß des Kaisers war vor
allem gerichtet auf die Verringerung und Normierung der
Geschützarten und erstreckte sich sogar auf konstruktive
und technische Einzelheiten der Rohre und Laffeten. Bei
diesen Bestrebungen wurde der Kaiser unterstützt von den
Zeugmeistern Bartholomeus Freysleben und Hans Kugler,
und von den Büchsengießern und -meistern Jörg Endorfer,
Peter Löffler, Hans und Jörg Seelos u. a., die ihm die
prächtigen Rohre gossen und bedienten. Von diesen Ge-
schützen geben uns die Abbildungen von Jörg Köldeners
Hand in den Zeugbüchern Maximilians noch heute eine
lebhafte Vorstellung.
LITERATUR
Dr. Rudolf Wegeli unter Mitwirkung von Rudolf Münger :
Inventar der Waffensammlung des Bernischen
Historischen Museums in Bern. Fortsetzung:
Hieb- und Stichwaffen. Mit 45 bzw. 15 Abbil-
dungen im Text und 4 bzw. 4 Tafeln. (In den Jahr-
büchern des Bernischen Museums in Bern 1922 bzw.
1923). Buchdruckerei K. J. Wyss Erben, Bern 1923 bzw.
1924.
Die von Wegeli in dem Jahrbuch von 1919 be-
gonnene, und in den Jahren 1920 und 1921 fortgesetzte
Behandlung der Hieb- und Stichwaffen, deren Bedeutung
bereits die Besprechung in Z. H. W. K. 10, 35 ff. hervor-
gehoben hat, ist in den Jahrbüchern von 1922 und 1923
weiter fortgesetzt und dadurch erfreulicherweise neues
wertvolles Studienmaterial für die historische Waffenkunde
gewonnen worden.
Auch diese Jahrbücher (umfassend die Nr. 278—422
bzw. 423—543) enthalten die verschiedenartigsten Blank-
waffen mit einer Fülle interessanter Klingenmarken und
-Inschriften des 16. bis 18. Jahrhunderts. Neben den be-
merkenswerten beiden Kurzsäbeln des 16. bzw. 17. Jahrh.
(Nr. 312, 313) mit breiter, vorn zweischneidiger und
auf der Rückenseite zu scharfer Spitze eingebogener
Rückenklinge — eine unter ihrer schweizerischen
Bezeichnung „Plute“ von Geßler in die Waffenkunde
eingeführte Waffenform (cf. Z. H. W. K. 10, 69) — sind
ferner 10 charakteristische Schweizersäbel (Nr. 315—317,
320—324, 328, 331) zu erwähnen, die sich durch ihre
elegante Form, ihre zierlich in geschnittene Löwen-
köpfe endigenden Knäufe und Parierstangen, sowie
durch die geätzten und mit Sprüchen verzierten leicht
geschwungenen Klingen auszeichnen. Eine besondere Gat-
tung bilden die 91 Reiterdegen bzw. Reitersäbel (Nr. 332
bis 422) vom Jahre 1712, deren Klingen zum Teil das
Solothurner Wappen, begleitet von den geätzten Buch-
staben S—O und dem gepunzten Zeughausstempel ZB
zeigen. Nach den Forschungen Wegelis fällt die Anschaf-
fung dieser Reiterdegen in die Zeit zwischen 1711 und 1714
und steht mit dem Zwölferkrieg in Zusammenhang, auch
nennt man Säbel mit gleicher Griffform „Schwedensäbel“.
Insbesondere sind die zahlreichen Solinger Klingen dieser
und auch der im Jahrbuch 1923 genannten Reiterdegen
beachtenswert, deren mannigfaltige Marken, Verzie-
rungen und sonstigen Eigentümlichkeiten in guten Repro-
duktionen veröffentlicht sind. Hierzu gehören nicht we-
niger als 20 Abbildungen des Solinger Wolfes in ihrer
zwar wechselnden, aber immer charakteristischen Form,
die bei einer italienischen Schiavona (Nr. 309) sogar an
die primitive Gestalt des „perillo“ des Julian del Rey
erinnert. (Boeheim: Handbuch S. 607 und 670.) Diese
Zusammenstellung in Verbindung mit den von Wegeli
bereits im Kataloge der Waffensammlung des Solothurner
Zeughauses (S. 37—49) gegebenen 11 gleichen Marken
gestatten somit einen trefflichen Vergleich mit den im
Aufsatz von W. M. Schmid über „Passauer Waffen-
wesen“ veröffentlichten ähnlichen Passauer Wolfsmar-
ken (cf. Z. H. W. K. 3, 317). Unter den Klingen-
schmieden erscheinen neben der vollen Namensbezeich-
nung des PETER MONSIT (Munsten) bei Nr. 302, auch
der Königskopf des Johannes Wundes (Nr. 437, 458),
während die bei Nr. 374 neben einem gekrönten Kopfe
eingeschlagene Inschrift ANTANIM auf den italienischen
Klingenschmied Matinni Antanni (um 1550) hinzudeuten
scheint, der als Marke einen dem Königskopf des Johan-
nes Wundes sehr ähnlichen gekrönten Mohrenkopf führte.
(Boeheim a. a. O. S. 663.) Ebenso zeigen die Klingen
einer italienischen Schiavona des 17. Jahrhdts. (Nr. 310)
und eines Degens des 18. Jahrhdts. (Nr. 533) die In-
schrift: IOHANNES ZVCHINI, wobei allerdings frag-
lich ist, ob es sich hier um einen bisher unbekannten ita-
lienischen Meister handelt, zumal die Klinge der Schia-
vona deutsches Fabrikat ist. Auf Italien deuten auch die
(nach Boeheim a. a. O. S. 676/678) als mailändisch anzu-
sprechenden kleinen Marken auf dem Reiterdegen
(Nr. 292) und Reitersäbel (Nr. 319) hin, dagegen lassen
die Nr. 318, 330 und 418 mit Sicherheit die Säbelmarken
des Christoph I. Ständler erkennen, mit dessen Werk-
stätte auch die beiderseitige Inschrift VALENCIA auf
dem Degen Nr. 454 in Verbindung zu bringen sein
dürfte (cf. Hans Stöcklein: Münchener Klingenschmiede.
Z. H. W. K. 5, 245, 288ff. und 8, 203.)
Sehr interessant sind Wegelis Erklärungen und
6*