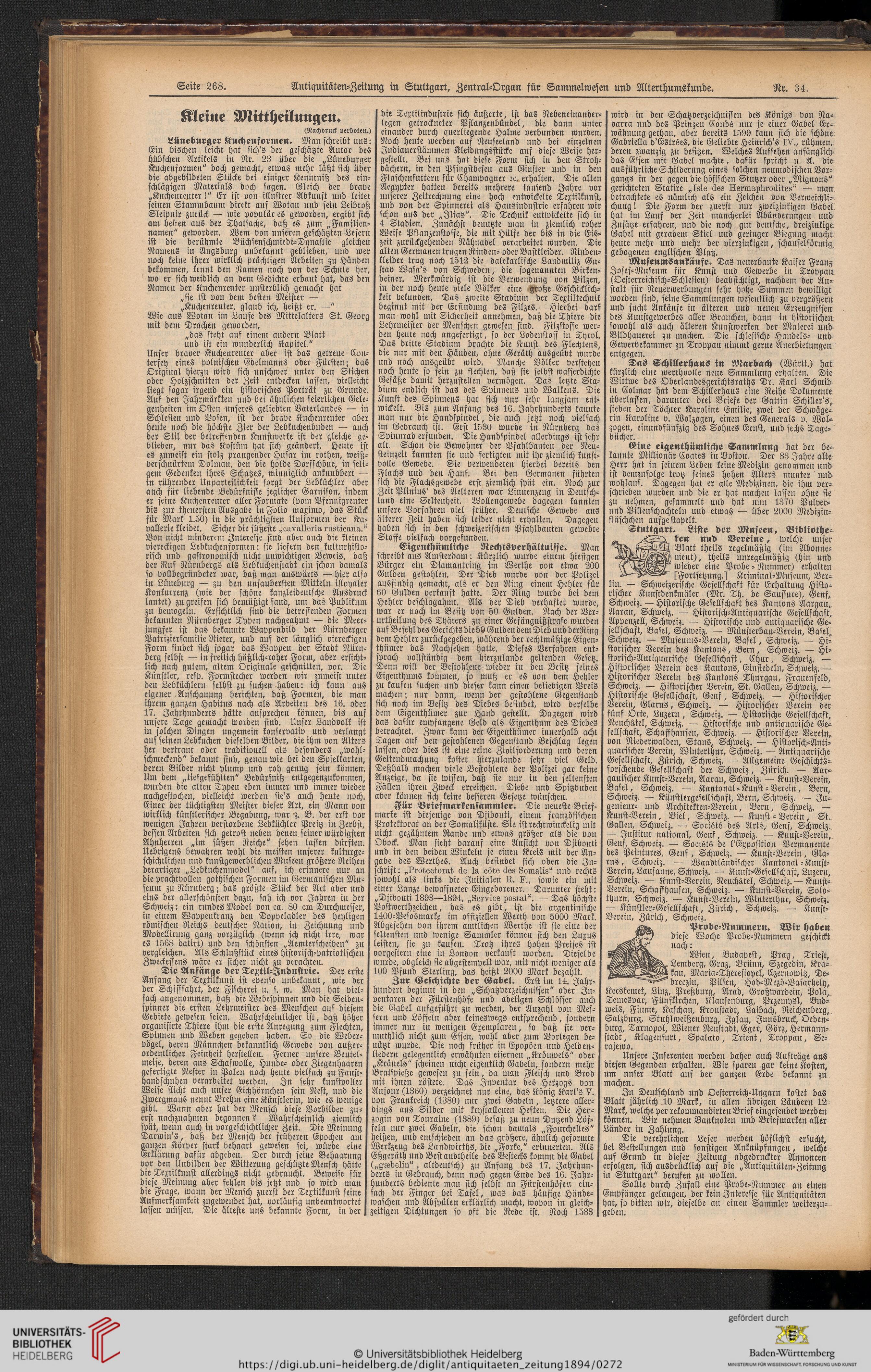Seite 268.
N DE,
Kleine Mittheilungen.
MNachdruck verboten.)
Lüneburger Kuchenformen. Man ſchreibt uns:
Ein bischen leicht hat ſich's der geſchätzte Autor des
huͤbſchen Artikels in Nr. 23 über die „Lüneburger
Kuchenformen“ doch gemacht, etwas mehr läßt ſich über
die abgebildeten Stücke bei einiger Kenntniß des ein-
ſchlägigen Materials doch ſagen. Gleich der brave
Kuchenreuter!“ Er iſt von illuſtrer Abkunft und leitet
ſeinen Stammbaum direkt auf Wotan und ſein Leibroß
Sleipnir zurück — wie populär es geworden, ergibt ſich
am beiten aus der Thatſache, daß es zum „Familien-
namen“ geworden. Wem von unſeren geſchätzten Leſern
iſt die berühmte Büchſenſchmiede⸗Dhnaſtie gleichen
Namens in Augsburg unbekannt geblieben, und wer
noch keine ihrer wirklich prächtigen Arbeiten zu Händen
bekommen, kennt den Namen noͤch von der Schule her,
wo er ſich weidlich an dem Gedichte erbaut hat, das den
Namen der Kuchenreuter unſterblich gemacht hat
„ſie iſt von dem beſten Meiſter —
Kuchenreuter, glaub ich, heißt er. —“
Wie aus Wotan im Laufe des Mittelalters St. Georg
mit dem Drachen geworden,
„das ſteht auf einem andern Blatt
und iſt ein wunderlich Kapitel.“
Unſer braver Kuchenreuter aber iſt das getreue Con-
terfey eines polniſchen Edelmanns oder Fürften; das
Original hierzu wird ſich unſchwer unter den Stichen
oder Holzſchnitten der Zeit entdecken laſſen, vielleicht
liegt ſogar irgend ein hiſtoriſches Porträt zu Grunde.
Auf den Jahemärkten und bei ähnlichen feierlichen Gele-
genheiten im Oſten unſeres geliebten Vaterlandes — in
Schleſien und Poſen, iſt der brave Kuchenreuter aber
heute noch die höchſte Zier der Lebkuchenbuden — auch
der Stil der betreffenden Kunſtwerke iſt der gleiche ge-
blieben, nur das Koſtüm hat ſich geändert. Heute iſt
es zumeift ein ſtols prangender Huſar im rothen, weiß-
verſchnürtem Dolman, den die hoͤlde Dorfichöne, in ſeli-
gem Gedenken ihres Schatzes, minniglich anknubbert —
in xührender Unparxteilichkeit ſorgt der Lebküchler aber
auch für liebende Bedürfniſſe jeglicher Garniſon, indem
er ſeine Kuchenreuter aller Formate (vom Pfennigreuter
bis zur theuerſten Ausgabe in Folio maximo, das Stück
für Mark 1.50) in die prächtigſten Uniformen der Ka-
vallerie kleidet. Sicher die Jüßelte „cavalleria rusticana.“
Von nicht minderem Intereſſe ſind aber auch die kleinen
viereckigen Lebkuchenformen: ſie liefern den kulturhiſto-
riſch und gaſtronomiſch nicht unwichtigen Beweis, daß
der Ruf Nürnbergs als Lebkuchenſtadt ein ſchon damals
ſo vollbegründeter war, daß man auswärts — hier alſo
in Lüneburg — zu den unſauherſten Mitteln illohaler
Konkurrenz (wie der ſchoͤne kanzleideutſche Ausdruck
lautet) zu greifen ſich bemüßigt fand, um das Publikum
zu bemogeln. Erſichtlich ſind die betreffenden Formen
bekannten Nürnberger Typen nachgeahmt — die Meer-
jungfer iſt das hekannte Wappenbild der Nürnberger
Patrizierfamilie Rieter, und auf der länglich viereckigen
Form findet ſich ſogar das Wappen der Stadt Nürn-
berg ſelbſt — in freilich häßlich-roher Form, aber erſicht-
ach na gutem, altem Originale geſchnitten, vor. Die
Künſtler, reſp. Formſtecher werden wir zumeiſt unter
den Lebkuͤchlern ſelbſt zu ſuchen haben: ich kann aus
eigener Anſchauung berichten, daß Formen, die man
ihrem gaͤnzen Habitus nach als Arbeiten des 16. oder
17. Jaͤhrhunderts hätte anſprechen können, bis auf
unſere Tage gemacht worden ſind. Unſer Laͤndvolk iſt
in ſolchen Dingen ungemein konſervativ und verlangt
auf ſeinen Lebkuchen dieſelben Bilder, die ihm von Alters
her vertraut oder traditionell als beſonders „wohl-
ſchmeckend“ bekannt ſind, genau wie bei den Spieltarten,
deren Bilder nicht plump und roh genug ſein können.
Um dem „tiefgefühlten“ Bedürfniß entgegenzukommen,
wurden die allen Typen eben immer und immer wieder
nachgeſtochen, vielleicht werden ſie's auch heute noch.
Einer der tüchtigjten Meiſter dieſer Art, ein Mann von
wirklich künſtleriſcher Begabung, war 3. B. der erſt vor
wenigen Jahren verſtorbene Lebküchler Preitz in Zerbſt,
deſſen Arbeiten ſich getroſt neben denen ſeiner würdigſten
Ahnherren „im füßen Reiche“ ſehen laſſen dürften.
Uebrigens bewahren wohl die meiſten unſerer kulturge-
ſchichtlichen und kunſtgewerblichen Muſeen größere Reihen
die prachtvollen gothiſchen Formen im Germaniſchen Mu-
ſeum zu Nürnberg; das größte Stück der Art aber und
eins der allerſchönſten dazu, ſah ich vor Jahren in der
Schweiz: ein rundes Model von ca. 80 em Durchmeſſer,
in einem Wappenkranz den Doppeladler des heyligen
roͤmiſchen Reichs deutſchex Nation, in Zeichnung und
Modellirung ganz vorzüglich (wenn ich nicht irre, war
es 1568 datirh und den ſchönſten „Aemterſcheihen! zu
vergleichen. Als Schlußſtück eines hiſtoriſch⸗patriotiſchẽn
Zweckeſſens wäre er ſicher nicht zu verachten.
Die Aufänge der Textil⸗Induſtrie. Der erſte
Anfang der Tertilkunit iſt ebenſo unbekannt, wie der
der Schifffahrt, der Fiſcherei u. ſ. w. Man hat viel-
fach angenommen, daß die Webeſpinnen und die Seiden-
ſpinner die erſten Lehrmeiſter des Menſchen auf dieſem
Gebiete geweſen ſeien. Wahrſcheinlicher iſt, daß höher
organiſirle Thiere ihm die erſte Anregung zum Flechten,
Spinnen und Weben gegeben haben. So die Weber-
vögel, deren Männchen bekanntlich Gewebe von außer-
ordentlicher Feinheit herſtellen. Ferner unſere Beutel-
meiſe, deren aus Schafwolle, Hunde⸗ oder Ziegenhaaren
gefextigte Neſter in Polen noch heute vielfach zu Fauſt-
handſchuhen verarbeitet werden. In ſehr kuͤnſtboller
Veiſe flicht auch unſer Eichhörnchen ſein Neſt, und die
Zwergwaus nennt Brehm eine Künftlerin, wie e& wenige
giht. Wann aber hat der Menſch dieſe Vorbilder zuͤ—
erſt nachzuahmen begonnen? Wahrſcheinlich ziemlich
wät, wenn auch in vorgeſchichtlicher Zeit. Die Meinung
Darwins, daß der Menſch der fruͤheren Epochen am
ganzen Körper ſtark behaart geweſen ſei, würde eine
Erklärung dafür abgeben Der durch feine Behaarung
vor den Unbilden der Witterung geſchützte Menſch hätte
die Textilkunſt allerdings nicht gebraucht. Beweiſe für
dieſe Meinung aber fehlen bis ſetzt und ſo wird man
die Frage, wann der Menſch zuerſt der Textilkunſt feine
Aufmerkſamkeit zugewendet hat, vorläufig unbeantwoͤrtet
laſfen müſſen. Die älteſte uns bekanntẽ Form, in der
die Textilinduſtrie ſich äußerte, iſt das Nebeneinander-
legen getrockneter Pflanzenbündel, die dann unter
einander durch querliegende Halme verbunden wurden.
Loch heute werden auf Neuſeeland und bei einzelnen
Indianerſtämmen Kleidungsſtücke auf dieſe Weiſe her-
geſtellt. Bei uns hat dieſe Form ſich in den Stroh-
dächern, in den Pfingſtbeſen aus Ginſter und in den
Flaſchenfuttern für Champagner 2c.. erhalten. Die alten
Aegypter hatten bereits mehrere tauſend Jahre vor
unferer Zeitrechnung eine hoch entwickelte Textilkunſt,
und von der Spinnerei als Hausinduſtrie erfahren wir
ſchon aus der „Ilias“. Die Technik entwickelte ſich in
LStadien. Zunächſt benutzte man in ziemlich roͤher
Weiſe Pflanzenſtoffe, die mit Hülfe der bis in die Eis-
zeit zurückgehenden Nähnadel verarbeitet wurden. Die
alten Germanen trugen Rinden- oder Baſtkleider. Rinden-
kleider trug noch 1512 die dalekarliſche Landmiliz Gu-
ſtav Waſas von Schweden, die ſogenannten Birken-
beiner. Merkwürdig iſt die Verwendung von Pilzen,
in der noch heute viele Völker eine MtoBe Geſchicklich-
keit bekunden. Das zweite Stadium der Textiltechnit
beginnt mit der Erfindung des Filzes. Hierbei darf
man wohl mit Sicherheit annehmen, daß die Thiere die
Lehrmeiſter der Menſchen geweſen ſind. Filzſtoffe wer-
den heute noch angefertigt! ſo der Lodenſtoff in Tyrol.
Das dritte Stadiam brachte die Kunſt des Flechtens,
die nur mit den Händen, ohne Geräth ausgelibt wurde
und noch ausgeübt wird. Manche Bölker verſtehen
noch heute ſo fein zu flechten, daß ſie ſelbſt waſſerdichte
Gefäße damit herzuͤſtellen vermögen. Das letzte Sta-
dium endlich iſt das des Spinneus und Walkens. Die
Kunſt des Spinnens hat ſich nur ſehr langſam ent-
wickelt. Bis zum Anfang des 16. Jaͤhrhunderts kannte
man nur die Handſpindel, die auch jetzt noch vielfach
im Gebrauch iſt. Erſt 1530 wurde in Nürnberg das
Spinnrad erfunden. Die Handſpindel allerdings ift ſehr
alt. Schon die Bewohner der Pfahlbauten der Neu-
ſteinzeit kannten ſie und fertigten mit ihr ziemlich kunſt-
volle Gewebe. Sie verwendeten hierbei bereits den
Flachs und den Hanf. Bei den Germanen führten
ſich die Flachsgewehe erſt ziemlich ſpät ein. Noch zur
Zeit Plinius’ des Aelteren war Linnenzeug in Deutſch-
land eine Seltenheit. Wollengewebe dagegen kaͤnnten
unſere Vorfahren viel früher. Deutſche Gewebe aus
älterer Zeit haben ſich leidex nicht erhalten. Dagegen
haben ſich in den ſchweizeriſchen Pfahlbauten gewebte
Stoffe vielfach vorgefunden.
Eigenthümliche Nechtsverhältuiſſe. Man
ſchreibt aus Amfterdam : Kürzlich wurde einem hieſigen
Bürger ein Diamantring im Werthe von etwa 200
Gulden geſtohlen. Der Dieb wurde von der Polizei
ausfindig gemacht, als er den Ring einem Hehler für
60 Gulden verkauft hatte. Der Ring wurde bei dem
Hehler beſchlagahmt. Als der Dieb verhaftet wurde,
war er noch im Beſitz von 50 Gulden! Nach der Ver-
urtheilung des Thäters zu einer Gefängnißſtraͤfe wurden
auf Befehl des Gexichts dies0 Gulden dem Dieb und derRing
dem Hehler zurückgegeben, während der rehtmäßige Eigen-
thümer das Nachfehen hatte. Dieſes Verfaͤhren ent-
ſprach vollſtändig dem hierzulande geltenden Geſetz.
Denn will der Veſtohlent wieder in den Beſttz ſeines
Eigenthums kommen, ſo muß er es von deni Hehler
zu kaufen ſuchen und dieſer kaͤnn einen beliebigen Preis
machen; nur dann, wenn der geſtohlene Gegenſtand
ſich noch im Beſitz des Diebes befindet, wird derfelbe
dem Eigenthümer zur Hand geſtellt. Dagegen wird
das dafuͤr empfangene Geld als Eigenthum des Diebes
betrachtet. Zwar kann der Eigenthuͤmer innerhalb acht
Tagen auf den geſtohlenen Gegenſtand Beſchlaͤg legen
laſſen, aber dies iſt eine reine Zivilforderung und deren
Seltendmachung koſtet hierzulande ſehr viel Geld.
Deßhalb machen viele Beſtohlene der Poͤltzei gar keine
Anzeige, da ſie wiſſen, daß ſie nur in den ſeltenſten
Fällen ihren Zweck erreichen. Diebe und Spitzbuben
aber können ſich keine beſſeren Geſetze wünſchen.
Für Briefmarkeufammiler. Die neueſte Brief-
marke iſt diejenige von Dfibouti, einem franzöſiſchen
Protektorat an der Somaliklſte. Ste iſt vechtwinckelig mit
nicht gezähntem Rande und etwas größer als die von
Ohock. Man ſieht darauf eine Anſicht von Djibouti
und in den beiden Winkeln je einen Kreis mit der An-
gabe des Werthes. Auch befindet ſich oben die In-
ſchrift:„Protectorat de la cöte des Somalis“ und rechts
ſowohl als links die Initialen R. F., ſowie ein mit
einer Lanze bewaffneter Eingeborener. Darunter ſteht:
Diibouti 1893—1894, „Service postal“. — Das höchſte
Poſtwerthzeichen, das es gibt, i{t die argentiniſche
1400-BefoSmarke im offiziellen Werth von 5000 Mark.
Abgeſehen von ihrem amtlichen Werthe iſt ſie eine der
ſeltenſten und wenige Sammler können ſich den Luxus
leiſten, ſie zu kaufen. Trotz ihres hohen Preiſes iſt
vorgeſtern eine in London verkauft worden. Dieſelbe
wurde, obgleich ſie abgeſtempelt war mit nicht weniger als
100 Pfund Sterling, das heißt 2000 Mark bezahlt.
Zur Geſchichte der Gabel. Erſt im 14. Jahr-
hundert beginut in den „Schatzverzeichniſſen“ oder In-
ventaren der Fürſtenhöfe und adeligen Schlöſſer auch
die Gabel aufgeführt zu werden, der Anzahl von Meſ-
ſern und Löffeln aher keineswegs entſprechend, ſondern
immer nur in wenigen Exemplaren, ſo daß ſie ver-
muthlich nicht zum Eſſen, wohl aber zum Voͤrlegen be-
nützt wurde. Die noch früher in Epopöen und Helden-
liedern gelegentlich erwähnten eijernen „KArdumwelsS“ oder
Kräuels“ ſcheinen nicht eigentlich Gabein, ſondern mehr
Bratſpieße geweſen zu ſein, da man Fleiſch und Brod
mit ihnen Töſtete. Das Inventar des Herzogs von
Anjour (1360) verzeichnet nur eine, das Köhig Karl's V.
von Frankreich (1380j nır zwei Gabeln, lestere aller-
dings aus Silber mit kryſtallenen Heften. Die Her-
zogin von Touraine (1389) beſaß zu neun Dutzend Löf-
feln nur zwei Gabeln, die ſchön dauials „Fourchelles“
heißen, und entſchieden an das größere, ähülich geformte
Werkzeug des Landwirths, die „Forke,“ erinnerten. Als
Eßgeräth und Beſt andtheile des Beſtecks kommt die Gabel
(„gebelin“ altdeutſchj zu Anfang des 17. Jahrhun-
derts in Gebrauch, denn noch gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts bediente man ſich felbſt an Fürſtenhöfen ein-
fach der Finger hei Tafel, was das häufige Hände-
waſchen und Abſpülen erklärlich macht, wovon in gleich-
zeitigen Dichtungen ſo oft die Rede iſt. Noch 1583
wird in den Schatzverzeichniſſen des Königs von Na-
varra und des Prinzen Condé nur je einer Gabel Er-
wähnung gethan, aber bereits 1599 kann fich die ſchöne
Gabriella d' Estrees, die Geliehte Heinrichs IV., rühmen,
deren zwanzig zu beſitzen. Welches Aufſehen anfänglich
das Eſſen mit Gabel machte, dafür ſpricht ı. . die
ausführliche Schilderung eines ſolchen neumodiſchen Vor-
gangs in der gegen die höfiſchen Stutzer oder, Mignons“
gerichteten Statite „Isle des Hermaphrodites“ man
betrachtete es nämlich als ein Zeichen von Verweichli-
chung! Die Form der zuerſt nur zweizinkigen Gaͤbel
hat im Lauf der Zeit mancherlei Abänderungen und
Zuſätze erfahren, und die noch gut deutſche, dreizinkige
Gabel mit geradem Stiel und geringer Biegung macht
heute mehr und mehr der vierzinkigen, ſchaufelförmig
gebogenen engliſchen Platz.
Muſeumsautkäufe. Das neuerbaute Kaiſer Franz
Joſeſ⸗Muſeum für Kunſt und Gewerbe in Troppait
Oeſterreichiſch⸗Schleſien) beabſichtigt, nachdem der An-
ſtalt für Neuerwerbungen ſehr hHohe Suminen bewilligt
worden ſind, ſeine Sammlungen weſentlich zu vergrößern
und ſucht Ankäufe in älteren und neuen Erzeugniſſen
des Kunſtgewerbes aller Brauchen, dann in hiſtoriſchen
ſowohl als auch älteren Kunſtiverken der Maͤlerei und
Bildhauerei zu machen. Die ſchleſiſche Handels⸗ und
Gewerbekamnier zu Troppau nimmt gerne Anerbietungen
entgegen.
Das Schillerhaus in Marbach (Württ) hat
kürzlich eine werthvolle neue Sammlung erhalten. Die
Wiltwe des Oberlandesgerichtsraths Dr. Karl Schmid
in Colmar hat dem Schillerhaus eine Reihe Dokumente
überlaſſen, daruntex drei Briefe der Gattin Schiller's,
ſieben der Töchter Karoline Emiilie, zwei der Schwäge-
rin Karoline v. Wolzogen, einen des Generals v. Wol-
4* einundfünfzig des Sohnes Ernſt, und ſechs Tage-
ücher.
Eine eigenthümliche Sammlung hat der be-
kannte Milionär Coate8 in Boſton. Der 83 Jahre alte
Herr hat in ſeinem Leben keine Medizin genommen und
iſt demzufolge trotz ſeines hohen Alters munter und
wohlauf. Dagegen hat er alle Medizinen, die ihm ver-
ſchrieben wurden und die er hat machen laſſen ohne ſie
zu nehmen, geſammelt und hat nunm 1370 Pulver-
und Pillenſchachteln und etwas — über 2000 Medizin-
fläſchchen aufgeſtapelt.
Stuttgart. Liſte der Muſeen, Bibliothe-
— ken und Vereine, welche
— “ [Fortjekung.] Kriminal⸗Muſeum, Ber-
lin. — Schweizeriſche Geſelſchaft für Erhaltung Hiſto-
riſcher Kunftdenkmäler (Mr. Th. de Sauffırre), Genf,
Schweiz. — Hiſtoriſche Geſellſchaft des Kantons Nargau,
Aarau, Schweiz. — Hiftorijh-Antiquarijhe Geſellſchaft,
Appenzell, Schweiz. — Hiftorijche und anliquariſche Ge-
jellichaft, Bafel, Schweiz. — Münfterbau-VBerein, Bafel,
Schweiz. Muſeums-Berein, Baſel, Schweiz. — OHiz
ftorficf)er Verein des Kantons, Bern, Schweiz. — Hi-
ſtoriſch Antiquariſche Geſellſchaft, Chur, Schweiz. —
Hiſtoriſcher Verein des Kautons, Einſtedeln, Schweiz. —
Aſtoriſcher Verein des Kantons Thurgau, Frauenfeld,
Schwetz — Hiſtoriſcher Verein, St. Gallen, Schweiz. —
Hiſtoriſche Geſellſchaft, Genf, Schweiz. — Hiſtoriſcher
Berein, Glarus, Schweiz. — Biſtoxriſcher Verein der
fünf Orte, Luzern, Schweiz. — Hiſtorifche Geſellſchaft,
Neuchaͤtel, Schweiz. Hiſtoͤriſche und antiquarijhe Ge-
ſellſchaft,. Schaffhauſen, Schweiz. — Biſtoriſcher Verein,
von Niederwalden, Stans, Schweiz. — Hiſtöriſch-Auti-
quariſcher Verein, Winterthur, Schweiz. — Antiquarijhe
Geſellſchaft, Zürich, Schweiz. Allgemeine Geſchichts-
forſchende Geſellſchaft der Schweiz, Zürih. — Mar-
gauiſcher Kunft-Verein, Aarau, Schweiz. — Kunſt⸗Verein,
Bajel, Schweiz. — Kantonal-Kunſt-Verein, Bern,
Schweiz. — Künſtlergeſellſchaft, Bern, Schweiz. — In=-
genieur= und Architekten-BVerein, Bern, Schweiz. —
Kunſt⸗Bexein, Biel, Schweiz. Kunſt? Verein, St.
Sallen, Schweiz. — Societ& des ArtS, Genf, Schweiz.
— Inftitut national, Genf, Schweiz. — Kunft-VBerein,.
Senf, Schweiz. — Societe de l’Erpofition Permanente
des Peintures, Genf , Schweiz. — Kunſt⸗Verein, Sla-
mu8, Schweiz. Waadtländiſcher Kantonal-Kunſt-
Verein. Lauſanne, Schweiz. — Kunſt⸗-Geſellſchaft, Luzern,
Schweiz. — Kunft-VBerein, Neuchätel, Schweiz. — Kunft-
Verein, Schaffhauſen, Schweiz. — Kunſt⸗Verein, Solo-
thurn, Schweiz. Kunſt-Verein, Winterthur, Schwetz.
Kuünſtler⸗Geſellſchaft, Zürih, Schweiz! — Kunft-
Verein, Zürich, Schweiz.
* Probe⸗ Nummern. Wir haben
* Woche Probe-Nummern geſchickt
nach:
Wien, Budapeſt, Prag, Trieſt,
W Lemberg, Graz, Brünn, Szegedin, Kra-
2— Maria⸗Thereſiopel, Czernowitz, De-
pbreczin, Pilſen, Hod-Mezö-Vaſaͤthely,
Leeskemet, Linz, Preßburg. Arad, Großwaͤrdein, Bola,.
Teniesbar, Fünfkirchen, Klauſenburg, Przemy3l, Bud?
weis, Fiume, Kaſchau, Kronſtadt, Laͤibaͤch Reichenberg,
Salzburg, Stuhlweißenburg, Igiau, Innsbruck Oeden-
burg, Tarnopol, Wiener Neuftadt, Eger, Görz, Hermann-
ſtadt, Klagenfurt, Spalato, Trieut, Troppäu, Se-
rajewo.
Unſere Inſerenten werden daher auch Aufträge aus
dieſen Gegenden erhalten. Wir ſpaͤren gar keine Koſten,
um unſer Blatt auf der ganzen Erde bekannt zu
machen.
In Deutſchland und OeſterreichzUngarn koſtet das
Blatt jährlich 10 Mark, in allen übrigen Laͤndern 12
Mark, welche per rekommandirten Brief eingejendet werden
können. Wir nehmen Banknoten und Briefmarken aller
Länder in Zahluug. *
Die verehrlichen Leſer werden höflichſt erſucht,
bei Beſtellungen und ſonſtigen Anknüpfungen, welche
auf Grund in dieſer Zeituͤng abgedruckter Annoneen
erfolgen, ſich ausdruͤcklich auf die „Antiquitäten-Zeitung
in Stuttgart“ berufen zu wollen.
Sollte durch Zufall eine Probe-Nummer an einen
Empfänger gelangen, der kein Intereſſe für Antiquttäten
7 ſo bitten wir, dieſelbe an einen Sammler weiterzu-
geben.
N DE,
Kleine Mittheilungen.
MNachdruck verboten.)
Lüneburger Kuchenformen. Man ſchreibt uns:
Ein bischen leicht hat ſich's der geſchätzte Autor des
huͤbſchen Artikels in Nr. 23 über die „Lüneburger
Kuchenformen“ doch gemacht, etwas mehr läßt ſich über
die abgebildeten Stücke bei einiger Kenntniß des ein-
ſchlägigen Materials doch ſagen. Gleich der brave
Kuchenreuter!“ Er iſt von illuſtrer Abkunft und leitet
ſeinen Stammbaum direkt auf Wotan und ſein Leibroß
Sleipnir zurück — wie populär es geworden, ergibt ſich
am beiten aus der Thatſache, daß es zum „Familien-
namen“ geworden. Wem von unſeren geſchätzten Leſern
iſt die berühmte Büchſenſchmiede⸗Dhnaſtie gleichen
Namens in Augsburg unbekannt geblieben, und wer
noch keine ihrer wirklich prächtigen Arbeiten zu Händen
bekommen, kennt den Namen noͤch von der Schule her,
wo er ſich weidlich an dem Gedichte erbaut hat, das den
Namen der Kuchenreuter unſterblich gemacht hat
„ſie iſt von dem beſten Meiſter —
Kuchenreuter, glaub ich, heißt er. —“
Wie aus Wotan im Laufe des Mittelalters St. Georg
mit dem Drachen geworden,
„das ſteht auf einem andern Blatt
und iſt ein wunderlich Kapitel.“
Unſer braver Kuchenreuter aber iſt das getreue Con-
terfey eines polniſchen Edelmanns oder Fürften; das
Original hierzu wird ſich unſchwer unter den Stichen
oder Holzſchnitten der Zeit entdecken laſſen, vielleicht
liegt ſogar irgend ein hiſtoriſches Porträt zu Grunde.
Auf den Jahemärkten und bei ähnlichen feierlichen Gele-
genheiten im Oſten unſeres geliebten Vaterlandes — in
Schleſien und Poſen, iſt der brave Kuchenreuter aber
heute noch die höchſte Zier der Lebkuchenbuden — auch
der Stil der betreffenden Kunſtwerke iſt der gleiche ge-
blieben, nur das Koſtüm hat ſich geändert. Heute iſt
es zumeift ein ſtols prangender Huſar im rothen, weiß-
verſchnürtem Dolman, den die hoͤlde Dorfichöne, in ſeli-
gem Gedenken ihres Schatzes, minniglich anknubbert —
in xührender Unparxteilichkeit ſorgt der Lebküchler aber
auch für liebende Bedürfniſſe jeglicher Garniſon, indem
er ſeine Kuchenreuter aller Formate (vom Pfennigreuter
bis zur theuerſten Ausgabe in Folio maximo, das Stück
für Mark 1.50) in die prächtigſten Uniformen der Ka-
vallerie kleidet. Sicher die Jüßelte „cavalleria rusticana.“
Von nicht minderem Intereſſe ſind aber auch die kleinen
viereckigen Lebkuchenformen: ſie liefern den kulturhiſto-
riſch und gaſtronomiſch nicht unwichtigen Beweis, daß
der Ruf Nürnbergs als Lebkuchenſtadt ein ſchon damals
ſo vollbegründeter war, daß man auswärts — hier alſo
in Lüneburg — zu den unſauherſten Mitteln illohaler
Konkurrenz (wie der ſchoͤne kanzleideutſche Ausdruck
lautet) zu greifen ſich bemüßigt fand, um das Publikum
zu bemogeln. Erſichtlich ſind die betreffenden Formen
bekannten Nürnberger Typen nachgeahmt — die Meer-
jungfer iſt das hekannte Wappenbild der Nürnberger
Patrizierfamilie Rieter, und auf der länglich viereckigen
Form findet ſich ſogar das Wappen der Stadt Nürn-
berg ſelbſt — in freilich häßlich-roher Form, aber erſicht-
ach na gutem, altem Originale geſchnitten, vor. Die
Künſtler, reſp. Formſtecher werden wir zumeiſt unter
den Lebkuͤchlern ſelbſt zu ſuchen haben: ich kann aus
eigener Anſchauung berichten, daß Formen, die man
ihrem gaͤnzen Habitus nach als Arbeiten des 16. oder
17. Jaͤhrhunderts hätte anſprechen können, bis auf
unſere Tage gemacht worden ſind. Unſer Laͤndvolk iſt
in ſolchen Dingen ungemein konſervativ und verlangt
auf ſeinen Lebkuchen dieſelben Bilder, die ihm von Alters
her vertraut oder traditionell als beſonders „wohl-
ſchmeckend“ bekannt ſind, genau wie bei den Spieltarten,
deren Bilder nicht plump und roh genug ſein können.
Um dem „tiefgefühlten“ Bedürfniß entgegenzukommen,
wurden die allen Typen eben immer und immer wieder
nachgeſtochen, vielleicht werden ſie's auch heute noch.
Einer der tüchtigjten Meiſter dieſer Art, ein Mann von
wirklich künſtleriſcher Begabung, war 3. B. der erſt vor
wenigen Jahren verſtorbene Lebküchler Preitz in Zerbſt,
deſſen Arbeiten ſich getroſt neben denen ſeiner würdigſten
Ahnherren „im füßen Reiche“ ſehen laſſen dürften.
Uebrigens bewahren wohl die meiſten unſerer kulturge-
ſchichtlichen und kunſtgewerblichen Muſeen größere Reihen
die prachtvollen gothiſchen Formen im Germaniſchen Mu-
ſeum zu Nürnberg; das größte Stück der Art aber und
eins der allerſchönſten dazu, ſah ich vor Jahren in der
Schweiz: ein rundes Model von ca. 80 em Durchmeſſer,
in einem Wappenkranz den Doppeladler des heyligen
roͤmiſchen Reichs deutſchex Nation, in Zeichnung und
Modellirung ganz vorzüglich (wenn ich nicht irre, war
es 1568 datirh und den ſchönſten „Aemterſcheihen! zu
vergleichen. Als Schlußſtück eines hiſtoriſch⸗patriotiſchẽn
Zweckeſſens wäre er ſicher nicht zu verachten.
Die Aufänge der Textil⸗Induſtrie. Der erſte
Anfang der Tertilkunit iſt ebenſo unbekannt, wie der
der Schifffahrt, der Fiſcherei u. ſ. w. Man hat viel-
fach angenommen, daß die Webeſpinnen und die Seiden-
ſpinner die erſten Lehrmeiſter des Menſchen auf dieſem
Gebiete geweſen ſeien. Wahrſcheinlicher iſt, daß höher
organiſirle Thiere ihm die erſte Anregung zum Flechten,
Spinnen und Weben gegeben haben. So die Weber-
vögel, deren Männchen bekanntlich Gewebe von außer-
ordentlicher Feinheit herſtellen. Ferner unſere Beutel-
meiſe, deren aus Schafwolle, Hunde⸗ oder Ziegenhaaren
gefextigte Neſter in Polen noch heute vielfach zu Fauſt-
handſchuhen verarbeitet werden. In ſehr kuͤnſtboller
Veiſe flicht auch unſer Eichhörnchen ſein Neſt, und die
Zwergwaus nennt Brehm eine Künftlerin, wie e& wenige
giht. Wann aber hat der Menſch dieſe Vorbilder zuͤ—
erſt nachzuahmen begonnen? Wahrſcheinlich ziemlich
wät, wenn auch in vorgeſchichtlicher Zeit. Die Meinung
Darwins, daß der Menſch der fruͤheren Epochen am
ganzen Körper ſtark behaart geweſen ſei, würde eine
Erklärung dafür abgeben Der durch feine Behaarung
vor den Unbilden der Witterung geſchützte Menſch hätte
die Textilkunſt allerdings nicht gebraucht. Beweiſe für
dieſe Meinung aber fehlen bis ſetzt und ſo wird man
die Frage, wann der Menſch zuerſt der Textilkunſt feine
Aufmerkſamkeit zugewendet hat, vorläufig unbeantwoͤrtet
laſfen müſſen. Die älteſte uns bekanntẽ Form, in der
die Textilinduſtrie ſich äußerte, iſt das Nebeneinander-
legen getrockneter Pflanzenbündel, die dann unter
einander durch querliegende Halme verbunden wurden.
Loch heute werden auf Neuſeeland und bei einzelnen
Indianerſtämmen Kleidungsſtücke auf dieſe Weiſe her-
geſtellt. Bei uns hat dieſe Form ſich in den Stroh-
dächern, in den Pfingſtbeſen aus Ginſter und in den
Flaſchenfuttern für Champagner 2c.. erhalten. Die alten
Aegypter hatten bereits mehrere tauſend Jahre vor
unferer Zeitrechnung eine hoch entwickelte Textilkunſt,
und von der Spinnerei als Hausinduſtrie erfahren wir
ſchon aus der „Ilias“. Die Technik entwickelte ſich in
LStadien. Zunächſt benutzte man in ziemlich roͤher
Weiſe Pflanzenſtoffe, die mit Hülfe der bis in die Eis-
zeit zurückgehenden Nähnadel verarbeitet wurden. Die
alten Germanen trugen Rinden- oder Baſtkleider. Rinden-
kleider trug noch 1512 die dalekarliſche Landmiliz Gu-
ſtav Waſas von Schweden, die ſogenannten Birken-
beiner. Merkwürdig iſt die Verwendung von Pilzen,
in der noch heute viele Völker eine MtoBe Geſchicklich-
keit bekunden. Das zweite Stadium der Textiltechnit
beginnt mit der Erfindung des Filzes. Hierbei darf
man wohl mit Sicherheit annehmen, daß die Thiere die
Lehrmeiſter der Menſchen geweſen ſind. Filzſtoffe wer-
den heute noch angefertigt! ſo der Lodenſtoff in Tyrol.
Das dritte Stadiam brachte die Kunſt des Flechtens,
die nur mit den Händen, ohne Geräth ausgelibt wurde
und noch ausgeübt wird. Manche Bölker verſtehen
noch heute ſo fein zu flechten, daß ſie ſelbſt waſſerdichte
Gefäße damit herzuͤſtellen vermögen. Das letzte Sta-
dium endlich iſt das des Spinneus und Walkens. Die
Kunſt des Spinnens hat ſich nur ſehr langſam ent-
wickelt. Bis zum Anfang des 16. Jaͤhrhunderts kannte
man nur die Handſpindel, die auch jetzt noch vielfach
im Gebrauch iſt. Erſt 1530 wurde in Nürnberg das
Spinnrad erfunden. Die Handſpindel allerdings ift ſehr
alt. Schon die Bewohner der Pfahlbauten der Neu-
ſteinzeit kannten ſie und fertigten mit ihr ziemlich kunſt-
volle Gewebe. Sie verwendeten hierbei bereits den
Flachs und den Hanf. Bei den Germanen führten
ſich die Flachsgewehe erſt ziemlich ſpät ein. Noch zur
Zeit Plinius’ des Aelteren war Linnenzeug in Deutſch-
land eine Seltenheit. Wollengewebe dagegen kaͤnnten
unſere Vorfahren viel früher. Deutſche Gewebe aus
älterer Zeit haben ſich leidex nicht erhalten. Dagegen
haben ſich in den ſchweizeriſchen Pfahlbauten gewebte
Stoffe vielfach vorgefunden.
Eigenthümliche Nechtsverhältuiſſe. Man
ſchreibt aus Amfterdam : Kürzlich wurde einem hieſigen
Bürger ein Diamantring im Werthe von etwa 200
Gulden geſtohlen. Der Dieb wurde von der Polizei
ausfindig gemacht, als er den Ring einem Hehler für
60 Gulden verkauft hatte. Der Ring wurde bei dem
Hehler beſchlagahmt. Als der Dieb verhaftet wurde,
war er noch im Beſitz von 50 Gulden! Nach der Ver-
urtheilung des Thäters zu einer Gefängnißſtraͤfe wurden
auf Befehl des Gexichts dies0 Gulden dem Dieb und derRing
dem Hehler zurückgegeben, während der rehtmäßige Eigen-
thümer das Nachfehen hatte. Dieſes Verfaͤhren ent-
ſprach vollſtändig dem hierzulande geltenden Geſetz.
Denn will der Veſtohlent wieder in den Beſttz ſeines
Eigenthums kommen, ſo muß er es von deni Hehler
zu kaufen ſuchen und dieſer kaͤnn einen beliebigen Preis
machen; nur dann, wenn der geſtohlene Gegenſtand
ſich noch im Beſitz des Diebes befindet, wird derfelbe
dem Eigenthümer zur Hand geſtellt. Dagegen wird
das dafuͤr empfangene Geld als Eigenthum des Diebes
betrachtet. Zwar kann der Eigenthuͤmer innerhalb acht
Tagen auf den geſtohlenen Gegenſtand Beſchlaͤg legen
laſſen, aber dies iſt eine reine Zivilforderung und deren
Seltendmachung koſtet hierzulande ſehr viel Geld.
Deßhalb machen viele Beſtohlene der Poͤltzei gar keine
Anzeige, da ſie wiſſen, daß ſie nur in den ſeltenſten
Fällen ihren Zweck erreichen. Diebe und Spitzbuben
aber können ſich keine beſſeren Geſetze wünſchen.
Für Briefmarkeufammiler. Die neueſte Brief-
marke iſt diejenige von Dfibouti, einem franzöſiſchen
Protektorat an der Somaliklſte. Ste iſt vechtwinckelig mit
nicht gezähntem Rande und etwas größer als die von
Ohock. Man ſieht darauf eine Anſicht von Djibouti
und in den beiden Winkeln je einen Kreis mit der An-
gabe des Werthes. Auch befindet ſich oben die In-
ſchrift:„Protectorat de la cöte des Somalis“ und rechts
ſowohl als links die Initialen R. F., ſowie ein mit
einer Lanze bewaffneter Eingeborener. Darunter ſteht:
Diibouti 1893—1894, „Service postal“. — Das höchſte
Poſtwerthzeichen, das es gibt, i{t die argentiniſche
1400-BefoSmarke im offiziellen Werth von 5000 Mark.
Abgeſehen von ihrem amtlichen Werthe iſt ſie eine der
ſeltenſten und wenige Sammler können ſich den Luxus
leiſten, ſie zu kaufen. Trotz ihres hohen Preiſes iſt
vorgeſtern eine in London verkauft worden. Dieſelbe
wurde, obgleich ſie abgeſtempelt war mit nicht weniger als
100 Pfund Sterling, das heißt 2000 Mark bezahlt.
Zur Geſchichte der Gabel. Erſt im 14. Jahr-
hundert beginut in den „Schatzverzeichniſſen“ oder In-
ventaren der Fürſtenhöfe und adeligen Schlöſſer auch
die Gabel aufgeführt zu werden, der Anzahl von Meſ-
ſern und Löffeln aher keineswegs entſprechend, ſondern
immer nur in wenigen Exemplaren, ſo daß ſie ver-
muthlich nicht zum Eſſen, wohl aber zum Voͤrlegen be-
nützt wurde. Die noch früher in Epopöen und Helden-
liedern gelegentlich erwähnten eijernen „KArdumwelsS“ oder
Kräuels“ ſcheinen nicht eigentlich Gabein, ſondern mehr
Bratſpieße geweſen zu ſein, da man Fleiſch und Brod
mit ihnen Töſtete. Das Inventar des Herzogs von
Anjour (1360) verzeichnet nur eine, das Köhig Karl's V.
von Frankreich (1380j nır zwei Gabeln, lestere aller-
dings aus Silber mit kryſtallenen Heften. Die Her-
zogin von Touraine (1389) beſaß zu neun Dutzend Löf-
feln nur zwei Gabeln, die ſchön dauials „Fourchelles“
heißen, und entſchieden an das größere, ähülich geformte
Werkzeug des Landwirths, die „Forke,“ erinnerten. Als
Eßgeräth und Beſt andtheile des Beſtecks kommt die Gabel
(„gebelin“ altdeutſchj zu Anfang des 17. Jahrhun-
derts in Gebrauch, denn noch gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts bediente man ſich felbſt an Fürſtenhöfen ein-
fach der Finger hei Tafel, was das häufige Hände-
waſchen und Abſpülen erklärlich macht, wovon in gleich-
zeitigen Dichtungen ſo oft die Rede iſt. Noch 1583
wird in den Schatzverzeichniſſen des Königs von Na-
varra und des Prinzen Condé nur je einer Gabel Er-
wähnung gethan, aber bereits 1599 kann fich die ſchöne
Gabriella d' Estrees, die Geliehte Heinrichs IV., rühmen,
deren zwanzig zu beſitzen. Welches Aufſehen anfänglich
das Eſſen mit Gabel machte, dafür ſpricht ı. . die
ausführliche Schilderung eines ſolchen neumodiſchen Vor-
gangs in der gegen die höfiſchen Stutzer oder, Mignons“
gerichteten Statite „Isle des Hermaphrodites“ man
betrachtete es nämlich als ein Zeichen von Verweichli-
chung! Die Form der zuerſt nur zweizinkigen Gaͤbel
hat im Lauf der Zeit mancherlei Abänderungen und
Zuſätze erfahren, und die noch gut deutſche, dreizinkige
Gabel mit geradem Stiel und geringer Biegung macht
heute mehr und mehr der vierzinkigen, ſchaufelförmig
gebogenen engliſchen Platz.
Muſeumsautkäufe. Das neuerbaute Kaiſer Franz
Joſeſ⸗Muſeum für Kunſt und Gewerbe in Troppait
Oeſterreichiſch⸗Schleſien) beabſichtigt, nachdem der An-
ſtalt für Neuerwerbungen ſehr hHohe Suminen bewilligt
worden ſind, ſeine Sammlungen weſentlich zu vergrößern
und ſucht Ankäufe in älteren und neuen Erzeugniſſen
des Kunſtgewerbes aller Brauchen, dann in hiſtoriſchen
ſowohl als auch älteren Kunſtiverken der Maͤlerei und
Bildhauerei zu machen. Die ſchleſiſche Handels⸗ und
Gewerbekamnier zu Troppau nimmt gerne Anerbietungen
entgegen.
Das Schillerhaus in Marbach (Württ) hat
kürzlich eine werthvolle neue Sammlung erhalten. Die
Wiltwe des Oberlandesgerichtsraths Dr. Karl Schmid
in Colmar hat dem Schillerhaus eine Reihe Dokumente
überlaſſen, daruntex drei Briefe der Gattin Schiller's,
ſieben der Töchter Karoline Emiilie, zwei der Schwäge-
rin Karoline v. Wolzogen, einen des Generals v. Wol-
4* einundfünfzig des Sohnes Ernſt, und ſechs Tage-
ücher.
Eine eigenthümliche Sammlung hat der be-
kannte Milionär Coate8 in Boſton. Der 83 Jahre alte
Herr hat in ſeinem Leben keine Medizin genommen und
iſt demzufolge trotz ſeines hohen Alters munter und
wohlauf. Dagegen hat er alle Medizinen, die ihm ver-
ſchrieben wurden und die er hat machen laſſen ohne ſie
zu nehmen, geſammelt und hat nunm 1370 Pulver-
und Pillenſchachteln und etwas — über 2000 Medizin-
fläſchchen aufgeſtapelt.
Stuttgart. Liſte der Muſeen, Bibliothe-
— ken und Vereine, welche
— “ [Fortjekung.] Kriminal⸗Muſeum, Ber-
lin. — Schweizeriſche Geſelſchaft für Erhaltung Hiſto-
riſcher Kunftdenkmäler (Mr. Th. de Sauffırre), Genf,
Schweiz. — Hiſtoriſche Geſellſchaft des Kantons Nargau,
Aarau, Schweiz. — Hiftorijh-Antiquarijhe Geſellſchaft,
Appenzell, Schweiz. — Hiftorijche und anliquariſche Ge-
jellichaft, Bafel, Schweiz. — Münfterbau-VBerein, Bafel,
Schweiz. Muſeums-Berein, Baſel, Schweiz. — OHiz
ftorficf)er Verein des Kantons, Bern, Schweiz. — Hi-
ſtoriſch Antiquariſche Geſellſchaft, Chur, Schweiz. —
Hiſtoriſcher Verein des Kautons, Einſtedeln, Schweiz. —
Aſtoriſcher Verein des Kantons Thurgau, Frauenfeld,
Schwetz — Hiſtoriſcher Verein, St. Gallen, Schweiz. —
Hiſtoriſche Geſellſchaft, Genf, Schweiz. — Hiſtoriſcher
Berein, Glarus, Schweiz. — Biſtoxriſcher Verein der
fünf Orte, Luzern, Schweiz. — Hiſtorifche Geſellſchaft,
Neuchaͤtel, Schweiz. Hiſtoͤriſche und antiquarijhe Ge-
ſellſchaft,. Schaffhauſen, Schweiz. — Biſtoriſcher Verein,
von Niederwalden, Stans, Schweiz. — Hiſtöriſch-Auti-
quariſcher Verein, Winterthur, Schweiz. — Antiquarijhe
Geſellſchaft, Zürich, Schweiz. Allgemeine Geſchichts-
forſchende Geſellſchaft der Schweiz, Zürih. — Mar-
gauiſcher Kunft-Verein, Aarau, Schweiz. — Kunſt⸗Verein,
Bajel, Schweiz. — Kantonal-Kunſt-Verein, Bern,
Schweiz. — Künſtlergeſellſchaft, Bern, Schweiz. — In=-
genieur= und Architekten-BVerein, Bern, Schweiz. —
Kunſt⸗Bexein, Biel, Schweiz. Kunſt? Verein, St.
Sallen, Schweiz. — Societ& des ArtS, Genf, Schweiz.
— Inftitut national, Genf, Schweiz. — Kunft-VBerein,.
Senf, Schweiz. — Societe de l’Erpofition Permanente
des Peintures, Genf , Schweiz. — Kunſt⸗Verein, Sla-
mu8, Schweiz. Waadtländiſcher Kantonal-Kunſt-
Verein. Lauſanne, Schweiz. — Kunſt⸗-Geſellſchaft, Luzern,
Schweiz. — Kunft-VBerein, Neuchätel, Schweiz. — Kunft-
Verein, Schaffhauſen, Schweiz. — Kunſt⸗Verein, Solo-
thurn, Schweiz. Kunſt-Verein, Winterthur, Schwetz.
Kuünſtler⸗Geſellſchaft, Zürih, Schweiz! — Kunft-
Verein, Zürich, Schweiz.
* Probe⸗ Nummern. Wir haben
* Woche Probe-Nummern geſchickt
nach:
Wien, Budapeſt, Prag, Trieſt,
W Lemberg, Graz, Brünn, Szegedin, Kra-
2— Maria⸗Thereſiopel, Czernowitz, De-
pbreczin, Pilſen, Hod-Mezö-Vaſaͤthely,
Leeskemet, Linz, Preßburg. Arad, Großwaͤrdein, Bola,.
Teniesbar, Fünfkirchen, Klauſenburg, Przemy3l, Bud?
weis, Fiume, Kaſchau, Kronſtadt, Laͤibaͤch Reichenberg,
Salzburg, Stuhlweißenburg, Igiau, Innsbruck Oeden-
burg, Tarnopol, Wiener Neuftadt, Eger, Görz, Hermann-
ſtadt, Klagenfurt, Spalato, Trieut, Troppäu, Se-
rajewo.
Unſere Inſerenten werden daher auch Aufträge aus
dieſen Gegenden erhalten. Wir ſpaͤren gar keine Koſten,
um unſer Blatt auf der ganzen Erde bekannt zu
machen.
In Deutſchland und OeſterreichzUngarn koſtet das
Blatt jährlich 10 Mark, in allen übrigen Laͤndern 12
Mark, welche per rekommandirten Brief eingejendet werden
können. Wir nehmen Banknoten und Briefmarken aller
Länder in Zahluug. *
Die verehrlichen Leſer werden höflichſt erſucht,
bei Beſtellungen und ſonſtigen Anknüpfungen, welche
auf Grund in dieſer Zeituͤng abgedruckter Annoneen
erfolgen, ſich ausdruͤcklich auf die „Antiquitäten-Zeitung
in Stuttgart“ berufen zu wollen.
Sollte durch Zufall eine Probe-Nummer an einen
Empfänger gelangen, der kein Intereſſe für Antiquttäten
7 ſo bitten wir, dieſelbe an einen Sammler weiterzu-
geben.