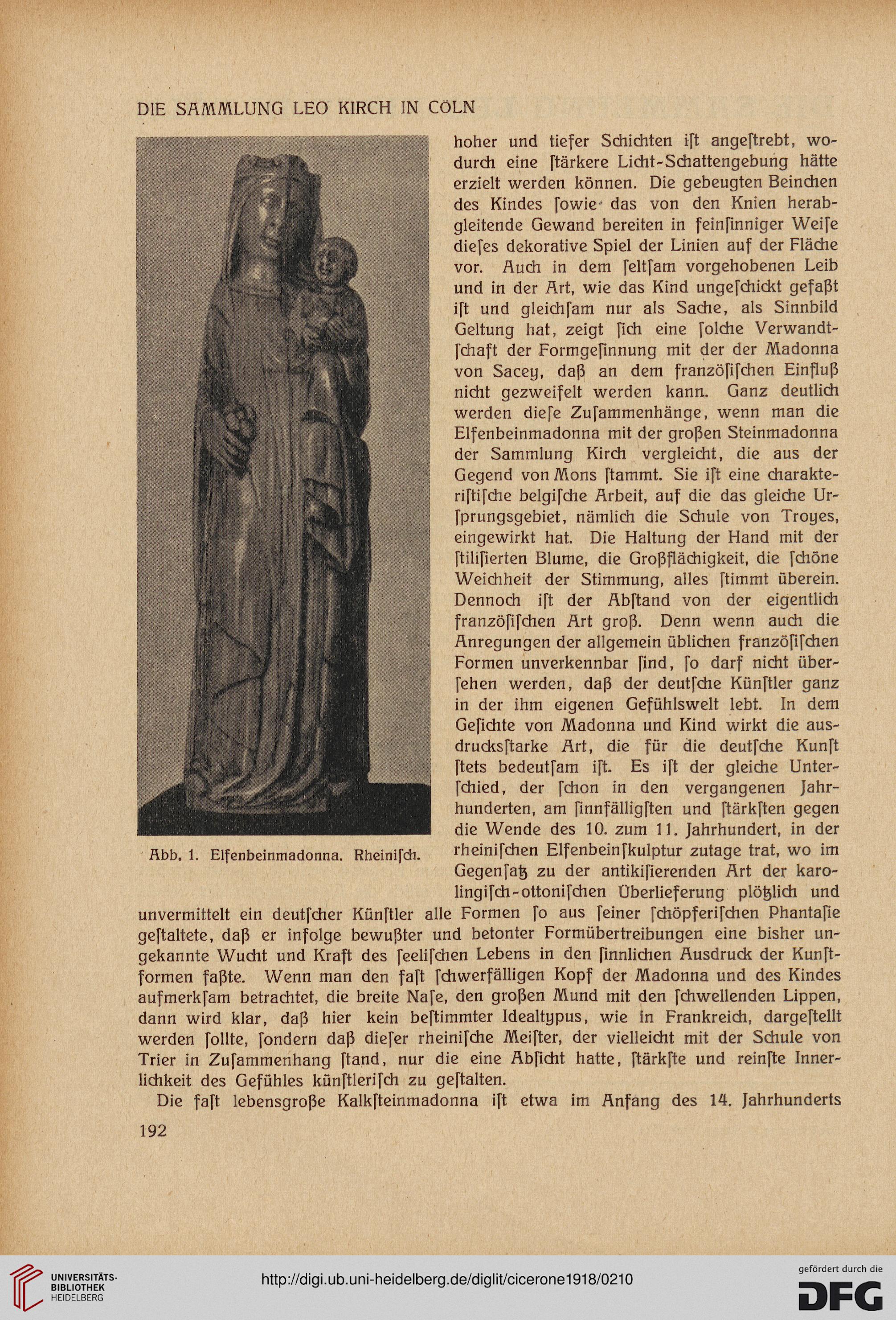DIE SAMMLUNG LEO KIRCH IN CÖLN
hoher und tiefer Schichten ift angeftrebt, wo-
durch eine ftärkere Licht-Schattengebung hätte
erzielt werden können. Die gebeugten Beinchen
des Kindes fowie- das von den Knien herab-
gleitende Gewand bereiten in feinfinniger Weife
diefes dekorative Spiel der Linien auf der Fläche
vor. Auch in dem feltfam vorgehobenen Leib
und in der Art, wie das Kind ungefchickt gefaßt
ift und gleichfam nur als Sache, als Sinnbild
Geltung hat, zeigt fich eine foldie Verwandt-
fchaft der Formgefinnung mit der der Madonna
von Sacey, daß an dem franzöfifchen Einfluß
nicht gezweifelt werden kann. Ganz deutlich
werden diefe Zufammenhänge, wenn man die
Elfenbeinmadonna mit der großen Steinmadonna
der Sammlung Kirch vergleicht, die aus der
Gegend von Mons ftammt. Sie ift eine charakte-
riftifche belgifche Arbeit, auf die das gleiche Ur-
fprungsgebiet, nämlich die Schule von Troges,
eingewirkt hat. Die Haltung der Hand mit der
ftilifierten Blume, die Großflächigkeit, die fchöne
Weichheit der Stimmung, alles ftimmt überein.
Dennoch ift der Abftand von der eigentlich
franzöfifchen Art groß. Denn wenn auch die
Anregungen der allgemein üblichen franzöfifchen
Formen unverkennbar find, fo darf nicht über-
fehen werden, daß der deutfche Künftler ganz
in der ihm eigenen Gefühlswelt lebt. In dem
Gefichte von Madonna und Kind wirkt die aus-
drucksftarke Art, die für die deutfche Kunft
ftets bedeutfam ift. Es ift der gleiche Unter-
fchied, der fchon in den vergangenen Jahr-
hunderten, am finnfälligften und ftärkften gegen
die Wende des 10. zum 11. Jahrhundert, in der
rheinifchen Elfenbeinfkulptur zutage trat, wo im
Gegenfatj zu der antikifierenden Art der karo-
lingifch-ottonifchen Überlieferung plötzlich und
unvermittelt ein deutfcher Künftler alle Formen fo aus feiner fchöpferifchen Phantafie
geftaltete, daß er infolge bewußter und betonter Formübertreibungen eine bisher un-
gekannte Wucht und Kraft des feelifchen Lebens in den finnlichen Ausdruck der Kunft-
formen faßte. Wenn man den faß fchwerfälligen Kopf der Madonna und des Kindes
aufmerkfam betrachtet, die breite Nafe, den großen Mund mit den fchwellenden Lippen,
dann wird klar, daß hier kein beftimmter Idealtypus, wie in Frankreich, dargeftellt
werden follte, fondern daß diefer rheinifche Meifter, der vielleicht mit der Schule von
Trier in Zufammenhang ftand, nur die eine Abficht hatte, ftärkfte und reinfte Inner-
lichkeit des Gefühles künftlerifch zu geftalten.
Die faft lebensgroße Kalkfteinmadonna ift etwa im Anfang des 14. Jahrhunderts
Äbb. 1. Elfenbeinmadonna. Rheinifdi.
192
hoher und tiefer Schichten ift angeftrebt, wo-
durch eine ftärkere Licht-Schattengebung hätte
erzielt werden können. Die gebeugten Beinchen
des Kindes fowie- das von den Knien herab-
gleitende Gewand bereiten in feinfinniger Weife
diefes dekorative Spiel der Linien auf der Fläche
vor. Auch in dem feltfam vorgehobenen Leib
und in der Art, wie das Kind ungefchickt gefaßt
ift und gleichfam nur als Sache, als Sinnbild
Geltung hat, zeigt fich eine foldie Verwandt-
fchaft der Formgefinnung mit der der Madonna
von Sacey, daß an dem franzöfifchen Einfluß
nicht gezweifelt werden kann. Ganz deutlich
werden diefe Zufammenhänge, wenn man die
Elfenbeinmadonna mit der großen Steinmadonna
der Sammlung Kirch vergleicht, die aus der
Gegend von Mons ftammt. Sie ift eine charakte-
riftifche belgifche Arbeit, auf die das gleiche Ur-
fprungsgebiet, nämlich die Schule von Troges,
eingewirkt hat. Die Haltung der Hand mit der
ftilifierten Blume, die Großflächigkeit, die fchöne
Weichheit der Stimmung, alles ftimmt überein.
Dennoch ift der Abftand von der eigentlich
franzöfifchen Art groß. Denn wenn auch die
Anregungen der allgemein üblichen franzöfifchen
Formen unverkennbar find, fo darf nicht über-
fehen werden, daß der deutfche Künftler ganz
in der ihm eigenen Gefühlswelt lebt. In dem
Gefichte von Madonna und Kind wirkt die aus-
drucksftarke Art, die für die deutfche Kunft
ftets bedeutfam ift. Es ift der gleiche Unter-
fchied, der fchon in den vergangenen Jahr-
hunderten, am finnfälligften und ftärkften gegen
die Wende des 10. zum 11. Jahrhundert, in der
rheinifchen Elfenbeinfkulptur zutage trat, wo im
Gegenfatj zu der antikifierenden Art der karo-
lingifch-ottonifchen Überlieferung plötzlich und
unvermittelt ein deutfcher Künftler alle Formen fo aus feiner fchöpferifchen Phantafie
geftaltete, daß er infolge bewußter und betonter Formübertreibungen eine bisher un-
gekannte Wucht und Kraft des feelifchen Lebens in den finnlichen Ausdruck der Kunft-
formen faßte. Wenn man den faß fchwerfälligen Kopf der Madonna und des Kindes
aufmerkfam betrachtet, die breite Nafe, den großen Mund mit den fchwellenden Lippen,
dann wird klar, daß hier kein beftimmter Idealtypus, wie in Frankreich, dargeftellt
werden follte, fondern daß diefer rheinifche Meifter, der vielleicht mit der Schule von
Trier in Zufammenhang ftand, nur die eine Abficht hatte, ftärkfte und reinfte Inner-
lichkeit des Gefühles künftlerifch zu geftalten.
Die faft lebensgroße Kalkfteinmadonna ift etwa im Anfang des 14. Jahrhunderts
Äbb. 1. Elfenbeinmadonna. Rheinifdi.
192