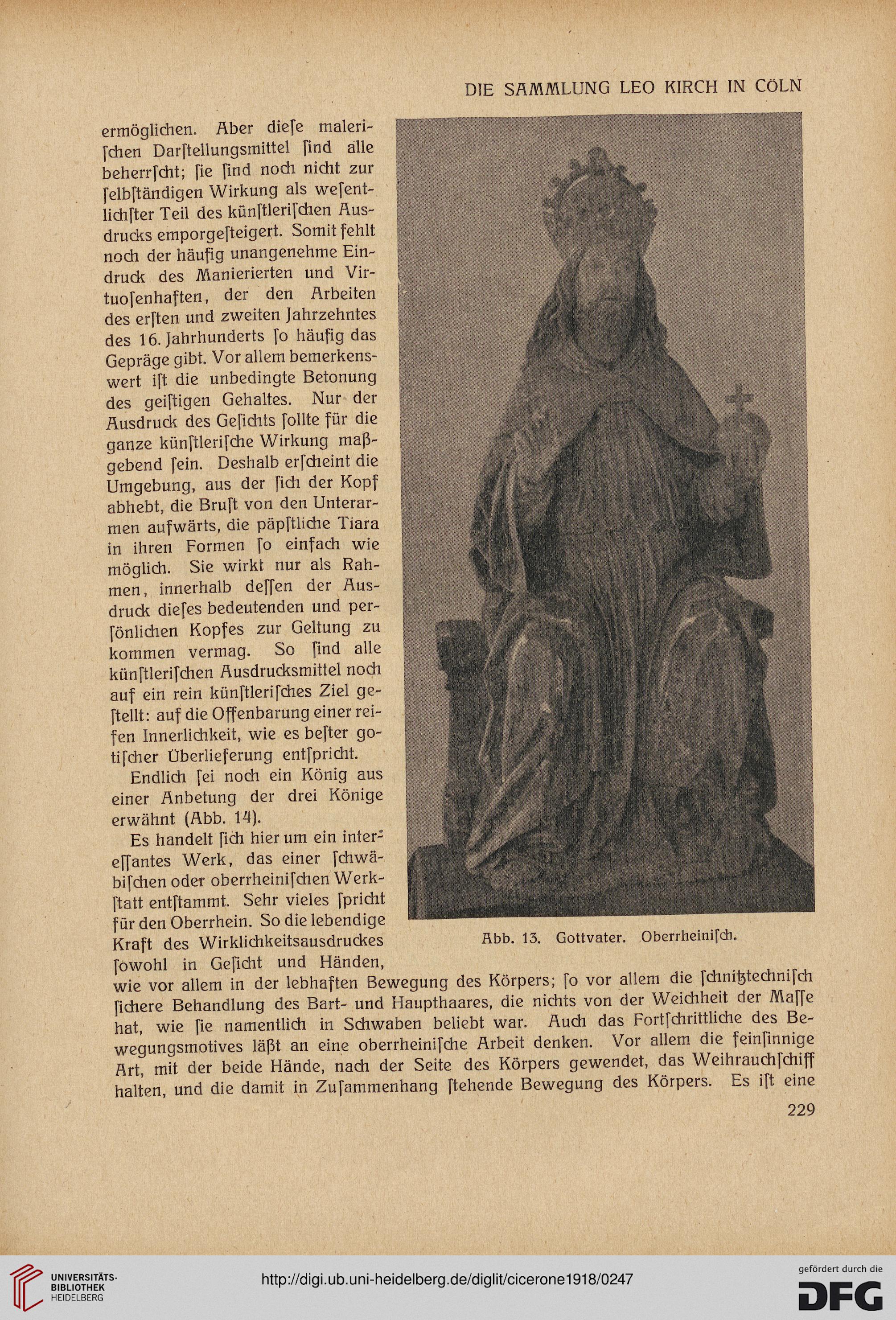Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 10.1918
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.24428#0247
DOI Heft:
Heft 15/16
DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Die Sammlung Leo Kirch in Cöln, [2]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.24428#0247
DIE SAMMLUNG LEO KIRCH IN CÖLN
ermöglichen. Aber diefe maleri-
fchen Darftellungsmittel find alle
beherrfcht; fie find noch nicht zur
felbftändigen Wirkung als wefent-
lichfter Teil des künftleri[chen Aus-
drucks emporgefteigert. Somit fehlt
noch der häufig unangenehme Ein-
druck des Manierierten und Vir-
tuofenhaften, der den Arbeiten
des erften und zweiten Jahrzehntes
des 16. Jahrhunderts fo häufig das
Gepräge gibt. Vor allem bemerkens-
wert ift die unbedingte Betonung
des geiftigen Gehaltes. Nur der
Ausdruck des Gefichts follte für die
ganze künftlerifche Wirkung maß-
gebend fein. Deshalb erfcheint die
Umgebung, aus der fich der Kopf
abhebt, die Bruft von den Unterar-
men aufwärts, die päpftliche Tiara
in ihren Formen fo einfach wie
möglich. Sie wirkt nur als Rah-
men, innerhalb deffen der Aus-
druck diefes bedeutenden und per-
fönlichen Kopfes zur Geltung zu
kommen vermag. So find alle
künftlerifchen Ausdrucksmittel noch
auf ein rein künftlerifches Ziel ge-
teilt: auf die Offenbarung einer rei-
fen Innerlichkeit, wie es befter go-
tifcher Überlieferung entfpricht.
Endlich fei noch ein König aus
einer Anbetung der drei Könige
erwähnt (Abb. 14).
Es handelt fich hier um ein inter-
effantes Werk, das einer fchwä-
bifchen oder oberrheinifchen Werk-
ftatt entftammt. Sehr vieles fpricht
für den Oberrhein. So die lebendige
Kraft des Wirklichkeitsausdruckes
fowohl in Geficht und Händen,
wie vor allem in der lebhaften Bewegung des Körpers; fo vor allem die fchnißtechnifch
fichere Behandlung des Bart- und Haupthaares, die nichts von der Weichheit der Maffe
hat, wie fie namentlich in Schwaben beliebt war. Auch das Fortfchrittliche des Be-
wegungsmotives läßt an eine oberrheinifche Arbeit denken. Vor allem die feinfinnige
Art, mit der beide Hände, nach der Seite des Körpers gewendet, das Weihrauchfchiff
halten, und die damit in Zufammenhang ftehende Bewegung des Körpers. Es ift eine
Äbb. 13. Gottvater. Oberrheinifch.
229
ermöglichen. Aber diefe maleri-
fchen Darftellungsmittel find alle
beherrfcht; fie find noch nicht zur
felbftändigen Wirkung als wefent-
lichfter Teil des künftleri[chen Aus-
drucks emporgefteigert. Somit fehlt
noch der häufig unangenehme Ein-
druck des Manierierten und Vir-
tuofenhaften, der den Arbeiten
des erften und zweiten Jahrzehntes
des 16. Jahrhunderts fo häufig das
Gepräge gibt. Vor allem bemerkens-
wert ift die unbedingte Betonung
des geiftigen Gehaltes. Nur der
Ausdruck des Gefichts follte für die
ganze künftlerifche Wirkung maß-
gebend fein. Deshalb erfcheint die
Umgebung, aus der fich der Kopf
abhebt, die Bruft von den Unterar-
men aufwärts, die päpftliche Tiara
in ihren Formen fo einfach wie
möglich. Sie wirkt nur als Rah-
men, innerhalb deffen der Aus-
druck diefes bedeutenden und per-
fönlichen Kopfes zur Geltung zu
kommen vermag. So find alle
künftlerifchen Ausdrucksmittel noch
auf ein rein künftlerifches Ziel ge-
teilt: auf die Offenbarung einer rei-
fen Innerlichkeit, wie es befter go-
tifcher Überlieferung entfpricht.
Endlich fei noch ein König aus
einer Anbetung der drei Könige
erwähnt (Abb. 14).
Es handelt fich hier um ein inter-
effantes Werk, das einer fchwä-
bifchen oder oberrheinifchen Werk-
ftatt entftammt. Sehr vieles fpricht
für den Oberrhein. So die lebendige
Kraft des Wirklichkeitsausdruckes
fowohl in Geficht und Händen,
wie vor allem in der lebhaften Bewegung des Körpers; fo vor allem die fchnißtechnifch
fichere Behandlung des Bart- und Haupthaares, die nichts von der Weichheit der Maffe
hat, wie fie namentlich in Schwaben beliebt war. Auch das Fortfchrittliche des Be-
wegungsmotives läßt an eine oberrheinifche Arbeit denken. Vor allem die feinfinnige
Art, mit der beide Hände, nach der Seite des Körpers gewendet, das Weihrauchfchiff
halten, und die damit in Zufammenhang ftehende Bewegung des Körpers. Es ift eine
Äbb. 13. Gottvater. Oberrheinifch.
229