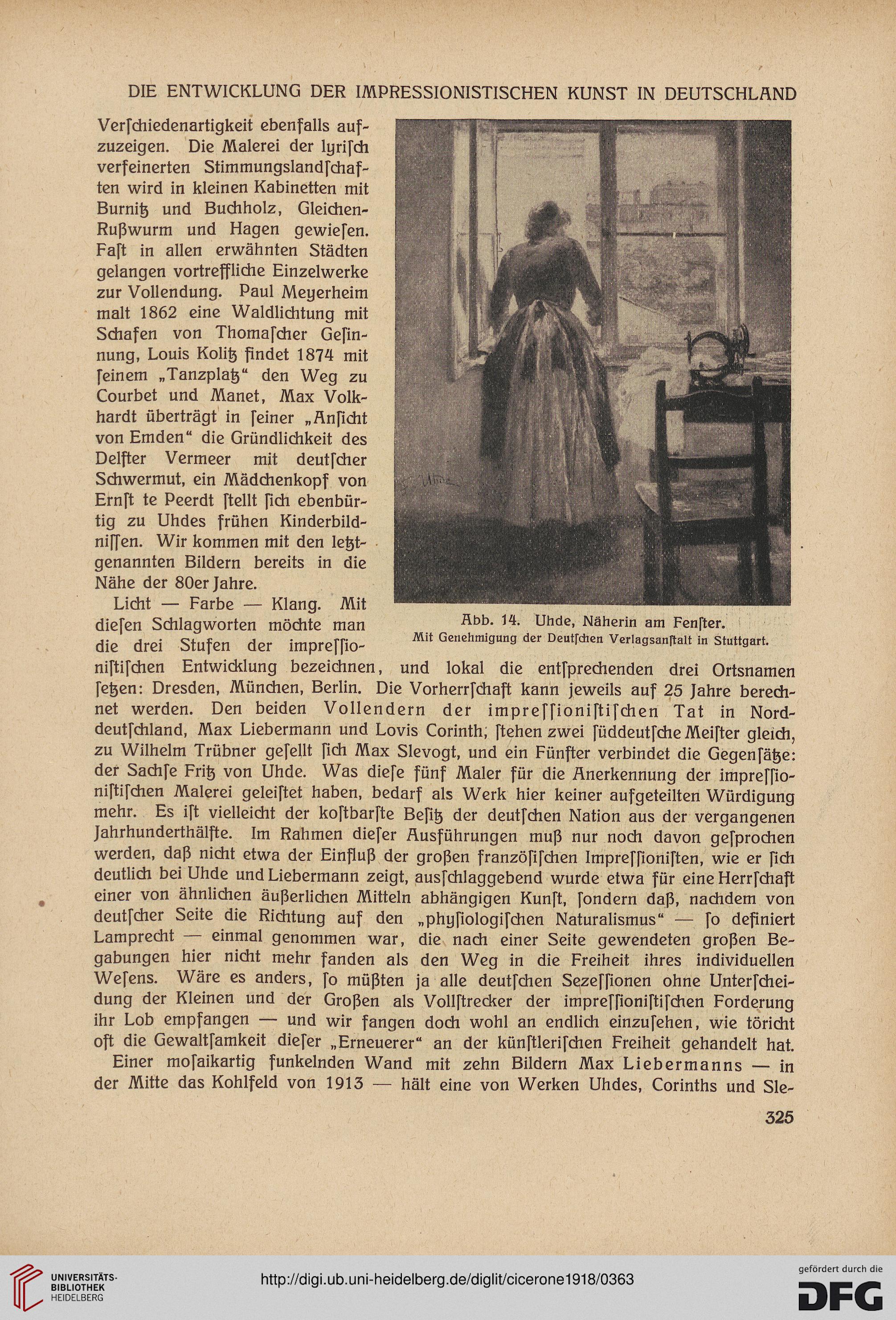DIE ENTWICKLUNG DER IMPRESSIONISTISCHEN KUNST IN DEUTSCHLAND
Verfchiedenartigkeit ebenfalls auf-
zuzeigen. Die Malerei der lyrifdi
verfeinerten Stimmungslandfchaf-
ten wird in kleinen Kabinetten mit
Burniß und Buchholz, Gleichen-
Rußwurm und Hagen gewiefen.
Faft in allen erwähnten Städten
gelangen vortreffliche Einzelwerke
zur Vollendung. Paul Megerheim
malt 1862 eine Waldlichtung mit
Schafen von Thomafcher Gefin-
nung, Louis Koliß findet 1874 mit
feinem „Tanzplaß“ den Weg zu
Courbet und Manet, Max Volk-
hardt überträgt in feiner „Hnficht
von Emden“ die Gründlichkeit des
Delfter Vermeer mit deutfcher
Schwermut, ein Mädchenkopf von
Ernft te Peerdt ftellt pdi ebenbür-
tig zu Uhdes frühen Kinderbild-
niffen. Wir kommen mit den leßt-
genannten Bildern bereits in die
Nähe der 80er Jahre.
Licht — Farbe — Klang. Mit
diefen Schlagworten möchte man Äbb- Uhde, Näherin am Fenfter.
die drei Stufen der imprerrio- *" G"gung der Deutfdien VerlagsanMt in Stuttgart.
niftifchen Entwicklung bezeichnen, und lokal die entfprechenden drei Ortsnamen
feßen: Dresden, München, Berlin. Die Vorherrfchaft kann jeweils auf 25 Jahre berech-
net werden. Den beiden Vollendern der impreffioniftifchen Tat in Nord-
deutfchland, Max Liebermann und Lovis Corinth, ftehen zwei füddeutfche Meifter gleich,
zu Wilhelm Trübner gefeilt fich Max Slevogt, und ein Fünfter verbindet die Gegenfäße:
der Sachfe Friß von Uhde. Was diefe fünf Maler für die Anerkennung der impreffio-
niftifchen Malerei geleiftet haben, bedarf als Werk hier keiner aufgeteilten Würdigung
mehr. Es ift vielleicht der koftbarfte Befiß der deutfchen Nation aus der vergangenen
Jahrhunderthälfte. Im Rahmen diefer Ausführungen muß nur noch davon gefprochen
werden, daß nicht etwa der Einfluß der großen franzöfifchen Impreffioniften, wie er fich
deutlich bei Uhde und Liebermann zeigt, ausfchlaggebend wurde etwa für eine Herrfchaft
einer von ähnlichen äußerlichen Mitteln abhängigen Kunft, fondern daß, nachdem von
deutfcher Seite die Richtung auf den „phgfiologifchen Naturalismus“ — fo definiert
Lamprecht — einmal genommen war, die nach einer Seite gewendeten großen Be-
gabungen hier nicht mehr fanden als den Weg in die Freiheit ihres individuellen
Wefens. Wäre es anders, fo müßten ja alle deutfchen Sezeffionen ohne Unterfchei-
dung der Kleinen und der Großen als Vollftrecker der impreffioniftifchen Forderung
ihr Lob empfangen — und wir fangen doch wohl an endlich einzufehen, wie töricht
oft die Gewaltfamkeit diefer „Erneuerer“ an der künftlerifchen Freiheit gehandelt hat.
Einer mofaikartig funkelnden Wand mit zehn Bildern Max Liebermanns — in
der Mitte das Kohlfeld von 1913 — hält eine von Werken Uhdes, Corinths und Sle-
325
Verfchiedenartigkeit ebenfalls auf-
zuzeigen. Die Malerei der lyrifdi
verfeinerten Stimmungslandfchaf-
ten wird in kleinen Kabinetten mit
Burniß und Buchholz, Gleichen-
Rußwurm und Hagen gewiefen.
Faft in allen erwähnten Städten
gelangen vortreffliche Einzelwerke
zur Vollendung. Paul Megerheim
malt 1862 eine Waldlichtung mit
Schafen von Thomafcher Gefin-
nung, Louis Koliß findet 1874 mit
feinem „Tanzplaß“ den Weg zu
Courbet und Manet, Max Volk-
hardt überträgt in feiner „Hnficht
von Emden“ die Gründlichkeit des
Delfter Vermeer mit deutfcher
Schwermut, ein Mädchenkopf von
Ernft te Peerdt ftellt pdi ebenbür-
tig zu Uhdes frühen Kinderbild-
niffen. Wir kommen mit den leßt-
genannten Bildern bereits in die
Nähe der 80er Jahre.
Licht — Farbe — Klang. Mit
diefen Schlagworten möchte man Äbb- Uhde, Näherin am Fenfter.
die drei Stufen der imprerrio- *" G"gung der Deutfdien VerlagsanMt in Stuttgart.
niftifchen Entwicklung bezeichnen, und lokal die entfprechenden drei Ortsnamen
feßen: Dresden, München, Berlin. Die Vorherrfchaft kann jeweils auf 25 Jahre berech-
net werden. Den beiden Vollendern der impreffioniftifchen Tat in Nord-
deutfchland, Max Liebermann und Lovis Corinth, ftehen zwei füddeutfche Meifter gleich,
zu Wilhelm Trübner gefeilt fich Max Slevogt, und ein Fünfter verbindet die Gegenfäße:
der Sachfe Friß von Uhde. Was diefe fünf Maler für die Anerkennung der impreffio-
niftifchen Malerei geleiftet haben, bedarf als Werk hier keiner aufgeteilten Würdigung
mehr. Es ift vielleicht der koftbarfte Befiß der deutfchen Nation aus der vergangenen
Jahrhunderthälfte. Im Rahmen diefer Ausführungen muß nur noch davon gefprochen
werden, daß nicht etwa der Einfluß der großen franzöfifchen Impreffioniften, wie er fich
deutlich bei Uhde und Liebermann zeigt, ausfchlaggebend wurde etwa für eine Herrfchaft
einer von ähnlichen äußerlichen Mitteln abhängigen Kunft, fondern daß, nachdem von
deutfcher Seite die Richtung auf den „phgfiologifchen Naturalismus“ — fo definiert
Lamprecht — einmal genommen war, die nach einer Seite gewendeten großen Be-
gabungen hier nicht mehr fanden als den Weg in die Freiheit ihres individuellen
Wefens. Wäre es anders, fo müßten ja alle deutfchen Sezeffionen ohne Unterfchei-
dung der Kleinen und der Großen als Vollftrecker der impreffioniftifchen Forderung
ihr Lob empfangen — und wir fangen doch wohl an endlich einzufehen, wie töricht
oft die Gewaltfamkeit diefer „Erneuerer“ an der künftlerifchen Freiheit gehandelt hat.
Einer mofaikartig funkelnden Wand mit zehn Bildern Max Liebermanns — in
der Mitte das Kohlfeld von 1913 — hält eine von Werken Uhdes, Corinths und Sle-
325