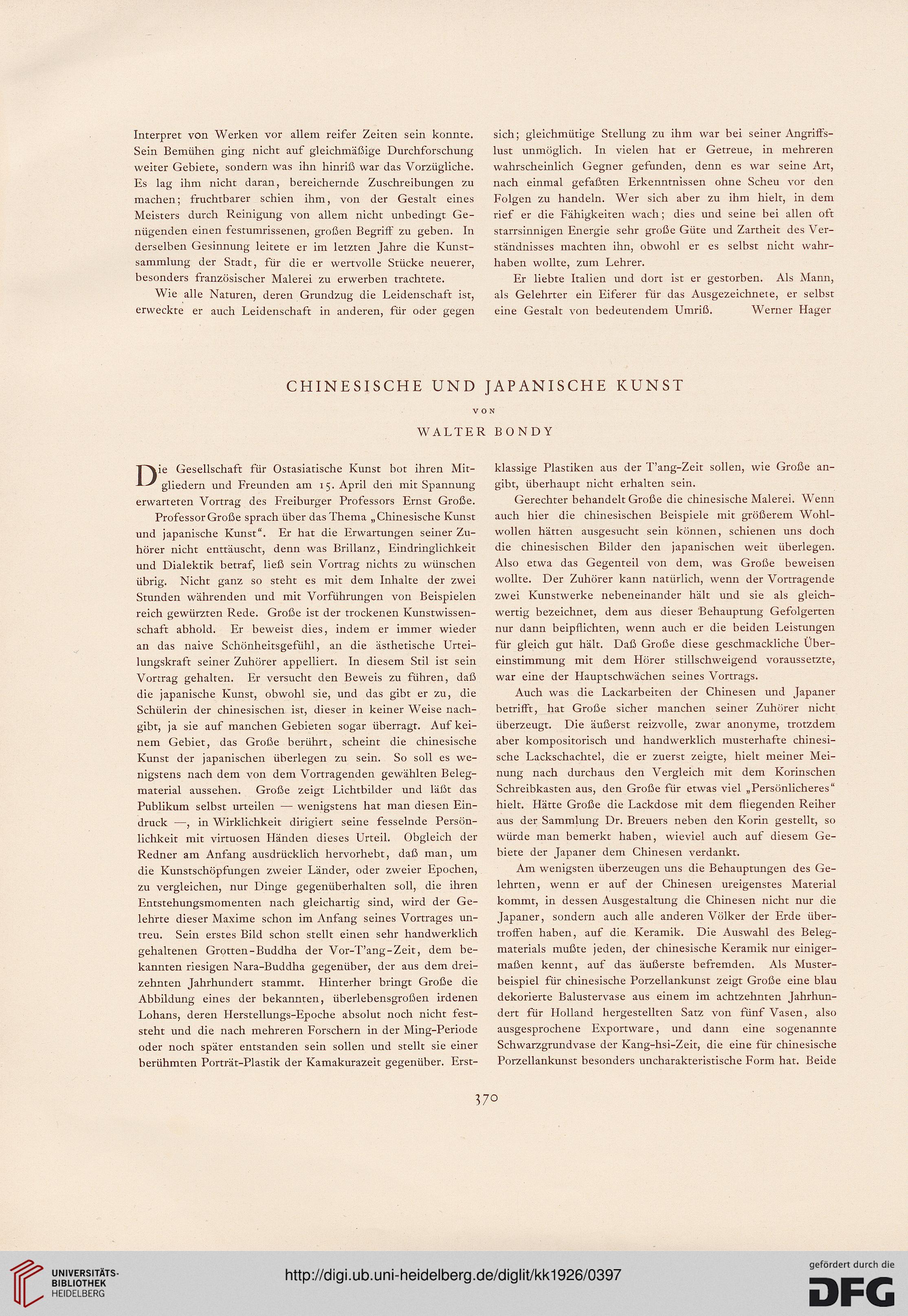Interpret von Werken vor allem reifer Zeiten sein konnte.
Sein Bemühen ging nicht auf gleichmäßige Durchforschung
weiter Gebiete, sondern was ihn hinriß war das Vorzügliche.
Es lag ihm nicht daran, bereichernde Zuschreibungen zu
machen; fruchtbarer schien ihm, von der Gestalt eines
Meisters durch Reinigung von allem nicht unbedingt Ge-
nügenden einen festumrissenen, großen Begriff zu geben. In
derselben Gesinnung leitete er im letzten Jahre die Kunst-
sammlung der Stadt, für die er wertvolle Stücke neuerer,
besonders französischer Malerei zu erwerben trachtete.
Wie alle Naturen, deren Grundzug die Leidenschaft ist,
erweckte er auch Leidenschaft in anderen, für oder gegen
sich; gleichmütige Stellung zu ihm war bei seiner Angriffs-
lust unmöglich. In vielen hat er Getreue, in mehreren
wahrscheinlich Gegner gefunden, denn es war seine Art,
nach einmal gefaßten Erkenntnissen ohne Scheu vor den
Folgen zu handeln. Wer sich aber zu ihm hielt, in dem
rief er die Fähigkeiten wach; dies und seine bei allen oft
starrsinnigen Energie sehr große Güte und Zartheit des Ver-
ständnisses machten ihn, obwohl er es selbst nicht wahr-
haben wollte, zum Lehrer.
Er liebte Italien und dort ist er gestorben. Als Mann,
als Gelehrter ein Eiferer für das Ausgezeichnete, er selbst
eine Gestalt von bedeutendem Umriß. Werner Hager
CHINESISCHE UND JAPANISCHE KUNST
WALTER BONDY
T^\ie Gesellschaft für Ostasiatische Kunst bot ihren Mit-
* ^ gliedern und Freunden am 15. April den mit Spannung
erwarteten Vortrag des Freiburger Professors Ernst Große.
Professor Große sprach über das Thema „Chinesische Kunst
und japanische Kunst". Er hat die Erwartungen seiner Zu-
hörer nicht enttäuscht, denn was Brillanz, Eindringlichkeit
und Dialektik betraf, ließ sein Vortrag nichts zu wünschen
übrig. Nicht ganz so steht es mit dem Inhalte der zwei
Stunden währenden und mit Vorführungen von Beispielen
reich gewürzten Rede. Große ist der trockenen Kunstwissen-
schaft abhold. Er beweist dies, indem er immer wieder
an das naive Schönheitsgefühl, an die ästhetische Urtei-
lungskraft seiner Zuhörer appelliert. In diesem Stil ist sein
Vortrag gehalten. Er versucht den Beweis zu führen, daß
die japanische Kunst, obwohl sie, und das gibt er zu, die
Schülerin der chinesischen isr, dieser in keiner Weise nach-
gibt, ja sie auf manchen Gebieten sogar überragt. Auf kei-
nem Gebiet, das Große berührt, scheint die chinesische
Kunst der japanischen überlegen zu sein. So soll es we-
nigstens nach dem von dem Vortragenden gewählten Beleg-
material aussehen. Große zeigt Lichtbilder und läßt das
Publikum selbst urteilen — wenigstens hat man diesen Ein-
druck —, in Wirklichkeit dirigiert seine fesselnde Persön-
lichkeit mit virtuosen Händen dieses Urteil. Obgleich der
Redner am Anfang ausdrücklich hervorhebt, daß man, um
die Kunstschöpfungen zweier Länder, oder zweier Epochen,
zu vergleichen, nur Dinge gegenüberhalten soll, die ihren
Entstehungsmomenten nach gleichartig sind, wird der Ge-
lehrte dieser Maxime schon im Anfang seines Vortrages un-
treu. Sein erstes Bild schon stellt einen sehr handwerklich
gehaltenen Grotten-Buddha der Vor-T'ang-Zeit, dem be-
kannten riesigen Nara-Buddha gegenüber, der aus dem drei-
zehnten Jahrhundert stammt. Hinterher bringt Große die
Abbildung eines der bekannten, überlebensgroßen irdenen
Lohans, deren Herstellungs-Epoche absolut noch nicht fest-
steht und die nach mehreren Forschern in der Ming-Periode
oder noch später entstanden sein sollen und stellt sie einer
berühmten Porträt-Plastik der Kamakurazeit gegenüber. Erst-
klassige Plastiken aus der T'ang-Zeit sollen, wie Große an-
gibt, überhaupt nicht erhalten sein.
Gerechter behandelt Große die chinesische Malerei. Wenn
auch hier die chinesischen Beispiele mit größerem Wohl-
wollen hätten ausgesucht sein können, schienen uns doch
die chinesischen Bilder den japanischen weit überlegen.
Also etwa das Gegenteil von dem, was Große beweisen
wollte. Der Zuhörer kann natürlich, wenn der Vortragende
zwei Kunstwerke nebeneinander hält und sie als gleich-
wertig bezeichnet, dem aus dieser 'Behauptung Gefolgerten
nur dann beipflichten, wenn auch er die beiden Leistungen
für gleich gut hält. Daß Große diese geschmackliche Uber-
einstimmung mit dem Hörer stillschweigend voraussetzte,
war eine der Hauptschwächen seines Vortrags.
Auch was die Lackarbeiten der Chinesen und Japaner
betrifft, hat Große sicher manchen seiner Zuhörer nicht
überzeugt. Die äußerst reizvolle, zwar anonyme, trotzdem
aber kompositorisch und handwerklich musterhafte chinesi-
sche Lackschachtel, die er zuerst zeigte, hielt meiner Mei-
nung nach durchaus den Vergleich mit dem Korinschen
Schreibkasten aus, den Große für etwas viel „Persönlicheres"
hielt. Hätte Große die Lackdose mit dem fliegenden Reiher
aus der Sammlung Dr. Breuers neben den Korin gestellt, so
würde man bemerkt haben, wieviel auch auf diesem Ge-
biete der Japaner dem Chinesen verdankt.
Am wenigsten überzeugen uns die Behauptungen des Ge-
lehrten, wenn er auf der Chinesen ureigenstes Material
kommt, in dessen Ausgestaltung die Chinesen nicht nur die
Japaner, sondern auch alle anderen Völker der Erde über-
troffen haben, auf die Keramik. Die Auswahl des Beleg-
materials mußte jeden, der chinesische Keramik nur einiger-
maßen kennt, auf das äußerste befremden. Als Muster-
beispiel für chinesische Porzellankunst zeigt Große eine blau
dekorierte Balustervase aus einem im achtzehnten Jahrhun-
dert für Holland hergestellten Satz von fünf Vasen, also
ausgesprochene Exportware, und dann eine sogenannte
Schwarzgrundvase der Kang-hsi-Zeit, die eine für chinesische
Porzellankunst besonders uncharakteristische Form hat. Beide
Sein Bemühen ging nicht auf gleichmäßige Durchforschung
weiter Gebiete, sondern was ihn hinriß war das Vorzügliche.
Es lag ihm nicht daran, bereichernde Zuschreibungen zu
machen; fruchtbarer schien ihm, von der Gestalt eines
Meisters durch Reinigung von allem nicht unbedingt Ge-
nügenden einen festumrissenen, großen Begriff zu geben. In
derselben Gesinnung leitete er im letzten Jahre die Kunst-
sammlung der Stadt, für die er wertvolle Stücke neuerer,
besonders französischer Malerei zu erwerben trachtete.
Wie alle Naturen, deren Grundzug die Leidenschaft ist,
erweckte er auch Leidenschaft in anderen, für oder gegen
sich; gleichmütige Stellung zu ihm war bei seiner Angriffs-
lust unmöglich. In vielen hat er Getreue, in mehreren
wahrscheinlich Gegner gefunden, denn es war seine Art,
nach einmal gefaßten Erkenntnissen ohne Scheu vor den
Folgen zu handeln. Wer sich aber zu ihm hielt, in dem
rief er die Fähigkeiten wach; dies und seine bei allen oft
starrsinnigen Energie sehr große Güte und Zartheit des Ver-
ständnisses machten ihn, obwohl er es selbst nicht wahr-
haben wollte, zum Lehrer.
Er liebte Italien und dort ist er gestorben. Als Mann,
als Gelehrter ein Eiferer für das Ausgezeichnete, er selbst
eine Gestalt von bedeutendem Umriß. Werner Hager
CHINESISCHE UND JAPANISCHE KUNST
WALTER BONDY
T^\ie Gesellschaft für Ostasiatische Kunst bot ihren Mit-
* ^ gliedern und Freunden am 15. April den mit Spannung
erwarteten Vortrag des Freiburger Professors Ernst Große.
Professor Große sprach über das Thema „Chinesische Kunst
und japanische Kunst". Er hat die Erwartungen seiner Zu-
hörer nicht enttäuscht, denn was Brillanz, Eindringlichkeit
und Dialektik betraf, ließ sein Vortrag nichts zu wünschen
übrig. Nicht ganz so steht es mit dem Inhalte der zwei
Stunden währenden und mit Vorführungen von Beispielen
reich gewürzten Rede. Große ist der trockenen Kunstwissen-
schaft abhold. Er beweist dies, indem er immer wieder
an das naive Schönheitsgefühl, an die ästhetische Urtei-
lungskraft seiner Zuhörer appelliert. In diesem Stil ist sein
Vortrag gehalten. Er versucht den Beweis zu führen, daß
die japanische Kunst, obwohl sie, und das gibt er zu, die
Schülerin der chinesischen isr, dieser in keiner Weise nach-
gibt, ja sie auf manchen Gebieten sogar überragt. Auf kei-
nem Gebiet, das Große berührt, scheint die chinesische
Kunst der japanischen überlegen zu sein. So soll es we-
nigstens nach dem von dem Vortragenden gewählten Beleg-
material aussehen. Große zeigt Lichtbilder und läßt das
Publikum selbst urteilen — wenigstens hat man diesen Ein-
druck —, in Wirklichkeit dirigiert seine fesselnde Persön-
lichkeit mit virtuosen Händen dieses Urteil. Obgleich der
Redner am Anfang ausdrücklich hervorhebt, daß man, um
die Kunstschöpfungen zweier Länder, oder zweier Epochen,
zu vergleichen, nur Dinge gegenüberhalten soll, die ihren
Entstehungsmomenten nach gleichartig sind, wird der Ge-
lehrte dieser Maxime schon im Anfang seines Vortrages un-
treu. Sein erstes Bild schon stellt einen sehr handwerklich
gehaltenen Grotten-Buddha der Vor-T'ang-Zeit, dem be-
kannten riesigen Nara-Buddha gegenüber, der aus dem drei-
zehnten Jahrhundert stammt. Hinterher bringt Große die
Abbildung eines der bekannten, überlebensgroßen irdenen
Lohans, deren Herstellungs-Epoche absolut noch nicht fest-
steht und die nach mehreren Forschern in der Ming-Periode
oder noch später entstanden sein sollen und stellt sie einer
berühmten Porträt-Plastik der Kamakurazeit gegenüber. Erst-
klassige Plastiken aus der T'ang-Zeit sollen, wie Große an-
gibt, überhaupt nicht erhalten sein.
Gerechter behandelt Große die chinesische Malerei. Wenn
auch hier die chinesischen Beispiele mit größerem Wohl-
wollen hätten ausgesucht sein können, schienen uns doch
die chinesischen Bilder den japanischen weit überlegen.
Also etwa das Gegenteil von dem, was Große beweisen
wollte. Der Zuhörer kann natürlich, wenn der Vortragende
zwei Kunstwerke nebeneinander hält und sie als gleich-
wertig bezeichnet, dem aus dieser 'Behauptung Gefolgerten
nur dann beipflichten, wenn auch er die beiden Leistungen
für gleich gut hält. Daß Große diese geschmackliche Uber-
einstimmung mit dem Hörer stillschweigend voraussetzte,
war eine der Hauptschwächen seines Vortrags.
Auch was die Lackarbeiten der Chinesen und Japaner
betrifft, hat Große sicher manchen seiner Zuhörer nicht
überzeugt. Die äußerst reizvolle, zwar anonyme, trotzdem
aber kompositorisch und handwerklich musterhafte chinesi-
sche Lackschachtel, die er zuerst zeigte, hielt meiner Mei-
nung nach durchaus den Vergleich mit dem Korinschen
Schreibkasten aus, den Große für etwas viel „Persönlicheres"
hielt. Hätte Große die Lackdose mit dem fliegenden Reiher
aus der Sammlung Dr. Breuers neben den Korin gestellt, so
würde man bemerkt haben, wieviel auch auf diesem Ge-
biete der Japaner dem Chinesen verdankt.
Am wenigsten überzeugen uns die Behauptungen des Ge-
lehrten, wenn er auf der Chinesen ureigenstes Material
kommt, in dessen Ausgestaltung die Chinesen nicht nur die
Japaner, sondern auch alle anderen Völker der Erde über-
troffen haben, auf die Keramik. Die Auswahl des Beleg-
materials mußte jeden, der chinesische Keramik nur einiger-
maßen kennt, auf das äußerste befremden. Als Muster-
beispiel für chinesische Porzellankunst zeigt Große eine blau
dekorierte Balustervase aus einem im achtzehnten Jahrhun-
dert für Holland hergestellten Satz von fünf Vasen, also
ausgesprochene Exportware, und dann eine sogenannte
Schwarzgrundvase der Kang-hsi-Zeit, die eine für chinesische
Porzellankunst besonders uncharakteristische Form hat. Beide