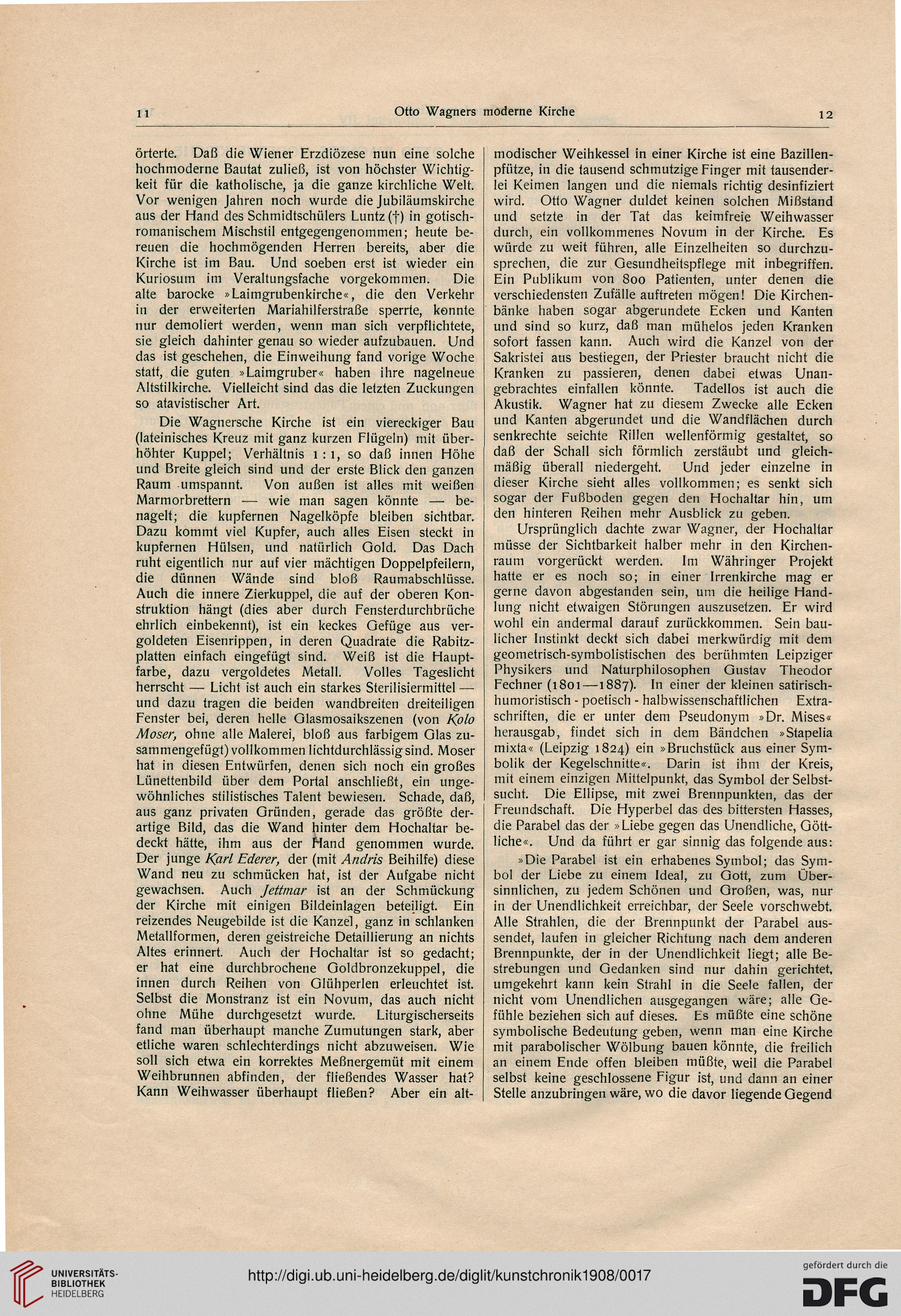\ i Otto Wagners
örterte. Daß die Wiener Erzdiözese nun eine solche
hochmoderne Bautat zuließ, ist von höchster Wichtig-
keit für die katholische, ja die ganze kirchliche Welt.
Vor wenigen Jahren noch wurde die Jubiläumskirche
aus der Hand des Schmidtschülers Luntz (f) in gotisch-
romanischem Mischstil entgegengenommen; heute be-
reuen die hochmögenden Herren bereits, aber die
Kirche ist im Bau. Und soeben erst ist wieder ein
Kuriosum im Veraltungsfache vorgekommen. Die
alte barocke »Laimgrubenkirche«, die den Verkehr
in der erweiterten Mariahilferstraße sperrte, konnte
nur demoliert werden, wenn man sich verpflichtete,
sie gleich dahinter genau so wieder aufzubauen. Und
das ist geschehen, die Einweihung fand vorige Woche
statt, die guten »Laimgruber« haben ihre nagelneue
Altstilkirche. Vielleicht sind das die letzten Zuckungen
so atavistischer Art.
Die Wagnersche Kirche ist ein viereckiger Bau
(lateinisches Kreuz mit ganz kurzen Flügeln) mit über-
höhter Kuppel; Verhältnis 1 :1, so daß innen Höhe
und Breite gleich sind und der erste Blick den ganzen
Raum umspannt. Von außen ist alles mit weißen
Marmorbrettern — wie man sagen könnte — be-
nagelt; die kupfernen Nagelköpfe bleiben sichtbar.
Dazu kommt viel Kupfer, auch alles Eisen steckt in
kupfernen Hülsen, und natürlich Gold. Das Dach
ruht eigentlich nur auf vier mächtigen Doppelpfeilern,
die dünnen Wände sind bloß Raumabschlüsse.
Auch die innere Zierkuppel, die auf der oberen Kon-
struktion hängt (dies aber durch Fensterdurchbrüche
ehrlich einbekennt), ist ein keckes Oefüge aus ver-
goldeten Eisenrippen, in deren Quadrate die Rabitz-
platten einfach eingefügt sind. Weiß ist die Haupt-
farbe, dazu vergoldetes Metall. Volles Tageslicht
herrscht — Licht ist auch ein starkes Sterilisiermittel —
und dazu tragen die beiden wandbreiten dreiteiligen
Fenster bei, deren helle Glasmosaikszenen (von Kolo
Moser, ohne alle Malerei, bloß aus farbigem Glas zu-
sammengefügt) vollkommen lichtdurchlässig sind. Moser
hat in diesen Entwürfen, denen sich noch ein großes
Lünettenbild über dem Portal anschließt, ein unge-
wöhnliches stilistisches Talent bewiesen. Schade, daß,
aus ganz privaten Gründen, gerade das größte der-
artige Bild, das die Wand hinter dem Hochaltar be-
deckt hätte, ihm aus der Hand genommen wurde.
Der junge Kßrl Ederer, der (mit Andris Beihilfe) diese
Wand neu zu schmücken hat, ist der Aufgabe nicht
gewachsen. Auch Jettmar ist an der Schmückung
der Kirche mit einigen Bildeinlagen beteiligt. Ein
reizendes Neugebilde ist die Kanzel, ganz in schlanken
Metallformen, deren geistreiche Detaillierung an nichts
Altes erinnert. Auch der Hochaltar ist so gedacht;
er hat eine durchbrochene Golclbronzekuppel, die
innen durch Reihen von Glühperlen erleuchtet ist.
Selbst die Monstranz ist ein Novum, das auch nicht
ohne Mühe durchgesetzt wurde. Liturgischerseits
fand man überhaupt manche Zumutungen stark, aber
etliche waren schlechterdings nicht abzuweisen. Wie
soll sich etwa ein korrektes Meßnergemüt mit einem
Weihbrunnen abfinden, der fließendes Wasser hat?
Kann Weihwasser überhaupt fließen? Aber ein alt-
öderne Kirche 12
modischer Weihkessel in einer Kirche ist eine Bazillen-
pfütze, in die tausend schmutzige Finger mit tausender-
lei Keimen langen und die niemals richtig desinfiziert
wird. Otto Wagner duldet keinen solchen Mißstand
und setzte in der Tat das keimfreie Weihwasser
durch, ein vollkommenes Novum in der Kirche. Es
würde zu weit führen, alle Einzelheiten so durchzu-
sprechen, die zur Gesundheitspflege mit inbegriffen.
Ein Publikum von 800 Patienten, unter denen die
verschiedensten Zufälle auftreten mögen! Die Kirchen-
bänke haben sogar abgerundete Ecken und Kanten
und sind so kurz, daß man mühelos jeden Kranken
sofort fassen kann. Auch wird die Kanzel von der
Sakristei aus bestiegen, der Priester braucht nicht die
Kranken zu passieren, denen dabei etwas Unan-
gebrachtes einfallen könnte. Tadellos ist auch die
Akustik. Wagner hat zu diesem Zwecke alle Ecken
und Kanten abgerundet und die Wandflächen durch
senkrechte seichte Rillen wellenförmig gestaltet, so
daß der Schall sich förmlich zerstäubt und gleich-
mäßig überall niedergeht. Und jeder einzelne in
dieser Kirche sieht alles vollkommen; es senkt sich
sogar der Fußboden gegen den Hochaltar hin, um
den hinteren Reihen mehr Ausblick zu geben.
Ursprünglich dachte zwar Wagner, der Hochaltar
müsse der Sichtbarkeit halber mehr in den Kirchen-
raum vorgerückt werden. Im Währinger Projekt
hatte er es noch so; in einer Irrenkirche mag er
gerne davon abgestanden sein, um die heilige Hand-
lung nicht etwaigen Störungen auszusetzen. Er wird
wohl ein andermal darauf zurückkommen. Sein bau-
licher Instinkt deckt sich dabei merkwürdig mit dem
geometrisch-symbolistischen des berühmten Leipziger
Physikers und Naturphilosophen Gustav Theodor
Fechner (1801—1887). In einer der kleinen satirisch-
humoristisch - poetisch - halbwissenschaftlichen Extra-
schriften, die er unter dem Pseudonym »Dr. Mises«
herausgab, findet sich in dem Bändchen »Stapelia
mixta« (Leipzig 1824) ein »Bruchstück aus einer Sym-
bolik der Kegelschnitte«. Darin ist ihm der Kreis,
mit einem einzigen Mittelpunkt, das Symbol der Selbst-
sucht. Die Ellipse, mit zwei Brennpunkten, das der
Freundschaft. Die Hyperbel das des bittersten Hasses,
die Parabel das der »Liebe gegen das Unendliche, Gött-
liche«. Und da führt er gar sinnig das folgende aus:
»Die Parabel ist ein erhabenes Symbol; das Sym-
bol der Liebe zu einem Ideal, zu Gott, zum Über-
sinnlichen, zu jedem Schönen und Großen, was, nur
in der Unendlichkeit erreichbar, der Seele vorschwebt.
Alle Strahlen, die der Brennpunkt der Parabel aus-
sendet, laufen in gleicher Richtung nach dem anderen
Brennpunkte, der in der Unendlichkeit liegt; alle Be-
strebungen und Gedanken sind nur dahin gerichtet,
umgekehrt kann kein Strahl in die Seele fallen, der
nicht vom Unendlichen ausgegangen wäre; alle Ge-
fühle beziehen sich auf dieses. Es müßte eine schöne
symbolische Bedeutung geben, wenn man eine Kirche
mit parabolischer Wölbung bauen könnte, die freilich
an einem Ende offen bleiben müßte, weil die Parabel
selbst keine geschlossene Figur ist, und dann an einer
Stelle anzubringen wäre, wo die davor liegende Gegend
örterte. Daß die Wiener Erzdiözese nun eine solche
hochmoderne Bautat zuließ, ist von höchster Wichtig-
keit für die katholische, ja die ganze kirchliche Welt.
Vor wenigen Jahren noch wurde die Jubiläumskirche
aus der Hand des Schmidtschülers Luntz (f) in gotisch-
romanischem Mischstil entgegengenommen; heute be-
reuen die hochmögenden Herren bereits, aber die
Kirche ist im Bau. Und soeben erst ist wieder ein
Kuriosum im Veraltungsfache vorgekommen. Die
alte barocke »Laimgrubenkirche«, die den Verkehr
in der erweiterten Mariahilferstraße sperrte, konnte
nur demoliert werden, wenn man sich verpflichtete,
sie gleich dahinter genau so wieder aufzubauen. Und
das ist geschehen, die Einweihung fand vorige Woche
statt, die guten »Laimgruber« haben ihre nagelneue
Altstilkirche. Vielleicht sind das die letzten Zuckungen
so atavistischer Art.
Die Wagnersche Kirche ist ein viereckiger Bau
(lateinisches Kreuz mit ganz kurzen Flügeln) mit über-
höhter Kuppel; Verhältnis 1 :1, so daß innen Höhe
und Breite gleich sind und der erste Blick den ganzen
Raum umspannt. Von außen ist alles mit weißen
Marmorbrettern — wie man sagen könnte — be-
nagelt; die kupfernen Nagelköpfe bleiben sichtbar.
Dazu kommt viel Kupfer, auch alles Eisen steckt in
kupfernen Hülsen, und natürlich Gold. Das Dach
ruht eigentlich nur auf vier mächtigen Doppelpfeilern,
die dünnen Wände sind bloß Raumabschlüsse.
Auch die innere Zierkuppel, die auf der oberen Kon-
struktion hängt (dies aber durch Fensterdurchbrüche
ehrlich einbekennt), ist ein keckes Oefüge aus ver-
goldeten Eisenrippen, in deren Quadrate die Rabitz-
platten einfach eingefügt sind. Weiß ist die Haupt-
farbe, dazu vergoldetes Metall. Volles Tageslicht
herrscht — Licht ist auch ein starkes Sterilisiermittel —
und dazu tragen die beiden wandbreiten dreiteiligen
Fenster bei, deren helle Glasmosaikszenen (von Kolo
Moser, ohne alle Malerei, bloß aus farbigem Glas zu-
sammengefügt) vollkommen lichtdurchlässig sind. Moser
hat in diesen Entwürfen, denen sich noch ein großes
Lünettenbild über dem Portal anschließt, ein unge-
wöhnliches stilistisches Talent bewiesen. Schade, daß,
aus ganz privaten Gründen, gerade das größte der-
artige Bild, das die Wand hinter dem Hochaltar be-
deckt hätte, ihm aus der Hand genommen wurde.
Der junge Kßrl Ederer, der (mit Andris Beihilfe) diese
Wand neu zu schmücken hat, ist der Aufgabe nicht
gewachsen. Auch Jettmar ist an der Schmückung
der Kirche mit einigen Bildeinlagen beteiligt. Ein
reizendes Neugebilde ist die Kanzel, ganz in schlanken
Metallformen, deren geistreiche Detaillierung an nichts
Altes erinnert. Auch der Hochaltar ist so gedacht;
er hat eine durchbrochene Golclbronzekuppel, die
innen durch Reihen von Glühperlen erleuchtet ist.
Selbst die Monstranz ist ein Novum, das auch nicht
ohne Mühe durchgesetzt wurde. Liturgischerseits
fand man überhaupt manche Zumutungen stark, aber
etliche waren schlechterdings nicht abzuweisen. Wie
soll sich etwa ein korrektes Meßnergemüt mit einem
Weihbrunnen abfinden, der fließendes Wasser hat?
Kann Weihwasser überhaupt fließen? Aber ein alt-
öderne Kirche 12
modischer Weihkessel in einer Kirche ist eine Bazillen-
pfütze, in die tausend schmutzige Finger mit tausender-
lei Keimen langen und die niemals richtig desinfiziert
wird. Otto Wagner duldet keinen solchen Mißstand
und setzte in der Tat das keimfreie Weihwasser
durch, ein vollkommenes Novum in der Kirche. Es
würde zu weit führen, alle Einzelheiten so durchzu-
sprechen, die zur Gesundheitspflege mit inbegriffen.
Ein Publikum von 800 Patienten, unter denen die
verschiedensten Zufälle auftreten mögen! Die Kirchen-
bänke haben sogar abgerundete Ecken und Kanten
und sind so kurz, daß man mühelos jeden Kranken
sofort fassen kann. Auch wird die Kanzel von der
Sakristei aus bestiegen, der Priester braucht nicht die
Kranken zu passieren, denen dabei etwas Unan-
gebrachtes einfallen könnte. Tadellos ist auch die
Akustik. Wagner hat zu diesem Zwecke alle Ecken
und Kanten abgerundet und die Wandflächen durch
senkrechte seichte Rillen wellenförmig gestaltet, so
daß der Schall sich förmlich zerstäubt und gleich-
mäßig überall niedergeht. Und jeder einzelne in
dieser Kirche sieht alles vollkommen; es senkt sich
sogar der Fußboden gegen den Hochaltar hin, um
den hinteren Reihen mehr Ausblick zu geben.
Ursprünglich dachte zwar Wagner, der Hochaltar
müsse der Sichtbarkeit halber mehr in den Kirchen-
raum vorgerückt werden. Im Währinger Projekt
hatte er es noch so; in einer Irrenkirche mag er
gerne davon abgestanden sein, um die heilige Hand-
lung nicht etwaigen Störungen auszusetzen. Er wird
wohl ein andermal darauf zurückkommen. Sein bau-
licher Instinkt deckt sich dabei merkwürdig mit dem
geometrisch-symbolistischen des berühmten Leipziger
Physikers und Naturphilosophen Gustav Theodor
Fechner (1801—1887). In einer der kleinen satirisch-
humoristisch - poetisch - halbwissenschaftlichen Extra-
schriften, die er unter dem Pseudonym »Dr. Mises«
herausgab, findet sich in dem Bändchen »Stapelia
mixta« (Leipzig 1824) ein »Bruchstück aus einer Sym-
bolik der Kegelschnitte«. Darin ist ihm der Kreis,
mit einem einzigen Mittelpunkt, das Symbol der Selbst-
sucht. Die Ellipse, mit zwei Brennpunkten, das der
Freundschaft. Die Hyperbel das des bittersten Hasses,
die Parabel das der »Liebe gegen das Unendliche, Gött-
liche«. Und da führt er gar sinnig das folgende aus:
»Die Parabel ist ein erhabenes Symbol; das Sym-
bol der Liebe zu einem Ideal, zu Gott, zum Über-
sinnlichen, zu jedem Schönen und Großen, was, nur
in der Unendlichkeit erreichbar, der Seele vorschwebt.
Alle Strahlen, die der Brennpunkt der Parabel aus-
sendet, laufen in gleicher Richtung nach dem anderen
Brennpunkte, der in der Unendlichkeit liegt; alle Be-
strebungen und Gedanken sind nur dahin gerichtet,
umgekehrt kann kein Strahl in die Seele fallen, der
nicht vom Unendlichen ausgegangen wäre; alle Ge-
fühle beziehen sich auf dieses. Es müßte eine schöne
symbolische Bedeutung geben, wenn man eine Kirche
mit parabolischer Wölbung bauen könnte, die freilich
an einem Ende offen bleiben müßte, weil die Parabel
selbst keine geschlossene Figur ist, und dann an einer
Stelle anzubringen wäre, wo die davor liegende Gegend