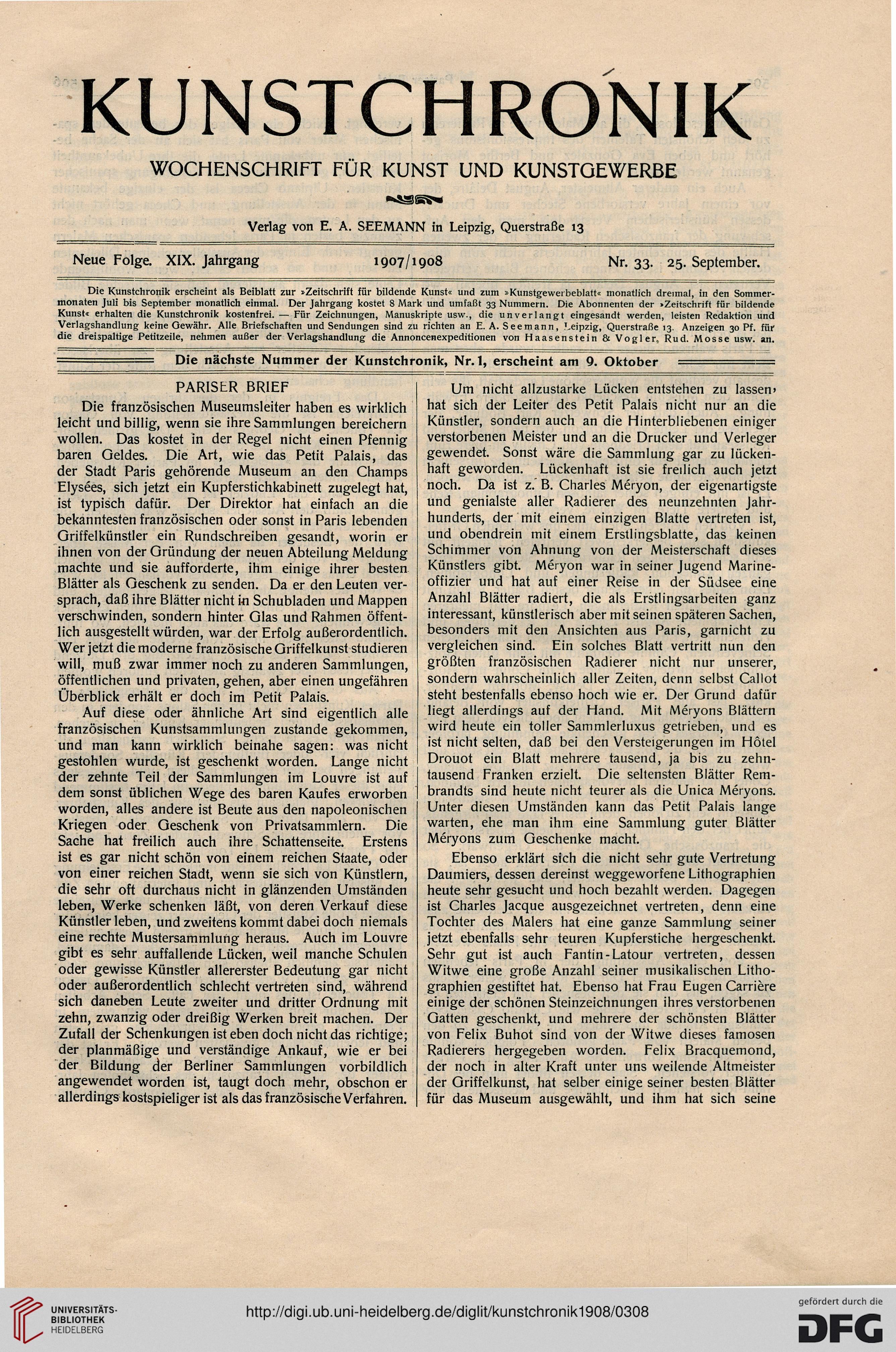KUNSTCHRONIK
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XIX. Jahrgang 1907/1908 Nr. 33. 25. September.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E.A.Seemann, '«eipzig, Querstraße 13 Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
Die nächste Nummer der Kunstchronik, Nr. 1, erscheint am 9. Oktober
PAR1SLR BRIEF
Die französischen Museumsleiter haben es wirklich
leicht und billig, wenn sie ihre Sammlungen bereichern
wollen. Das kostet in der Regel nicht einen Pfennig
baren Geldes. Die Art, wie das Petit Palais, das
der Stadt Paris gehörende Museum an den Champs
Elysees, sich jetzt ein Kupferstichkabinett zugelegt hat,
ist typisch dafür. Der Direktor hat einfach an die
bekanntesten französischen oder sonst in Paris lebenden
Griffelkünstler ein Rundschreiben gesandt, worin er
ihnen von der Gründung der neuen Abteilung Meldung
machte und sie aufforderte, ihm einige ihrer besten
Blätter als Geschenk zu senden. Da er den Leuten ver-
sprach, daß ihre Blätter nicht i-n Schubladen und Mappen
verschwinden, sondern hinter Glas und Rahmen öffent-
lich ausgestellt würden, war der Erfolg außerordentlich.
Wer j'etzt die moderne französische Griffelkunst studieren
will, muß zwar immer noch zu anderen Sammlungen,
öffentlichen und privaten, gehen, aber einen ungefähren
Überblick erhält er doch im Petit Palais.
Auf diese oder ähnliche Art sind eigentlich alle
französischen Kunstsammlungen zustande gekommen,
und man kann wirklich beinahe sagen: was nicht
gestohlen wurde, ist geschenkt worden. Lange nicht
der zehnte Teil der Sammlungen im Louvre ist auf
dem sonst üblichen Wege des baren Kaufes erworben
worden, alles andere ist Beute aus den napoleonischen
Kriegen oder Geschenk von Privatsammlern. Die
Sache hat freilich auch ihre Schattenseite. Erstens
ist es gar nicht schön von einem reichen Staate, oder
von einer reichen Stadt, wenn sie sich von Künstlern,
die sehr oft durchaus nicht in glänzenden Umständen
leben, Werke schenken läßt, von deren Verkauf diese
Künstler leben, und zweitens kommt dabei doch niemals
eine rechte Mustersammlung heraus. Auch im Louvre
gibt es sehr auffallende Lücken, weil manche Schulen
oder gewisse Künstler allererster Bedeutung gar nicht
oder außerordentlich schlecht vertreten sind, während
sich daneben Leute zweiter und dritter Ordnung mit
zehn, zwanzig oder dreißig Werken breit machen. Der
Zufall der Schenkungen ist eben doch nicht das richtige;
der planmäßige und verständige Ankauf, wie er bei
der Bildung der Berliner Sammlungen vorbildlich
angewendet worden ist, taugt doch mehr, obschon er
allerdings kostspieliger ist als das französische Verfahren.
Um nicht allzustarke Lücken entstehen zu lassen'
hat sich der Leiter des Petit Palais nicht nur an die
Künstler, sondern auch an die Hinterbliebenen einiger
verstorbenen Meister und an die Drucker und Verleger
gewendet. Sonst wäre die Sammlung gar zu lücken-
haft geworden. Lückenhaft ist sie freilich auch jetzt
noch. Da ist z. B. Charles Meryon, der eigenartigste
und genialste aller Radierer des neunzehnten Jahr-
hunderts, der mit einem einzigen Blatte vertreten ist,
und obendrein mit einem Erstlingsblatte, das keinen
Schimmer von Ahnung von der Meisterschaft dieses
Künstlers gibt. Meryon war in seiner Jugend Marine-
offizier und hat auf einer Reise in der Südsee eine
Anzahl Blätter radiert, die als Erstlingsarbeiten ganz
interessant, künstlerisch aber mit seinen späteren Sachen,
besonders mit den Ansichten aus Paris, garnicht zu
vergleichen sind. Ein solches Blatt vertritt nun den
größten französischen Radierer nicht nur unserer,
sondern wahrscheinlich aller Zeiten, denn selbst Callot
steht bestenfalls ebenso hoch wie er. Der Grund dafür
liegt allerdings auf der Hand. Mit Meryons Blättern
wird heute ein toller Sammlerluxus getrieben, und es
ist nicht selten, daß bei den Versteigerungen im Hotel
Drouot ein Blatt mehrere tausend, ja bis zu zehn-
tausend Franken erzielt. Die seltensten Blätter Rem-
brandts sind heute nicht teurer als die Unica Meryons.
Unter diesen Umständen kann das Petit Palais lange
warten, ehe man ihm eine Sammlung guter Blätter
Meryons zum Geschenke macht.
Ebenso erklärt sich die nicht sehr gute Vertretung
Daumiers, dessen dereinst weggeworfene Lithographien
heute sehr gesucht und hoch bezahlt werden. Dagegen
ist Charles Jacque ausgezeichnet vertreten, denn eine
Tochter des Malers hat eine ganze Sammlung seiner
jetzt ebenfalls sehr teuren Kupferstiche hergeschenkt.
Sehr gut ist auch Fantin-Latour vertreten, dessen
Witwe eine große Anzahl seiner musikalischen Litho-
graphien gestiftet hat. Ebenso hat Frau Eugen Carriere
einige der schönen Steinzeichnungen ihres verstorbenen
Gatten geschenkt, und mehrere der schönsten Blätter
von Felix Buhot sind von der Witwe dieses famosen
Radierers hergegeben worden. Felix Bracquemond,
der noch in alter Kraft unter uns weilende Altmeister
der Griffelkunst, hat selber einige seiner besten Blätter
für das Museum ausgewählt, und ihm hat sich seine
WOCHENSCHRIFT FÜR KUNST UND KUNSTGEWERBE
Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig, Querstraße 13
Neue Folge. XIX. Jahrgang 1907/1908 Nr. 33. 25. September.
Die Kunstchronik erscheint als Beiblatt zur »Zeitschrift für bildende Kunst« und zum »Kunstgewerbeblatt« monatlich dreimal, in den Sommer-
monaten Juli bis September monatlich einmal. Der Jahrgang kostet 8 Mark und umfaßt 33 Nummern. Die Abonnenten der »Zeitschrift für bildende
Kunst« erhalten die Kunstchronik kostenfrei. — Für Zeichnungen, Manuskripte usw., die unverlangt eingesandt werden, leisten Redaktion und
Verlagshandlung keine Gewähr. Alle Briefschaften und Sendungen sind zu richten an E.A.Seemann, '«eipzig, Querstraße 13 Anzeigen 30 Pf. für
die dreispaltige Petitzeile, nehmen außer der Verlagshandlung die Annoncenexpeditionen von Haasenstein & Vogler, Rud. Mosse usw. an.
Die nächste Nummer der Kunstchronik, Nr. 1, erscheint am 9. Oktober
PAR1SLR BRIEF
Die französischen Museumsleiter haben es wirklich
leicht und billig, wenn sie ihre Sammlungen bereichern
wollen. Das kostet in der Regel nicht einen Pfennig
baren Geldes. Die Art, wie das Petit Palais, das
der Stadt Paris gehörende Museum an den Champs
Elysees, sich jetzt ein Kupferstichkabinett zugelegt hat,
ist typisch dafür. Der Direktor hat einfach an die
bekanntesten französischen oder sonst in Paris lebenden
Griffelkünstler ein Rundschreiben gesandt, worin er
ihnen von der Gründung der neuen Abteilung Meldung
machte und sie aufforderte, ihm einige ihrer besten
Blätter als Geschenk zu senden. Da er den Leuten ver-
sprach, daß ihre Blätter nicht i-n Schubladen und Mappen
verschwinden, sondern hinter Glas und Rahmen öffent-
lich ausgestellt würden, war der Erfolg außerordentlich.
Wer j'etzt die moderne französische Griffelkunst studieren
will, muß zwar immer noch zu anderen Sammlungen,
öffentlichen und privaten, gehen, aber einen ungefähren
Überblick erhält er doch im Petit Palais.
Auf diese oder ähnliche Art sind eigentlich alle
französischen Kunstsammlungen zustande gekommen,
und man kann wirklich beinahe sagen: was nicht
gestohlen wurde, ist geschenkt worden. Lange nicht
der zehnte Teil der Sammlungen im Louvre ist auf
dem sonst üblichen Wege des baren Kaufes erworben
worden, alles andere ist Beute aus den napoleonischen
Kriegen oder Geschenk von Privatsammlern. Die
Sache hat freilich auch ihre Schattenseite. Erstens
ist es gar nicht schön von einem reichen Staate, oder
von einer reichen Stadt, wenn sie sich von Künstlern,
die sehr oft durchaus nicht in glänzenden Umständen
leben, Werke schenken läßt, von deren Verkauf diese
Künstler leben, und zweitens kommt dabei doch niemals
eine rechte Mustersammlung heraus. Auch im Louvre
gibt es sehr auffallende Lücken, weil manche Schulen
oder gewisse Künstler allererster Bedeutung gar nicht
oder außerordentlich schlecht vertreten sind, während
sich daneben Leute zweiter und dritter Ordnung mit
zehn, zwanzig oder dreißig Werken breit machen. Der
Zufall der Schenkungen ist eben doch nicht das richtige;
der planmäßige und verständige Ankauf, wie er bei
der Bildung der Berliner Sammlungen vorbildlich
angewendet worden ist, taugt doch mehr, obschon er
allerdings kostspieliger ist als das französische Verfahren.
Um nicht allzustarke Lücken entstehen zu lassen'
hat sich der Leiter des Petit Palais nicht nur an die
Künstler, sondern auch an die Hinterbliebenen einiger
verstorbenen Meister und an die Drucker und Verleger
gewendet. Sonst wäre die Sammlung gar zu lücken-
haft geworden. Lückenhaft ist sie freilich auch jetzt
noch. Da ist z. B. Charles Meryon, der eigenartigste
und genialste aller Radierer des neunzehnten Jahr-
hunderts, der mit einem einzigen Blatte vertreten ist,
und obendrein mit einem Erstlingsblatte, das keinen
Schimmer von Ahnung von der Meisterschaft dieses
Künstlers gibt. Meryon war in seiner Jugend Marine-
offizier und hat auf einer Reise in der Südsee eine
Anzahl Blätter radiert, die als Erstlingsarbeiten ganz
interessant, künstlerisch aber mit seinen späteren Sachen,
besonders mit den Ansichten aus Paris, garnicht zu
vergleichen sind. Ein solches Blatt vertritt nun den
größten französischen Radierer nicht nur unserer,
sondern wahrscheinlich aller Zeiten, denn selbst Callot
steht bestenfalls ebenso hoch wie er. Der Grund dafür
liegt allerdings auf der Hand. Mit Meryons Blättern
wird heute ein toller Sammlerluxus getrieben, und es
ist nicht selten, daß bei den Versteigerungen im Hotel
Drouot ein Blatt mehrere tausend, ja bis zu zehn-
tausend Franken erzielt. Die seltensten Blätter Rem-
brandts sind heute nicht teurer als die Unica Meryons.
Unter diesen Umständen kann das Petit Palais lange
warten, ehe man ihm eine Sammlung guter Blätter
Meryons zum Geschenke macht.
Ebenso erklärt sich die nicht sehr gute Vertretung
Daumiers, dessen dereinst weggeworfene Lithographien
heute sehr gesucht und hoch bezahlt werden. Dagegen
ist Charles Jacque ausgezeichnet vertreten, denn eine
Tochter des Malers hat eine ganze Sammlung seiner
jetzt ebenfalls sehr teuren Kupferstiche hergeschenkt.
Sehr gut ist auch Fantin-Latour vertreten, dessen
Witwe eine große Anzahl seiner musikalischen Litho-
graphien gestiftet hat. Ebenso hat Frau Eugen Carriere
einige der schönen Steinzeichnungen ihres verstorbenen
Gatten geschenkt, und mehrere der schönsten Blätter
von Felix Buhot sind von der Witwe dieses famosen
Radierers hergegeben worden. Felix Bracquemond,
der noch in alter Kraft unter uns weilende Altmeister
der Griffelkunst, hat selber einige seiner besten Blätter
für das Museum ausgewählt, und ihm hat sich seine