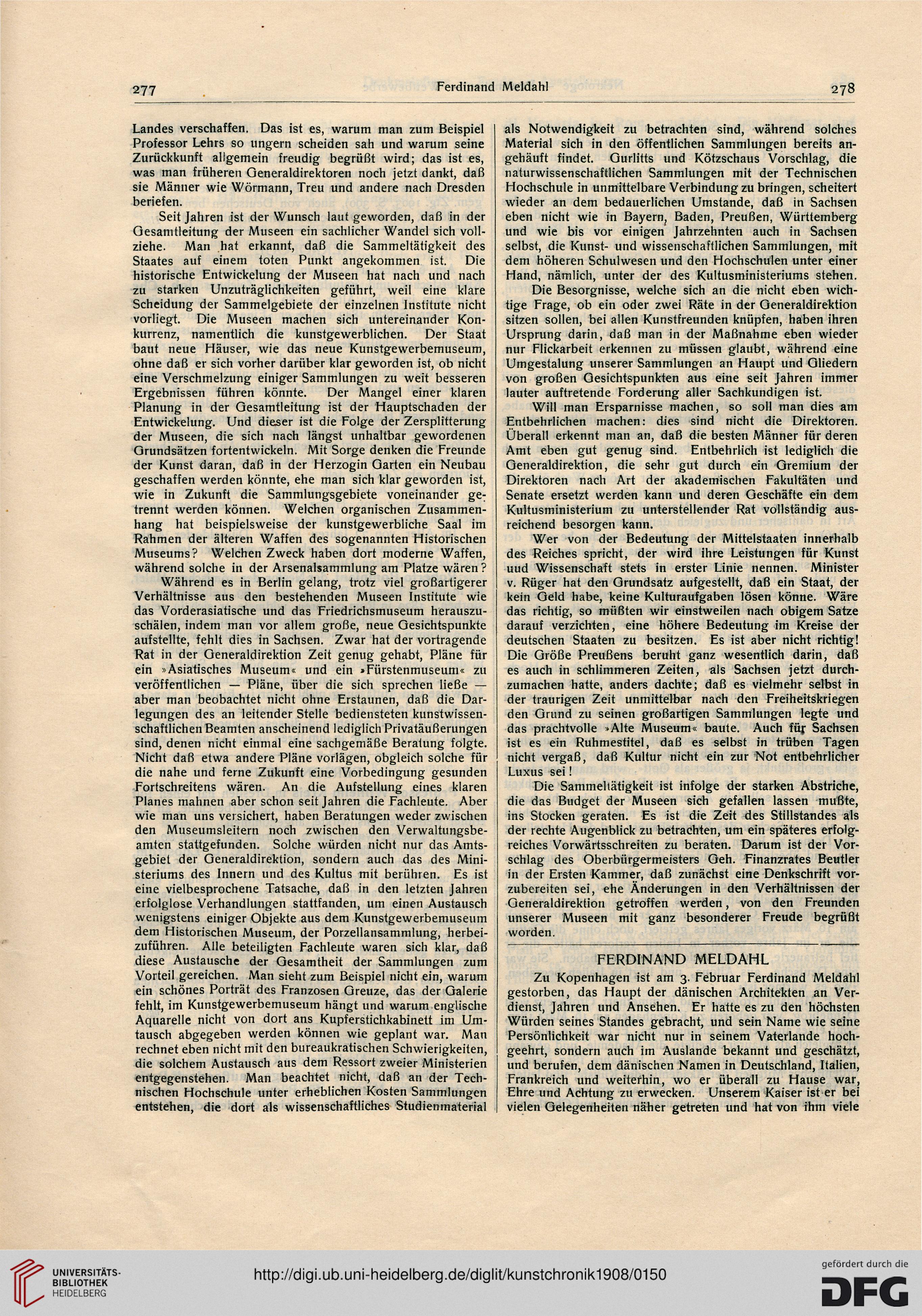277
Ferdinand Meldah!
278
Landes verschaffen. Das ist es, warum man zum Beispiel
Professor Lehrs so ungern scheiden sah und warum seine
Zurückkunft allgemein freudig begrüßt wird; das ist es,
was man früheren Generaldirektoren noch jetzt dankt, daß
sie Männer wie Wörmann, Treu und andere nach Dresden
beriefen.
Seit Jahren ist der Wunsch laut geworden, daß in der
Qesamtleitung der Museen ein sachlicher Wandel sich voll-
ziehe. Man hat erkannt, daß die Sammeltätigkeit des
Staates auf einem toten Punkt angekommen ist. Die
historische Entwickelung der Museen hat nach und nach
zu starken Unzuträglichkeiten geführt, weil eine klare
Scheidung der Sammelgebiete der einzelnen Institute nicht
vorliegt. Die Museen machen sich untereinander Kon-
kurrenz, namentlich die kunstgewerblichen. Der Staat
baut neue Häuser, wie das neue Kunstgewerbemuseum,
ohne daß er sich vorher darüber klar geworden ist, ob nicht
eine Verschmelzung einiger Sammlungen zu weit besseren
Ergebnissen führen könnte. Der Mangel einer klaren
Planung in der Oesamtleitung ist der Hauptschaden der
Entwickelung. Und dieser ist die Folge der Zersplitterung
der Museen, die sich nach längst unhaltbar gewordenen
Grundsätzen fortentwickeln. Mit Sorge denken die Freunde
der Kunst daran, daß in der Herzogin Garten ein Neubau
geschaffen werden könnte, ehe man sich klar geworden ist,
wie in Zukunft die Sammlungsgebiete voneinander ge-
trennt werden können. Welchen organischen Zusammen-
hang hat beispielsweise der kunstgewerbliche Saal im
Rahmen der älteren Waffen des sogenannten Historischen
Museums? Welchen Zweck haben dort moderne Waffen,
während solche in der Arsenalsammlung am Platze wären?
Während es in Berlin gelang, trotz viel großartigerer
Verhältnisse aus den bestehenden Museen Institute wie
das Vorderasiatische und das Friedrichsmuseum herauszu-
schälen, indem man vor allem große, neue Gesichtspunkte
aufstellte, fehlt dies in Sachsen. Zwar hat der vortragende
Rat in der Generaldirektion Zeit genug gehabt, Pläne für
ein »Asiatisches Museum« und ein »Fürstenmuseum« ru
veröffentlichen — Pläne, über die sich sprechen ließe —
aber man beobachtet nicht ohne Erstaunen, daß die Dar-
legungen des an leitender Stelle bediensteten kunstwissen-
schaftlichen Beamten anscheinend lediglich Privatäußerungen
sind, denen nicht einmal eine sachgemäße Beratung folgte.
Nicht daß etwa andere Pläne vorlägen, obgleich solche für
die nahe und ferne Zukunft eine Vorbedingung gesunden
Fortschreitens wären. An die Aufstellung eines klaren
Planes mahnen aber schon seit Jahren die Fachleute. Aber
wie man uns versichert, haben Beratungen weder zwischen
den Museumsleitern noch zwischen den Verwaltungsbe-
amten stattgefunden. Solche würden nicht nur das Amts-
gebiet der Generaldirektion, sondern auch das des Mini-
steriums des Innern und des Kultus mit berühren. Es ist
eine vielbesprochene Tatsache, daß in den letzten Jahren
erfolglose Verhandlungen stattfanden, um einen Austausch
wenigstens einiger Objekte aus dem Kunstgewerbemuseum
dem Historischen Museum, der Porzellansammlung, herbei-
zuführen. Alle beteiligten Fachleute waren sich klar, daß
diese Austausche der Gesamtheit der Sammlungen zum
Vorteil gereichen. Man sieht zum Beispiel nicht ein, warum
ein schönes Porträt des Franzosen Greuze, das der Galerie
fehlt, im Kunstgewerbemuseum hängt und warum englische
Aquarelle nicht von dort ans Kupferstichkabinett im Um-
tausch abgegeben werden können wie geplant war. Man
rechnet eben nicht mit den bureaukratischen Schwierigkeiten,
die solchem Austausch aus dem Ressort zweier Ministerien
entgegenstehen. Man beachtet nicht, daß an der Tech-
nischen Hochschule unter erheblichen Kosten Sammlungen
entstehen, die dort als wissenschaftliches Studienmaterial
als Notwendigkeit zu betrachten sind, während solches
Material sich in den öffentlichen Sammlungen bereits an-
gehäuft findet. Gurlitts und Kötzschaus Vorschlag, die
naturwissenschaftlichen Sammlungen mit der Technischen
Hochschule in unmittelbare Verbindung zu bringen, scheitert
wieder an dem bedauerlichen Umstände, daß in Sachsen
eben nicht wie in Bayern, Baden, Preußen, Württemberg
und wie bis vor einigen Jahrzehnten auch in Sachsen
selbst, die Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen, mit
dem höheren Schulwesen und den Hochschulen unter einer
Hand, nämlich, unter der des Kultusministeriums stehen.
Die Besorgnisse, welche sich an die nicht eben wich-
tige Frage, ob ein oder zwei Räte in der Qeneraldirektion
sitzen sollen, bei allen Kunstfreunden knüpfen, haben ihren
Ursprung darin, daß man in der Maßnahme eben wieder
nur Flickarbeit erkennen zu müssen glaubt, während eine
Umgestalung unserer Sammlungen an Haupt und Gliedern
von großen Gesichtspunkten aus eine seit Jahren immer
lauter auftretende Forderung aller Sachkundigen ist.
Will man Ersparnisse machen, so soll man dies am
Entbehrlichen machen: dies sind nicht die Direktoren.
Überall erkennt man an, daß die besten Männer für deren
Amt eben gut genug sind. Entbehrlich ist lediglich die
Generaldirektion, die sehr gut durch ein Gremium der
Direktoren nach Art der akademischen Fakultäten und
Senate ersetzt werden kann und deren Geschäfte ein dem
Kultusministerium zu unterstellender Rat vollständig aus-
reichend besorgen kann.
Wer von der Bedeutung der Mittelstaaten innerhalb
des Reiches spricht, der wird ihre Leistungen für Kunst
uud Wissenschaft stets in erster Linie nennen. Minister
v. Rüger hat den Grundsatz aufgestellt, daß ein Staat, der
kein Geld habe, keine Kulturaufgaben lösen könne. Wäre
das richtig, so müßten wir einstweilen nach obigem Satze
darauf verzichten, eine höhere Bedeutung im Kreise der
deutschen Staaten zu besitzen. Es ist aber nicht richtig!
Die Größe Preußens beruht ganz wesentlich darin, daß
es auch in schlimmeren Zeiten, als Sachsen jetzt durch-
zumachen hatte, anders dachte; daß es vielmehr selbst in
der traurigen Zeit unmittelbar nach den Freiheitskriegen
den Grund zu seinen großartigen Sammlungen legte und
das prachtvolle »Alte Museum« baute. Auch für. Sachsen
ist es ein Ruhmestitel, daß es selbst in trüben Tagen
nicht vergaß, daß Kultur nicht ein zur Not entbehrlicher
Luxus sei!
Die Sammeltätigkeit ist infolge der starken Abstriche,
die das Budget der Museen sich gefallen lassen mußte,
ins Stocken geraten. Es ist die Zeit des Stillstandes als
der rechte Augenblick zu betrachten, um ein späteres erfolg-
reiches Vorwärtsschreiten zu beraten. Darum ist der Vor-
schlag des Oberbürgermeisters Geh. Finanzrates Beutler
in der Ersten Kammer, daß zunächst eine Denkschrift vor-
zubereiten sei, ehe Änderungen in den Verhältnissen der
Generaldirektion getroffen werden, von den Freunden
unserer Museen mit ganz besonderer Freude begrüßt
worden.
FERDINAND MELDAHL
Zu Kopenhagen ist am 3. Februar Ferdinand Meldahl
gestorben, das Haupt der dänischen Architekten an Ver-
dienst, Jahren und Ansehen. Er hatte es zu den höchsten
Würden seines Standes gebracht, und sein Name wie seine
Persönlichkeit war nicht nur in seinem Vaterlande hoch-
geehrt, sondern auch im Auslande bekannt und geschätzt,
und berufen, dem dänischen Namen in Deutschland, Italien,
Frankreich und weiterhin, wo er überall zu Hause war,
Ehre und Achtung zu erwecken. Unserem Kaiser ist er bei
vielen Gelegenheiten näher getreten und hat von ihm viele
Ferdinand Meldah!
278
Landes verschaffen. Das ist es, warum man zum Beispiel
Professor Lehrs so ungern scheiden sah und warum seine
Zurückkunft allgemein freudig begrüßt wird; das ist es,
was man früheren Generaldirektoren noch jetzt dankt, daß
sie Männer wie Wörmann, Treu und andere nach Dresden
beriefen.
Seit Jahren ist der Wunsch laut geworden, daß in der
Qesamtleitung der Museen ein sachlicher Wandel sich voll-
ziehe. Man hat erkannt, daß die Sammeltätigkeit des
Staates auf einem toten Punkt angekommen ist. Die
historische Entwickelung der Museen hat nach und nach
zu starken Unzuträglichkeiten geführt, weil eine klare
Scheidung der Sammelgebiete der einzelnen Institute nicht
vorliegt. Die Museen machen sich untereinander Kon-
kurrenz, namentlich die kunstgewerblichen. Der Staat
baut neue Häuser, wie das neue Kunstgewerbemuseum,
ohne daß er sich vorher darüber klar geworden ist, ob nicht
eine Verschmelzung einiger Sammlungen zu weit besseren
Ergebnissen führen könnte. Der Mangel einer klaren
Planung in der Oesamtleitung ist der Hauptschaden der
Entwickelung. Und dieser ist die Folge der Zersplitterung
der Museen, die sich nach längst unhaltbar gewordenen
Grundsätzen fortentwickeln. Mit Sorge denken die Freunde
der Kunst daran, daß in der Herzogin Garten ein Neubau
geschaffen werden könnte, ehe man sich klar geworden ist,
wie in Zukunft die Sammlungsgebiete voneinander ge-
trennt werden können. Welchen organischen Zusammen-
hang hat beispielsweise der kunstgewerbliche Saal im
Rahmen der älteren Waffen des sogenannten Historischen
Museums? Welchen Zweck haben dort moderne Waffen,
während solche in der Arsenalsammlung am Platze wären?
Während es in Berlin gelang, trotz viel großartigerer
Verhältnisse aus den bestehenden Museen Institute wie
das Vorderasiatische und das Friedrichsmuseum herauszu-
schälen, indem man vor allem große, neue Gesichtspunkte
aufstellte, fehlt dies in Sachsen. Zwar hat der vortragende
Rat in der Generaldirektion Zeit genug gehabt, Pläne für
ein »Asiatisches Museum« und ein »Fürstenmuseum« ru
veröffentlichen — Pläne, über die sich sprechen ließe —
aber man beobachtet nicht ohne Erstaunen, daß die Dar-
legungen des an leitender Stelle bediensteten kunstwissen-
schaftlichen Beamten anscheinend lediglich Privatäußerungen
sind, denen nicht einmal eine sachgemäße Beratung folgte.
Nicht daß etwa andere Pläne vorlägen, obgleich solche für
die nahe und ferne Zukunft eine Vorbedingung gesunden
Fortschreitens wären. An die Aufstellung eines klaren
Planes mahnen aber schon seit Jahren die Fachleute. Aber
wie man uns versichert, haben Beratungen weder zwischen
den Museumsleitern noch zwischen den Verwaltungsbe-
amten stattgefunden. Solche würden nicht nur das Amts-
gebiet der Generaldirektion, sondern auch das des Mini-
steriums des Innern und des Kultus mit berühren. Es ist
eine vielbesprochene Tatsache, daß in den letzten Jahren
erfolglose Verhandlungen stattfanden, um einen Austausch
wenigstens einiger Objekte aus dem Kunstgewerbemuseum
dem Historischen Museum, der Porzellansammlung, herbei-
zuführen. Alle beteiligten Fachleute waren sich klar, daß
diese Austausche der Gesamtheit der Sammlungen zum
Vorteil gereichen. Man sieht zum Beispiel nicht ein, warum
ein schönes Porträt des Franzosen Greuze, das der Galerie
fehlt, im Kunstgewerbemuseum hängt und warum englische
Aquarelle nicht von dort ans Kupferstichkabinett im Um-
tausch abgegeben werden können wie geplant war. Man
rechnet eben nicht mit den bureaukratischen Schwierigkeiten,
die solchem Austausch aus dem Ressort zweier Ministerien
entgegenstehen. Man beachtet nicht, daß an der Tech-
nischen Hochschule unter erheblichen Kosten Sammlungen
entstehen, die dort als wissenschaftliches Studienmaterial
als Notwendigkeit zu betrachten sind, während solches
Material sich in den öffentlichen Sammlungen bereits an-
gehäuft findet. Gurlitts und Kötzschaus Vorschlag, die
naturwissenschaftlichen Sammlungen mit der Technischen
Hochschule in unmittelbare Verbindung zu bringen, scheitert
wieder an dem bedauerlichen Umstände, daß in Sachsen
eben nicht wie in Bayern, Baden, Preußen, Württemberg
und wie bis vor einigen Jahrzehnten auch in Sachsen
selbst, die Kunst- und wissenschaftlichen Sammlungen, mit
dem höheren Schulwesen und den Hochschulen unter einer
Hand, nämlich, unter der des Kultusministeriums stehen.
Die Besorgnisse, welche sich an die nicht eben wich-
tige Frage, ob ein oder zwei Räte in der Qeneraldirektion
sitzen sollen, bei allen Kunstfreunden knüpfen, haben ihren
Ursprung darin, daß man in der Maßnahme eben wieder
nur Flickarbeit erkennen zu müssen glaubt, während eine
Umgestalung unserer Sammlungen an Haupt und Gliedern
von großen Gesichtspunkten aus eine seit Jahren immer
lauter auftretende Forderung aller Sachkundigen ist.
Will man Ersparnisse machen, so soll man dies am
Entbehrlichen machen: dies sind nicht die Direktoren.
Überall erkennt man an, daß die besten Männer für deren
Amt eben gut genug sind. Entbehrlich ist lediglich die
Generaldirektion, die sehr gut durch ein Gremium der
Direktoren nach Art der akademischen Fakultäten und
Senate ersetzt werden kann und deren Geschäfte ein dem
Kultusministerium zu unterstellender Rat vollständig aus-
reichend besorgen kann.
Wer von der Bedeutung der Mittelstaaten innerhalb
des Reiches spricht, der wird ihre Leistungen für Kunst
uud Wissenschaft stets in erster Linie nennen. Minister
v. Rüger hat den Grundsatz aufgestellt, daß ein Staat, der
kein Geld habe, keine Kulturaufgaben lösen könne. Wäre
das richtig, so müßten wir einstweilen nach obigem Satze
darauf verzichten, eine höhere Bedeutung im Kreise der
deutschen Staaten zu besitzen. Es ist aber nicht richtig!
Die Größe Preußens beruht ganz wesentlich darin, daß
es auch in schlimmeren Zeiten, als Sachsen jetzt durch-
zumachen hatte, anders dachte; daß es vielmehr selbst in
der traurigen Zeit unmittelbar nach den Freiheitskriegen
den Grund zu seinen großartigen Sammlungen legte und
das prachtvolle »Alte Museum« baute. Auch für. Sachsen
ist es ein Ruhmestitel, daß es selbst in trüben Tagen
nicht vergaß, daß Kultur nicht ein zur Not entbehrlicher
Luxus sei!
Die Sammeltätigkeit ist infolge der starken Abstriche,
die das Budget der Museen sich gefallen lassen mußte,
ins Stocken geraten. Es ist die Zeit des Stillstandes als
der rechte Augenblick zu betrachten, um ein späteres erfolg-
reiches Vorwärtsschreiten zu beraten. Darum ist der Vor-
schlag des Oberbürgermeisters Geh. Finanzrates Beutler
in der Ersten Kammer, daß zunächst eine Denkschrift vor-
zubereiten sei, ehe Änderungen in den Verhältnissen der
Generaldirektion getroffen werden, von den Freunden
unserer Museen mit ganz besonderer Freude begrüßt
worden.
FERDINAND MELDAHL
Zu Kopenhagen ist am 3. Februar Ferdinand Meldahl
gestorben, das Haupt der dänischen Architekten an Ver-
dienst, Jahren und Ansehen. Er hatte es zu den höchsten
Würden seines Standes gebracht, und sein Name wie seine
Persönlichkeit war nicht nur in seinem Vaterlande hoch-
geehrt, sondern auch im Auslande bekannt und geschätzt,
und berufen, dem dänischen Namen in Deutschland, Italien,
Frankreich und weiterhin, wo er überall zu Hause war,
Ehre und Achtung zu erwecken. Unserem Kaiser ist er bei
vielen Gelegenheiten näher getreten und hat von ihm viele