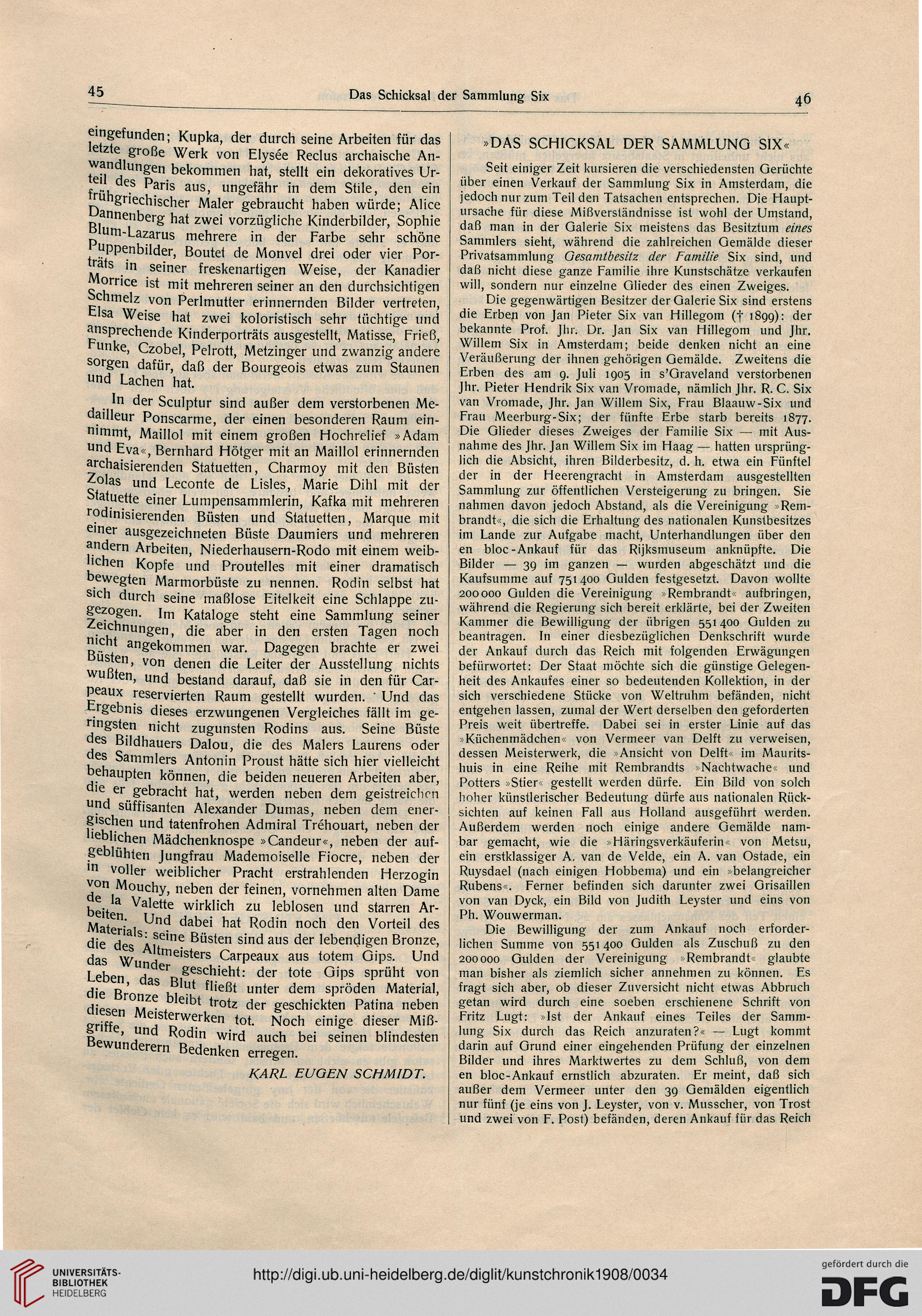45
Das Schicksal der Sammlung Six
46
eingefunden; Kupka, der durch seine Arbeiten für das
letzte große Werk von Elysee Reclus archaische An-
wandlungen bekommen hat, stellt ein dekoratives Ur-
teil des Paris aus, ungefähr in dem Stile, den ein
frühgriechischer Maler gebraucht haben würde; Alice
Dannenberg hat zwei vorzügliche Kinderbilder, Sophie
Blum-Lazarus mehrere in der Farbe sehr schöne
Puppenbilder, Boutet de Monvel drei oder vier Por-
träts in seiner freskenartigen Weise, der Kanadier
Morrice ist mit mehreren seiner an den durchsichtigen
Schmelz von Perlmutter erinnernden Bilder vertreten,
Elsa Weise hat zwei koloristisch sehr tüchtige und
ansprechende Kinderporträts ausgestellt, Matisse, Frieß,
Funke, Czobel, Pelrott, Metzinger und zwanzig andere
sorgen dafür, daß der Bourgeois etwas zum Staunen
und Lachen hat.
In der Sculptur sind außer dem verstorbenen Me-
dailleur Ponscarme, der einen besonderen Raum ein-
nimmt, Maillol mit einem großen Hochrelief »Adam
und Eva«, Bernhard Hötger mit an Maillol erinnernden
archaisierenden Statuetten, Charmoy mit den Büsten
Zolas und Leconte de Lisles, Marie Dihl mit der
Statuette einer Lumpensammlerin, Kafka mit mehreren
rodinisierenden Büsten und Statuetten, Marque mit
einer ausgezeichneten Büste Daumiers und mehreren
andern Arbeiten, Niederhausern-Rodo mit einem weib-
lichen Kopfe und Proutelles mit einer dramatisch
bewegten Marmorbüste zu nennen. Rodin selbst hat
sich durch seine maßlose Eitelkeit eine Schlappe zu-
gezogen. Im Kataloge steht eine Sammlung seiner
Zeichnungen, die aber in den ersten Tagen noch
nicht angekommen war. Dagegen brachte er zwei
Büsten, von denen die Leiter der Ausstellung nichts
wußten, und bestand darauf, daß sie in den für Car-
peaux reservierten Raum gestellt wurden. 1 Und das
Ergebnis dieses erzwungenen Vergleiches fällt im ge-
ringsten nicht zugunsten Rodins aus. Seine Büste
des Bildhauers Dalou, die des Malers Laurens oder
des Sammlers Antonin Proust hätte sich hier vielleicht
behaupten können, die beiden neueren Arbeiten aber,
die er gebracht hat, werden neben dem geistreichen
und süffisanten Alexander Dumas, neben dem ener-
gischen und tatenfrohen Admiral Trehouart, neben der
lieblichen Mädchenknospe »Candeur«, neben der auf-
geblühten Jungfrau Mademoiselle Fiocre, neben der
in voller weiblicher Pracht erstrahlenden Herzogin
von Mouchy, neben der feinen, vornehmen alten Dame
de la Valette wirklich zu leblosen und starren Ar-
beiten. Und dabei hat Rodin noch den Vorteil des
Materials: seine Büsten sind aus der lebendigen Bronze,
die des Altmeisters Carpeaux aus totem Gips. Und
das Wunder geschieht: der tote Gips sprüht von
Leben, das Blut fließt unter dem spröden Material,
die Bronze bleibt trotz der geschickten Patina neben
diesen Meisterwerken tot. Noch einige dieser Miß-
griffe, und Rodin wird auch bei seinen blindesten
Bewunderern Bedenken erregen.
KARL EUGEN SCHMIDT.
»DAS SCHICKSAL DER SAMMLUNG SIX«
Seit einiger Zeit kursieren die verschiedensten Gerüchte
über einen Verkauf der Sammlung Six in Amsterdam, die
jedoch nur zum Teil den Tatsachen entsprechen. Die Haupt-
ursache für diese Mißverständnisse ist wohl der Umstand,
daß man in der Galerie Six meistens das Besitztum eines
Sammlers sieht, während die zahlreichen Gemälde dieser
Privatsammlung Gesamtbesitz der Familie Six sind, und
daß nicht diese ganze Familie ihre Kunstschätze verkaufen
will, sondern nur einzelne Glieder des einen Zweiges.
Die gegenwärtigen Besitzer der Galerie Six sind erstens
die Erben von Jan Pieter Six van Hillegom (f 1899): der
bekannte Prof. Jhr; Dr. Jan Six van Hillegom und Jhr.
Willem Six in Amsterdam; beide denken nicht an eine
Veräußerung der ihnen gehörigen Gemälde. Zweitens die
Erben des am 9. Juli 1905 in s'Graveland verstorbenen
Jhr. Pieter Hendrik Six van Vromade, nämlich Jhr. R. C. Six
van Vromade, Jhr. Jan Willem Six, Frau Blaauw-Six und
Frau Meerburg-Six; der fünfte Erbe starb bereits 1877.
Die Glieder dieses Zweiges der Familie Six — mit Aus-
nahme des Jhr. Jan Willem Six im Haag — hatten ursprüng-
lich die Absicht, ihren Bilderbesitz, d. h. etwa ein Fünftel
der in der Heerengracht in Amsterdam ausgestellten
Sammlung zur öffentlichen Versteigerung zu bringen. Sie
nahmen davon jedoch Abstand, als die Vereinigung Rem-
brandt«, die sich die Erhaltung des nationalen Kunstbesitzes
im Lande zur Aufgabe macht, Unterhandlungen über den
en bloc-Ankauf für das Rijksmuseum anknüpfte. Die
Bilder — 39 im ganzen — wurden abgeschätzt und die
Kaufsumme auf 751 400 Gulden festgesetzt. Davon wollte
200000 Gulden die Vereinigung Rembrandt aufbringen,
während die Regierung sich bereit erklärte, bei der Zweiten
Kammer die Bewilligung der übrigen 551400 Gulden zu
beantragen. In einer diesbezüglichen Denkschrift wurde
der Ankauf durch das Reich mit folgenden Erwägungen
befürwortet: Der Staat möchte sich die günstige Gelegen-
heit des Ankaufes einer so bedeutenden Kollektion, in der
sich verschiedene Stücke von Weltruhm befänden, nicht
entgehen lassen, zumal der Wert derselben den geforderten
Preis weit übertreffe. Dabei sei in erster Linie auf das
Küchenmädchen« von Vermeer van Delft zu verweisen,
dessen Meisterwerk, die »Ansicht von Delft« im Maurits-
huis in eine Reihe mit Rembrandts »Nachtwache« und
Potters »Stier« gestellt werden dürfe. Ein Bild von solch
hoher künstlerischer Bedeutung dürfe aus nationalen Rück-
sichten auf keinen Fall aus Holland ausgeführt werden.
Außerdem werden noch einige andere Gemälde nam-
bar gemacht, wie die »Häringsverkäuferin < von Metsu,
ein erstklassiger A. van de Velde, ein A. van Ostade, ein
Ruysdael (nach einigen Hobbema) und ein »belangreicher
Rubens«. Ferner befinden sich darunter zwei Grisaillen
von van Dyck, ein Bild von Judith Leyster und eins von
Ph. Wouwerman.
Die Bewilligung der zum Ankauf noch erforder-
lichen Summe von 551400 Gulden als Zuschuß zu den
200000 Gulden der Vereinigung Rembrandt glaubte
man bisher als ziemlich sicher annehmen zu können. Es
fragt sich aber, ob dieser Zuversicht nicht etwas Abbruch
getan wird durch eine soeben erschienene Schrift von
Fritz Lugt: »Ist der Ankauf eines Teiles der Samm-
lung Six durch das Reich anzuraten?« — Lugt kommt
darin auf Grund einer eingehenden Prüfung der einzelnen
Bilder und ihres Marktwertes zu dem Schluß, von dem
en bloc-Ankauf ernstlich abzuraten. Er meint, daß sich
außer dem Vermeer unter den 39 Gemälden eigentlich
nur fünf (je eins von J. Leyster, von v. Musscher, von Trost
und zwei von F. Pos1) befänden, deren Ankauf für das Reich
Das Schicksal der Sammlung Six
46
eingefunden; Kupka, der durch seine Arbeiten für das
letzte große Werk von Elysee Reclus archaische An-
wandlungen bekommen hat, stellt ein dekoratives Ur-
teil des Paris aus, ungefähr in dem Stile, den ein
frühgriechischer Maler gebraucht haben würde; Alice
Dannenberg hat zwei vorzügliche Kinderbilder, Sophie
Blum-Lazarus mehrere in der Farbe sehr schöne
Puppenbilder, Boutet de Monvel drei oder vier Por-
träts in seiner freskenartigen Weise, der Kanadier
Morrice ist mit mehreren seiner an den durchsichtigen
Schmelz von Perlmutter erinnernden Bilder vertreten,
Elsa Weise hat zwei koloristisch sehr tüchtige und
ansprechende Kinderporträts ausgestellt, Matisse, Frieß,
Funke, Czobel, Pelrott, Metzinger und zwanzig andere
sorgen dafür, daß der Bourgeois etwas zum Staunen
und Lachen hat.
In der Sculptur sind außer dem verstorbenen Me-
dailleur Ponscarme, der einen besonderen Raum ein-
nimmt, Maillol mit einem großen Hochrelief »Adam
und Eva«, Bernhard Hötger mit an Maillol erinnernden
archaisierenden Statuetten, Charmoy mit den Büsten
Zolas und Leconte de Lisles, Marie Dihl mit der
Statuette einer Lumpensammlerin, Kafka mit mehreren
rodinisierenden Büsten und Statuetten, Marque mit
einer ausgezeichneten Büste Daumiers und mehreren
andern Arbeiten, Niederhausern-Rodo mit einem weib-
lichen Kopfe und Proutelles mit einer dramatisch
bewegten Marmorbüste zu nennen. Rodin selbst hat
sich durch seine maßlose Eitelkeit eine Schlappe zu-
gezogen. Im Kataloge steht eine Sammlung seiner
Zeichnungen, die aber in den ersten Tagen noch
nicht angekommen war. Dagegen brachte er zwei
Büsten, von denen die Leiter der Ausstellung nichts
wußten, und bestand darauf, daß sie in den für Car-
peaux reservierten Raum gestellt wurden. 1 Und das
Ergebnis dieses erzwungenen Vergleiches fällt im ge-
ringsten nicht zugunsten Rodins aus. Seine Büste
des Bildhauers Dalou, die des Malers Laurens oder
des Sammlers Antonin Proust hätte sich hier vielleicht
behaupten können, die beiden neueren Arbeiten aber,
die er gebracht hat, werden neben dem geistreichen
und süffisanten Alexander Dumas, neben dem ener-
gischen und tatenfrohen Admiral Trehouart, neben der
lieblichen Mädchenknospe »Candeur«, neben der auf-
geblühten Jungfrau Mademoiselle Fiocre, neben der
in voller weiblicher Pracht erstrahlenden Herzogin
von Mouchy, neben der feinen, vornehmen alten Dame
de la Valette wirklich zu leblosen und starren Ar-
beiten. Und dabei hat Rodin noch den Vorteil des
Materials: seine Büsten sind aus der lebendigen Bronze,
die des Altmeisters Carpeaux aus totem Gips. Und
das Wunder geschieht: der tote Gips sprüht von
Leben, das Blut fließt unter dem spröden Material,
die Bronze bleibt trotz der geschickten Patina neben
diesen Meisterwerken tot. Noch einige dieser Miß-
griffe, und Rodin wird auch bei seinen blindesten
Bewunderern Bedenken erregen.
KARL EUGEN SCHMIDT.
»DAS SCHICKSAL DER SAMMLUNG SIX«
Seit einiger Zeit kursieren die verschiedensten Gerüchte
über einen Verkauf der Sammlung Six in Amsterdam, die
jedoch nur zum Teil den Tatsachen entsprechen. Die Haupt-
ursache für diese Mißverständnisse ist wohl der Umstand,
daß man in der Galerie Six meistens das Besitztum eines
Sammlers sieht, während die zahlreichen Gemälde dieser
Privatsammlung Gesamtbesitz der Familie Six sind, und
daß nicht diese ganze Familie ihre Kunstschätze verkaufen
will, sondern nur einzelne Glieder des einen Zweiges.
Die gegenwärtigen Besitzer der Galerie Six sind erstens
die Erben von Jan Pieter Six van Hillegom (f 1899): der
bekannte Prof. Jhr; Dr. Jan Six van Hillegom und Jhr.
Willem Six in Amsterdam; beide denken nicht an eine
Veräußerung der ihnen gehörigen Gemälde. Zweitens die
Erben des am 9. Juli 1905 in s'Graveland verstorbenen
Jhr. Pieter Hendrik Six van Vromade, nämlich Jhr. R. C. Six
van Vromade, Jhr. Jan Willem Six, Frau Blaauw-Six und
Frau Meerburg-Six; der fünfte Erbe starb bereits 1877.
Die Glieder dieses Zweiges der Familie Six — mit Aus-
nahme des Jhr. Jan Willem Six im Haag — hatten ursprüng-
lich die Absicht, ihren Bilderbesitz, d. h. etwa ein Fünftel
der in der Heerengracht in Amsterdam ausgestellten
Sammlung zur öffentlichen Versteigerung zu bringen. Sie
nahmen davon jedoch Abstand, als die Vereinigung Rem-
brandt«, die sich die Erhaltung des nationalen Kunstbesitzes
im Lande zur Aufgabe macht, Unterhandlungen über den
en bloc-Ankauf für das Rijksmuseum anknüpfte. Die
Bilder — 39 im ganzen — wurden abgeschätzt und die
Kaufsumme auf 751 400 Gulden festgesetzt. Davon wollte
200000 Gulden die Vereinigung Rembrandt aufbringen,
während die Regierung sich bereit erklärte, bei der Zweiten
Kammer die Bewilligung der übrigen 551400 Gulden zu
beantragen. In einer diesbezüglichen Denkschrift wurde
der Ankauf durch das Reich mit folgenden Erwägungen
befürwortet: Der Staat möchte sich die günstige Gelegen-
heit des Ankaufes einer so bedeutenden Kollektion, in der
sich verschiedene Stücke von Weltruhm befänden, nicht
entgehen lassen, zumal der Wert derselben den geforderten
Preis weit übertreffe. Dabei sei in erster Linie auf das
Küchenmädchen« von Vermeer van Delft zu verweisen,
dessen Meisterwerk, die »Ansicht von Delft« im Maurits-
huis in eine Reihe mit Rembrandts »Nachtwache« und
Potters »Stier« gestellt werden dürfe. Ein Bild von solch
hoher künstlerischer Bedeutung dürfe aus nationalen Rück-
sichten auf keinen Fall aus Holland ausgeführt werden.
Außerdem werden noch einige andere Gemälde nam-
bar gemacht, wie die »Häringsverkäuferin < von Metsu,
ein erstklassiger A. van de Velde, ein A. van Ostade, ein
Ruysdael (nach einigen Hobbema) und ein »belangreicher
Rubens«. Ferner befinden sich darunter zwei Grisaillen
von van Dyck, ein Bild von Judith Leyster und eins von
Ph. Wouwerman.
Die Bewilligung der zum Ankauf noch erforder-
lichen Summe von 551400 Gulden als Zuschuß zu den
200000 Gulden der Vereinigung Rembrandt glaubte
man bisher als ziemlich sicher annehmen zu können. Es
fragt sich aber, ob dieser Zuversicht nicht etwas Abbruch
getan wird durch eine soeben erschienene Schrift von
Fritz Lugt: »Ist der Ankauf eines Teiles der Samm-
lung Six durch das Reich anzuraten?« — Lugt kommt
darin auf Grund einer eingehenden Prüfung der einzelnen
Bilder und ihres Marktwertes zu dem Schluß, von dem
en bloc-Ankauf ernstlich abzuraten. Er meint, daß sich
außer dem Vermeer unter den 39 Gemälden eigentlich
nur fünf (je eins von J. Leyster, von v. Musscher, von Trost
und zwei von F. Pos1) befänden, deren Ankauf für das Reich