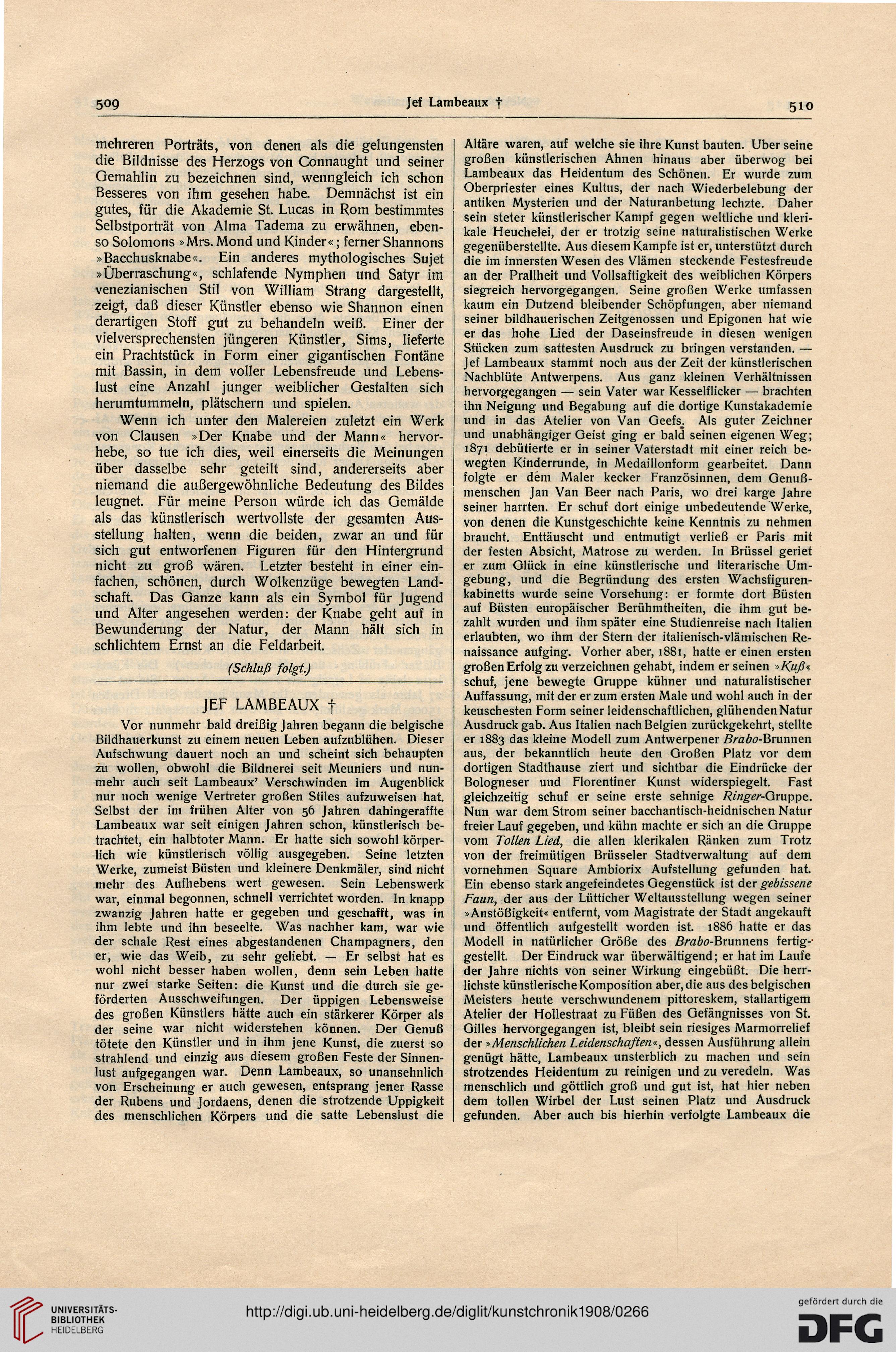509
Jef Lambeaux f
510
mehreren Porträts, von denen als die gelungensten
die Bildnisse des Herzogs von Connaught und seiner
Gemahlin zu bezeichnen sind, wenngleich ich schon
Besseres von ihm gesehen habe. Demnächst ist ein
gutes, für die Akademie St. Lucas in Rom bestimmtes
Selbstporträt von Alma Tadema zu erwähnen, eben-
so Solomons »Mrs. Mond und Kinder«; ferner Shannons
»Bacchusknabe«. Ein anderes mythologisches Sujet
»Überraschung«, schlafende Nymphen und Satyr im
venezianischen Stil von William Strang dargestellt,
zeigt, daß dieser Künstler ebenso wie Shannon einen
derartigen Stoff gut zu behandeln weiß. Einer der
vielversprechensten jüngeren Künstler, Sims, lieferte
ein Prachtstück in Form einer gigantischen Fontäne
mit Bassin, in dem voller Lebensfreude und Lebens-
lust eine Anzahl junger weiblicher Gestalten sich
herumtummeln, plätschern und spielen.
Wenn ich unter den Malereien zuletzt ein Werk
von Clausen »Der Knabe und der Mann« hervor-
hebe, so tue ich dies, weil einerseits die Meinungen
über dasselbe sehr geteilt sind, andererseits aber
niemand die außergewöhnliche Bedeutung des Bildes
leugnet. Für meine Person würde ich das Gemälde
als das künstlerisch wertvollste der gesamten Aus-
stellung halten, wenn die beiden, zwar an und für
sich gut entworfenen Figuren für den Hintergrund
nicht zu groß wären. Letzter besteht in einer ein-
fachen, schönen, durch Wolkenzüge bewegten Land-
schaft. Das Ganze kann als ein Symbol für Jugend
und Alter angesehen werden: der Knabe geht auf in
Bewunderung der Natur, der Mann hält sich in
schlichtem Ernst an die Feldarbeit.
(Schluß folgt.)
JEF LAMBEAUX f
Vor nunmehr bald dreißig Jahren begann die belgische
Bildhauerkunst zu einem neuen Leben aufzublühen. Dieser
Aufschwung dauert noch an und scheint sich behaupten
zu wollen, obwohl die Bildnerei seit Meuniers und nun-
mehr auch seit Lambeaux' Verschwinden im Augenblick
nur noch wenige Vertreter großen Stiles aufzuweisen hat.
Selbst der im frühen Alter von 56 Jahren dahingeraffte
Lambeaux war seit einigen Jahren schon, künstlerisch be-
trachtet, ein halbtoter Mann. Er hatte sich sowohl körper-
lich wie künstlerisch völlig ausgegeben. Seine letzten
Werke, zumeist Büsten und kleinere Denkmäler, sind nicht
mehr des Aufhebens wert gewesen. Sein Lebenswerk
war, einmal begonnen, schnell verrichtet worden. In knapp
zwanzig Jahren hatte er gegeben und geschafft, was in
ihm lebte und ihn beseelte. Was nachher kam, war wie
der schale Rest eines abgestandenen Champagners, den
er, wie das Weib, zu sehr geliebt. — Er selbst hat es
wohl nicht besser haben wollen, denn sein Leben hatte
nur zwei starke Seiten: die Kunst und die durch sie ge-
förderten Ausschweifungen. Der üppigen Lebensweise
des großen Künstlers hätte auch ein stärkerer Körper als
der seine war nicht widerstehen können. Der Genuß
tötete den Künstler und in ihm jene Kunst, die zuerst so
strahlend und einzig aus diesem großen Feste der Sinnen-
lust aufgegangen war. Denn Lambeaux, so unansehnlich
von Erscheinung er auch gewesen, entsprang jener Rasse
der Rubens und Jordaens, denen die strotzende Üppigkeit
des menschlichen Körpers und die satte Lebenslust die
Altäre waren, auf welche sie ihre Kunst bauten. Uber seine
großen künstlerischen Ahnen hinaus aber überwog bei
Lambeaux das Heidentum des Schönen. Er wurde zum
Oberpriester eines Kultus, der nach Wiederbelebung der
antiken Mysterien und der Naturanbetung lechzte. Daher
sein steter künstlerischer Kampf gegen weltliche und kleri-
kale Heuchelei, der er trotzig seine naturalistischen Werke
gegenüberstellte. Aus diesem Kampfe ist er, unterstützt durch
die im innersten Wesen des Vlämen steckende Festesfreude
an der Prallheit und Vollsaftigkeit des weiblichen Körpers
siegreich hervorgegangen. Seine großen Werke umfassen
kaum ein Dutzend bleibender Schöpfungen, aber niemand
seiner bildhauerischen Zeitgenossen und Epigonen hat wie
er das hohe Lied der Daseinsfreude in diesen wenigen
Stücken zum sattesten Ausdruck zu bringen verstanden. —
Jef Lambeaux stammt noch aus der Zeit der künstlerischen
Nachblüte Antwerpens. Aus ganz kleinen Verhältnissen
hervorgegangen — sein Vater war Kesselflicker — brachten
ihn Neigung und Begabung auf die dortige Kunstakademie
und in das Atelier von Van GeefS; Als guter Zeichner
und unabhängiger Geist ging er bald seinen eigenen Weg;
1871 debütierte er in seiner Vaterstadt mit einer reich be-
wegten Kinderrunde, in Medaillonform gearbeitet. Dann
folgte er dem Maler kecker Französinnen, dem Genuß-
menschen Jan Van Beer nach Paris, wo drei karge Jahre
seiner harrten. Er schuf dort einige unbedeutende Werke,
von denen die Kunstgeschichte keine Kenntnis zu nehmen
braucht. Enttäuscht und entmutigt verließ er Paris mit
der festen Absicht, Matrose zu werden. In Brüssel geriet
er zum Glück in eine künstlerische und literarische Um-
gebung, und die Begründung des ersten Wachsfiguren-
kabinetts wurde seine Vorsehung: er formte dort Büsten
auf Büsten europäischer Berühmtheiten, die ihm gut be-
zahlt wurden und ihm später eine Studienreise nach Italien
erlaubten, wo ihm der Stern der italienisch-vlämischen Re-
naissance aufging. Vorher aber, 1881, hatte er einen ersten
großen Erfolg zu verzeichnen gehabt, indem er seinen »Kuß«
schuf, jene bewegte Gruppe kühner und naturalistischer
Auffassung, mit der er zum ersten Male und wohl auch in der
keuschesten Form seiner leidenschaftlichen, glühenden Natur
Ausdruck gab. Aus Italien nach Belgien zurückgekehrt, stellte
er 1883 das kleine Modell zum Antwerpener Brabo-Hmxmtn
aus, der bekanntlich heute den Großen Platz vor dem
dortigen Stadthause ziert und sichtbar die Eindrücke der
Bologneser und Florentiner Kunst widerspiegelt. Fast
gleichzeitig schuf er seine erste sehnige Ringer-Oruppt.
Nun war dem Strom seiner bacchantisch-heidnischen Natur
freier Lauf gegeben, und kühn machte er sich an die Gruppe
vom Tollen Lied, die allen klerikalen Ränken zum Trotz
von der freimütigen Brüsseler Stadtverwaltung auf dem
vornehmen Square Ambiorix Aufstellung gefunden hat.
Ein ebenso stark angefeindetes Gegenstück ist der gebissene
Faun, der aus der Lütticher Weltausstellung wegen seiner
»Anstößigkeit« entfernt, vom Magistrate der Stadt angekauft
und öffentlich aufgestellt worden ist. 1886 hatte er das
Modell in natürlicher Größe des ßra/bo-Brunnens fertig--
gestellt. Der Eindruck war überwältigend; er hat im Laufe
der Jahre nichts von seiner Wirkung eingebüßt. Die herr-
lichste künstlerische Komposition aber, die aus des belgischen
Meisters heute verschwundenem pittoreskem, stallartigem
Atelier der Hollestraat zu Füßen des Gefängnisses von St.
Gilles hervorgegangen ist, bleibt sein riesiges Marmorrelief
der »Menschlichen Leidenschaften«, dessen Ausführung allein
genügt hätte, Lambeaux unsterblich zu machen und sein
strotzendes Heidentum zu reinigen und zu veredeln. Was
menschlich und göttlich groß und gut ist, hat hier neben
dem tollen Wirbel der Lust seinen Platz und Ausdruck
gefunden. Aber auch bis hierhin verfolgte Lambeaux die
Jef Lambeaux f
510
mehreren Porträts, von denen als die gelungensten
die Bildnisse des Herzogs von Connaught und seiner
Gemahlin zu bezeichnen sind, wenngleich ich schon
Besseres von ihm gesehen habe. Demnächst ist ein
gutes, für die Akademie St. Lucas in Rom bestimmtes
Selbstporträt von Alma Tadema zu erwähnen, eben-
so Solomons »Mrs. Mond und Kinder«; ferner Shannons
»Bacchusknabe«. Ein anderes mythologisches Sujet
»Überraschung«, schlafende Nymphen und Satyr im
venezianischen Stil von William Strang dargestellt,
zeigt, daß dieser Künstler ebenso wie Shannon einen
derartigen Stoff gut zu behandeln weiß. Einer der
vielversprechensten jüngeren Künstler, Sims, lieferte
ein Prachtstück in Form einer gigantischen Fontäne
mit Bassin, in dem voller Lebensfreude und Lebens-
lust eine Anzahl junger weiblicher Gestalten sich
herumtummeln, plätschern und spielen.
Wenn ich unter den Malereien zuletzt ein Werk
von Clausen »Der Knabe und der Mann« hervor-
hebe, so tue ich dies, weil einerseits die Meinungen
über dasselbe sehr geteilt sind, andererseits aber
niemand die außergewöhnliche Bedeutung des Bildes
leugnet. Für meine Person würde ich das Gemälde
als das künstlerisch wertvollste der gesamten Aus-
stellung halten, wenn die beiden, zwar an und für
sich gut entworfenen Figuren für den Hintergrund
nicht zu groß wären. Letzter besteht in einer ein-
fachen, schönen, durch Wolkenzüge bewegten Land-
schaft. Das Ganze kann als ein Symbol für Jugend
und Alter angesehen werden: der Knabe geht auf in
Bewunderung der Natur, der Mann hält sich in
schlichtem Ernst an die Feldarbeit.
(Schluß folgt.)
JEF LAMBEAUX f
Vor nunmehr bald dreißig Jahren begann die belgische
Bildhauerkunst zu einem neuen Leben aufzublühen. Dieser
Aufschwung dauert noch an und scheint sich behaupten
zu wollen, obwohl die Bildnerei seit Meuniers und nun-
mehr auch seit Lambeaux' Verschwinden im Augenblick
nur noch wenige Vertreter großen Stiles aufzuweisen hat.
Selbst der im frühen Alter von 56 Jahren dahingeraffte
Lambeaux war seit einigen Jahren schon, künstlerisch be-
trachtet, ein halbtoter Mann. Er hatte sich sowohl körper-
lich wie künstlerisch völlig ausgegeben. Seine letzten
Werke, zumeist Büsten und kleinere Denkmäler, sind nicht
mehr des Aufhebens wert gewesen. Sein Lebenswerk
war, einmal begonnen, schnell verrichtet worden. In knapp
zwanzig Jahren hatte er gegeben und geschafft, was in
ihm lebte und ihn beseelte. Was nachher kam, war wie
der schale Rest eines abgestandenen Champagners, den
er, wie das Weib, zu sehr geliebt. — Er selbst hat es
wohl nicht besser haben wollen, denn sein Leben hatte
nur zwei starke Seiten: die Kunst und die durch sie ge-
förderten Ausschweifungen. Der üppigen Lebensweise
des großen Künstlers hätte auch ein stärkerer Körper als
der seine war nicht widerstehen können. Der Genuß
tötete den Künstler und in ihm jene Kunst, die zuerst so
strahlend und einzig aus diesem großen Feste der Sinnen-
lust aufgegangen war. Denn Lambeaux, so unansehnlich
von Erscheinung er auch gewesen, entsprang jener Rasse
der Rubens und Jordaens, denen die strotzende Üppigkeit
des menschlichen Körpers und die satte Lebenslust die
Altäre waren, auf welche sie ihre Kunst bauten. Uber seine
großen künstlerischen Ahnen hinaus aber überwog bei
Lambeaux das Heidentum des Schönen. Er wurde zum
Oberpriester eines Kultus, der nach Wiederbelebung der
antiken Mysterien und der Naturanbetung lechzte. Daher
sein steter künstlerischer Kampf gegen weltliche und kleri-
kale Heuchelei, der er trotzig seine naturalistischen Werke
gegenüberstellte. Aus diesem Kampfe ist er, unterstützt durch
die im innersten Wesen des Vlämen steckende Festesfreude
an der Prallheit und Vollsaftigkeit des weiblichen Körpers
siegreich hervorgegangen. Seine großen Werke umfassen
kaum ein Dutzend bleibender Schöpfungen, aber niemand
seiner bildhauerischen Zeitgenossen und Epigonen hat wie
er das hohe Lied der Daseinsfreude in diesen wenigen
Stücken zum sattesten Ausdruck zu bringen verstanden. —
Jef Lambeaux stammt noch aus der Zeit der künstlerischen
Nachblüte Antwerpens. Aus ganz kleinen Verhältnissen
hervorgegangen — sein Vater war Kesselflicker — brachten
ihn Neigung und Begabung auf die dortige Kunstakademie
und in das Atelier von Van GeefS; Als guter Zeichner
und unabhängiger Geist ging er bald seinen eigenen Weg;
1871 debütierte er in seiner Vaterstadt mit einer reich be-
wegten Kinderrunde, in Medaillonform gearbeitet. Dann
folgte er dem Maler kecker Französinnen, dem Genuß-
menschen Jan Van Beer nach Paris, wo drei karge Jahre
seiner harrten. Er schuf dort einige unbedeutende Werke,
von denen die Kunstgeschichte keine Kenntnis zu nehmen
braucht. Enttäuscht und entmutigt verließ er Paris mit
der festen Absicht, Matrose zu werden. In Brüssel geriet
er zum Glück in eine künstlerische und literarische Um-
gebung, und die Begründung des ersten Wachsfiguren-
kabinetts wurde seine Vorsehung: er formte dort Büsten
auf Büsten europäischer Berühmtheiten, die ihm gut be-
zahlt wurden und ihm später eine Studienreise nach Italien
erlaubten, wo ihm der Stern der italienisch-vlämischen Re-
naissance aufging. Vorher aber, 1881, hatte er einen ersten
großen Erfolg zu verzeichnen gehabt, indem er seinen »Kuß«
schuf, jene bewegte Gruppe kühner und naturalistischer
Auffassung, mit der er zum ersten Male und wohl auch in der
keuschesten Form seiner leidenschaftlichen, glühenden Natur
Ausdruck gab. Aus Italien nach Belgien zurückgekehrt, stellte
er 1883 das kleine Modell zum Antwerpener Brabo-Hmxmtn
aus, der bekanntlich heute den Großen Platz vor dem
dortigen Stadthause ziert und sichtbar die Eindrücke der
Bologneser und Florentiner Kunst widerspiegelt. Fast
gleichzeitig schuf er seine erste sehnige Ringer-Oruppt.
Nun war dem Strom seiner bacchantisch-heidnischen Natur
freier Lauf gegeben, und kühn machte er sich an die Gruppe
vom Tollen Lied, die allen klerikalen Ränken zum Trotz
von der freimütigen Brüsseler Stadtverwaltung auf dem
vornehmen Square Ambiorix Aufstellung gefunden hat.
Ein ebenso stark angefeindetes Gegenstück ist der gebissene
Faun, der aus der Lütticher Weltausstellung wegen seiner
»Anstößigkeit« entfernt, vom Magistrate der Stadt angekauft
und öffentlich aufgestellt worden ist. 1886 hatte er das
Modell in natürlicher Größe des ßra/bo-Brunnens fertig--
gestellt. Der Eindruck war überwältigend; er hat im Laufe
der Jahre nichts von seiner Wirkung eingebüßt. Die herr-
lichste künstlerische Komposition aber, die aus des belgischen
Meisters heute verschwundenem pittoreskem, stallartigem
Atelier der Hollestraat zu Füßen des Gefängnisses von St.
Gilles hervorgegangen ist, bleibt sein riesiges Marmorrelief
der »Menschlichen Leidenschaften«, dessen Ausführung allein
genügt hätte, Lambeaux unsterblich zu machen und sein
strotzendes Heidentum zu reinigen und zu veredeln. Was
menschlich und göttlich groß und gut ist, hat hier neben
dem tollen Wirbel der Lust seinen Platz und Ausdruck
gefunden. Aber auch bis hierhin verfolgte Lambeaux die