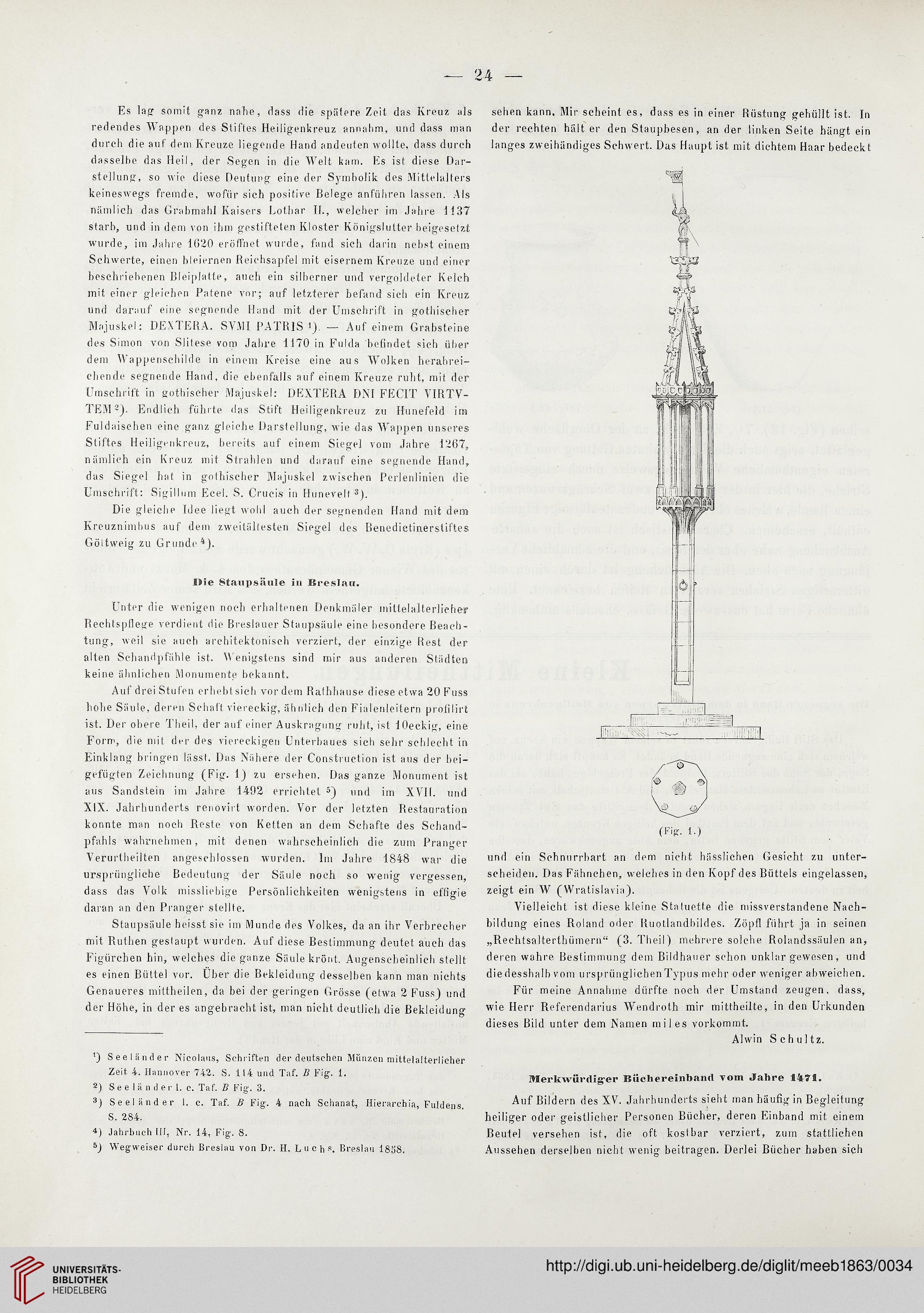— 24
Es lag somit ganz nahe, dass die spätere Zeit das Kreuz als
redendesXVappen desStiftesHeiligenkreuz annahm, uttd dass man
durch dieaufdcmKreuzeliegcnde Hand andeuten wollte, dassdurch
dassetbedasHeil, der Segen in die Welt kam. Es ist diese Dar-
stellung, so wie diese Deutung eine der Symbolik des Mittelalters
keineswegs fremde, wofür sich positive Belege anführen lassen. Als
nämlich das Grabmahl Kaisers Lothar II., welcher im Jahre 1137
starh, und in dem von ihm gestifteten Kloster Königslutter heigesetzt
wurde, im Jahre 1620 eröffnet wurde, fand sich darin nebst einem
Schwerte, einen bleiernen Reichsapfel mit eisernem Kreuze und einer
beschriebenen Bleiplatte, auch ein silberner und vergoldeter Kelch
mit einer gleichen Patene vor; auf letzterer befand sich ein Kreuz
und darauf eine segnende Hand mit derUmschrift in gothischer
Majuskel: DEXTERA. SVM1 PATRISi) — Auf einem Grabsteine
des Simon von Slitese vom Jahre 1170 in Fulda befindet sich über
dem Wappenschilde in einem Kreise eine aus Wolken hcrahrei-
chende segnende Hand, die ebenfalls auf einem Kreuze ruht, mit der
Umschrift in gothischer Majuskel: DEXTEBA DNI FEC1T VIRTV-
TEM'). Endlich führte das Stift Heiligenkreuz zu Hunefcld im
Fuldaischen eine ganz gleiche Darstellung, wie das Wappen unseres
Stiftes Heiligenkreuz, bereits auf einem Siegel vom Jahre 1267,
nämlich ein Kreuz mit Strahlen und darauf eine segnende Hand,
das Siegel hat in gothischer Majuskel zwischen Perlenlinien die
Umschrift: SigillumEcel.S.CrucisinHunevelfS).
Die gleiche Idee liegt wohl auch der segnenden Hand mit dem
Kreuznimbus auf dem Zweitältesten Siegel des Benedictinerstiftes
Göitweig zu Grunde 4).
Die Staupsäule in Breslau.
Lhiter die wenigen noch erhaltenen Denkmäler mittelalterlicher
Rechtspflege verdient die Breslauer Staupsäule eine besondere Beach-
tung, weil sie auch architektonisch verziert, der einzige Best der
alten Schandpfähle ist. Wenigstens sind mir aus anderen Städten
keine ähnlichen Monumente bekannt.
Auf drei Stufen erhebt sich vor dem Rathhause diese etwa 20 Fuss
hohe Säule, deren Schaft viereckig, ähnlich den Fialenleitern profilirt
ist. DerobereTheil, der aui'einerAuskragung ruht,ist lOeckig, eine
Form, die mit der des viereckigen Unterbaues sich sehr schlecht in
Einklang bringen lässt. Das Nähere der Consti uction ist aus der bei-
gefügten Zeichnung (Fig. 1) zu ersehen. Das ganze Monument ist
aus Sandstein im Jahre 1492 errichtet und im XYII. und
XIX. Jahrhunderts renovirt worden. Vor der letzten Restauration
konnte man noch Reste von Ketten an dem Schafte des Schand-
pfahls wahrnehmen, mit denen wahrscheinlich die zum Pranger
Yerurtheilten angeschlossen wurden. Im Jahre 1848 war die
ursprüngliche Bedeutung der Säule noch sowenig vergessen,
dass das Volk missliebige Persönlichkeiten wenigstens in efHgie
daran an den Pranger stellte.
Staupsäule heisst sie im Munde des Volkes, da an ihr Verbrecher
mit Ruthen gestäupt wurden. Auf diese Bestimmung deutet auch das
Figlirchen hin, welches die ganze Säule krönt. Augenscheinlich stellt
es einen Büttel vor. Uber die Bekleidung desselben kann man nichts
Genaueres mittheilen, da bei der gelingen Grösse (etwa 2 Fuss) und
der Höhe, in der es angebracht ist, man nicht deutlich die Bekleidung
1) See länder Nicolaus, Schriften der deutschen Münzen mittetalterlicher
Zeif.4.Hannover 742. S. lt4undTaf.f?Fig. 1.
2) Seetändert.c.Taf.BFig.3.
3) Seeländer t. c. Taf. Z? Fig. 4 nach Schanat, Hietarchia, Futdens.
S. 284.
4) JahrbuchlH, Nr. 14,Fig.8.
sehen kann. Mir scheint es, dass es in einer Rüstung gehüllt ist. ln
der rechten hält er den Staupbesen, an der linken Seite hängt ein
langes zweihändiges Schwert. Das Haupt ist mit dichtem Haar bedeckt
! 'äy
(fig. i.)
und ein Schnurrbart an dem nicht hässlichen Gesicht zu unter-
scheiden. Das Fähnchen, welches in den Kopf des Büttels eingelassen,
zeigt ein W (Wratislavia).
Vielleicht istdiesekleine Statuette die nussverstandeneNach-
bildung eines Roland oder Ruotlandhildes. Zöptl führt ja in seinen
„Rechtsalterthümern" (3. Theil) mehrere solche Rolandssäulen an,
deren wahre Bestimmung dem Bildhauer schon unklar gewesen, und
diedesshalb vom ursprünglichenTypus mehr oder weniger abweichen.
Für meine Annahme dürfte noch der Umstand zeugen, dass,
wie Herr Referendarius Wendroth mir mittheilte, in den Urkunden
dieses Bild unter dem Namen miles vorkommt.
Alwin Schultz.
Merkwürdiger Büchereinband vom Jahre 147t.
Auf Bildern des XV. Jahrhunderts sieht man häußg in Begleitung
heiliger oder geistlicher Personen Bücher, deren Einband mit einem
Beutel versehen ist, die oft kostbar verziert, zum stattlichen
Aussehen derselben nicht wenig beitragen. Derlei Bücher haben sich
Es lag somit ganz nahe, dass die spätere Zeit das Kreuz als
redendesXVappen desStiftesHeiligenkreuz annahm, uttd dass man
durch dieaufdcmKreuzeliegcnde Hand andeuten wollte, dassdurch
dassetbedasHeil, der Segen in die Welt kam. Es ist diese Dar-
stellung, so wie diese Deutung eine der Symbolik des Mittelalters
keineswegs fremde, wofür sich positive Belege anführen lassen. Als
nämlich das Grabmahl Kaisers Lothar II., welcher im Jahre 1137
starh, und in dem von ihm gestifteten Kloster Königslutter heigesetzt
wurde, im Jahre 1620 eröffnet wurde, fand sich darin nebst einem
Schwerte, einen bleiernen Reichsapfel mit eisernem Kreuze und einer
beschriebenen Bleiplatte, auch ein silberner und vergoldeter Kelch
mit einer gleichen Patene vor; auf letzterer befand sich ein Kreuz
und darauf eine segnende Hand mit derUmschrift in gothischer
Majuskel: DEXTERA. SVM1 PATRISi) — Auf einem Grabsteine
des Simon von Slitese vom Jahre 1170 in Fulda befindet sich über
dem Wappenschilde in einem Kreise eine aus Wolken hcrahrei-
chende segnende Hand, die ebenfalls auf einem Kreuze ruht, mit der
Umschrift in gothischer Majuskel: DEXTEBA DNI FEC1T VIRTV-
TEM'). Endlich führte das Stift Heiligenkreuz zu Hunefcld im
Fuldaischen eine ganz gleiche Darstellung, wie das Wappen unseres
Stiftes Heiligenkreuz, bereits auf einem Siegel vom Jahre 1267,
nämlich ein Kreuz mit Strahlen und darauf eine segnende Hand,
das Siegel hat in gothischer Majuskel zwischen Perlenlinien die
Umschrift: SigillumEcel.S.CrucisinHunevelfS).
Die gleiche Idee liegt wohl auch der segnenden Hand mit dem
Kreuznimbus auf dem Zweitältesten Siegel des Benedictinerstiftes
Göitweig zu Grunde 4).
Die Staupsäule in Breslau.
Lhiter die wenigen noch erhaltenen Denkmäler mittelalterlicher
Rechtspflege verdient die Breslauer Staupsäule eine besondere Beach-
tung, weil sie auch architektonisch verziert, der einzige Best der
alten Schandpfähle ist. Wenigstens sind mir aus anderen Städten
keine ähnlichen Monumente bekannt.
Auf drei Stufen erhebt sich vor dem Rathhause diese etwa 20 Fuss
hohe Säule, deren Schaft viereckig, ähnlich den Fialenleitern profilirt
ist. DerobereTheil, der aui'einerAuskragung ruht,ist lOeckig, eine
Form, die mit der des viereckigen Unterbaues sich sehr schlecht in
Einklang bringen lässt. Das Nähere der Consti uction ist aus der bei-
gefügten Zeichnung (Fig. 1) zu ersehen. Das ganze Monument ist
aus Sandstein im Jahre 1492 errichtet und im XYII. und
XIX. Jahrhunderts renovirt worden. Vor der letzten Restauration
konnte man noch Reste von Ketten an dem Schafte des Schand-
pfahls wahrnehmen, mit denen wahrscheinlich die zum Pranger
Yerurtheilten angeschlossen wurden. Im Jahre 1848 war die
ursprüngliche Bedeutung der Säule noch sowenig vergessen,
dass das Volk missliebige Persönlichkeiten wenigstens in efHgie
daran an den Pranger stellte.
Staupsäule heisst sie im Munde des Volkes, da an ihr Verbrecher
mit Ruthen gestäupt wurden. Auf diese Bestimmung deutet auch das
Figlirchen hin, welches die ganze Säule krönt. Augenscheinlich stellt
es einen Büttel vor. Uber die Bekleidung desselben kann man nichts
Genaueres mittheilen, da bei der gelingen Grösse (etwa 2 Fuss) und
der Höhe, in der es angebracht ist, man nicht deutlich die Bekleidung
1) See länder Nicolaus, Schriften der deutschen Münzen mittetalterlicher
Zeif.4.Hannover 742. S. lt4undTaf.f?Fig. 1.
2) Seetändert.c.Taf.BFig.3.
3) Seeländer t. c. Taf. Z? Fig. 4 nach Schanat, Hietarchia, Futdens.
S. 284.
4) JahrbuchlH, Nr. 14,Fig.8.
sehen kann. Mir scheint es, dass es in einer Rüstung gehüllt ist. ln
der rechten hält er den Staupbesen, an der linken Seite hängt ein
langes zweihändiges Schwert. Das Haupt ist mit dichtem Haar bedeckt
! 'äy
(fig. i.)
und ein Schnurrbart an dem nicht hässlichen Gesicht zu unter-
scheiden. Das Fähnchen, welches in den Kopf des Büttels eingelassen,
zeigt ein W (Wratislavia).
Vielleicht istdiesekleine Statuette die nussverstandeneNach-
bildung eines Roland oder Ruotlandhildes. Zöptl führt ja in seinen
„Rechtsalterthümern" (3. Theil) mehrere solche Rolandssäulen an,
deren wahre Bestimmung dem Bildhauer schon unklar gewesen, und
diedesshalb vom ursprünglichenTypus mehr oder weniger abweichen.
Für meine Annahme dürfte noch der Umstand zeugen, dass,
wie Herr Referendarius Wendroth mir mittheilte, in den Urkunden
dieses Bild unter dem Namen miles vorkommt.
Alwin Schultz.
Merkwürdiger Büchereinband vom Jahre 147t.
Auf Bildern des XV. Jahrhunderts sieht man häußg in Begleitung
heiliger oder geistlicher Personen Bücher, deren Einband mit einem
Beutel versehen ist, die oft kostbar verziert, zum stattlichen
Aussehen derselben nicht wenig beitragen. Derlei Bücher haben sich