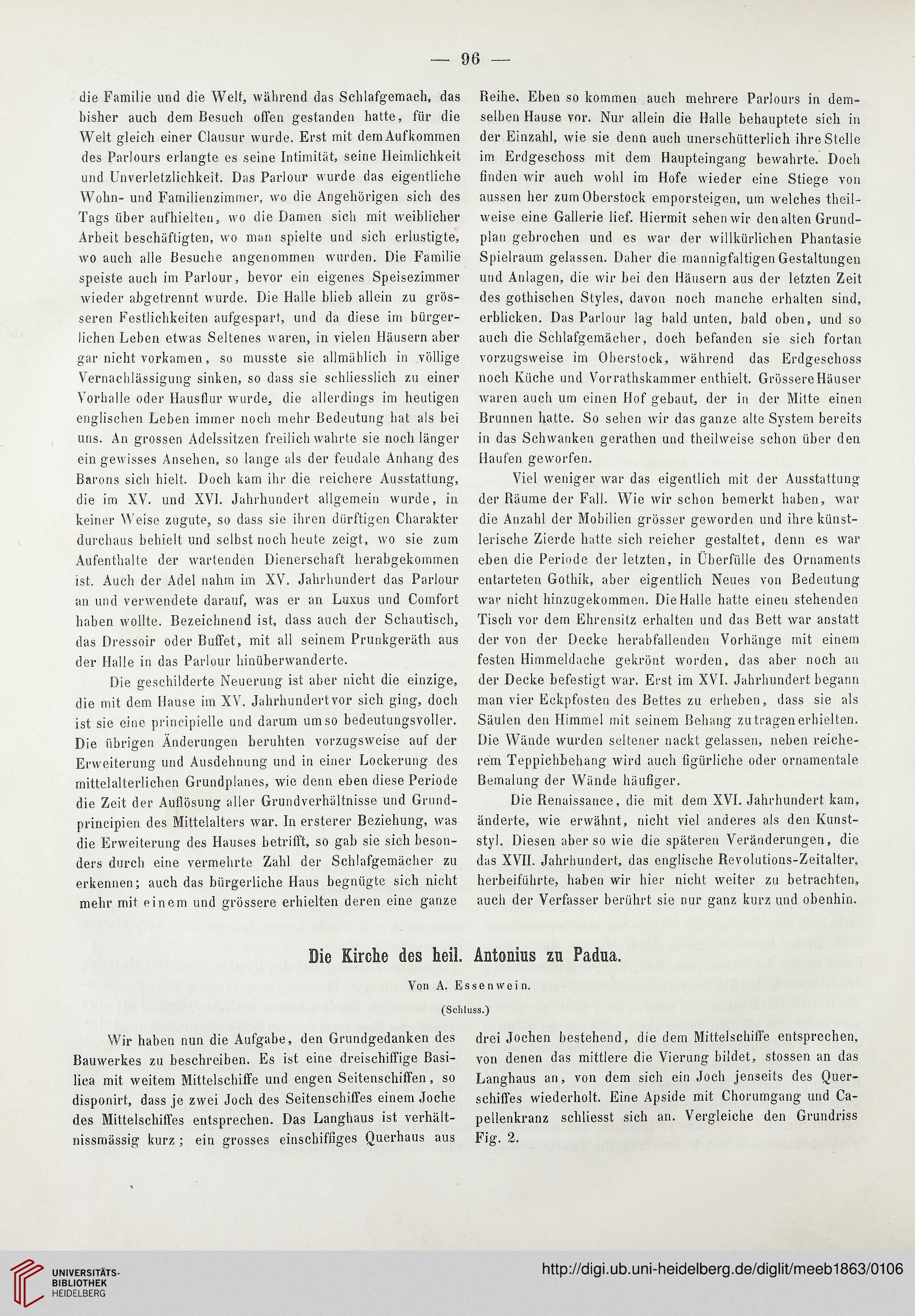96 —
die Familie und die Weit, während das Schlafgemach, das
bisher auch dem Besuch offen gestanden hatte, für die
Weit gieich einer Clausur wurde. Erst mit dem Aufkommen
des Pariours eriangte es seine Intimität, seine Heimiichkeit
und Unverietziichkeit. Das Pariour wurde das eigentiiche
Wohn- und Famiiienzimmer, wo die Angehörigen sich des
Tags über aufhieiten, wo die Damen sich mit weihiicher
Arbeit beschäftigten, wo man spieite und sich eriustigte,
wo auch aiie Besuche angenommen wurden. Die Famiiie
speiste auch im Pariour, bevor ein eigenes Speisezimmer
wieder abgetrennt wurde. Die Haiie blieb aiiein zu grös-
seren Festiichkeiten aufgespart, und da diese im bürger-
iichen Leben etwas Seltenes waren, in vielen Häusern aber
gar nicht vorkamen, so musste sie allmählich in völlige
Vernachlässigung sinken, so dass sie schliesslich zu einer
Vorhalle oder Hausflur wurde, die allerdings im heutigen
englischen Leben immer noch mehr Bedeutung hat als bei
uns. An grossen Adelssitzen freilich wahrte sie noch länger
ein gewisses Ansehen, so lange als der feudale Anhang des
Barons sich hielt. Doch kam ihr die reichere Ausstattung,
die im XV. und XVI. Jahrhundert allgemein wurde, in
keiner Weise zugute, so dass sie ihren dürftigen Charakter
durchaus behielt und selbst noch heute zeigt, wo sie zum
Aufenthalte der wartenden Dienerschaft herabgekommen
ist. Auch der Adel nahm im XV. Jahrhundert das Pariour
an und verwendete darauf, was er an Luxus und Comfort
haben wollte. Bezeichnend ist, dass auch der Schautisch,
das Dressoir oder Buffet, mit all seinem Prunkgeräth aus
der Halle in das Pariour hinüberwanderte.
Die geschilderte Neuerung ist aber nicht die einzige,
die mit dem Hause im XV. Jahrhundert vor sich ging, doch
ist sie eine principielle und darum umso bedeutungsvoller.
Die übrigen Änderungen beruhten vorzugsweise auf der
Erweiterung und Ausdehnung und in einer Lockerung des
mittelalterlichen Grundplanes, wie denn eben diese Periode
die Zeit der Auflösung aller Grundverhältnisse und Grund-
principien des Mittelalters war. In ersterer Beziehung, was
die Erweiterung des Hauses betrifft, so gab sie sich beson-
ders durch eine vermehrte Zahl der Schlafgemächer zu
erkennen; auch das bürgerliche Haus begnügte sich nicht
mehr mit einem und grössere erhielten deren eine ganze
Reihe. Eben so kommen auch mehrere Pariours in dem-
selben Hause vor. Nur allein die Halle behauptete sich in
der Einzahl, wie sie denn auch unerschütterlich ihre Stelle
im Erdgeschoss mit dem Haupteingang bewahrte. Doch
finden wir auch wohl im Hofe wieder eine Stiege von
aussen her zum Oberstock emporsteigen, um welches theil-
weise eine Gallerie lief. Hiermit sehen wir den alten Grund-
plan gebrochen und es war der willkürlichen Phantasie
Spielraum gelassen. Daher die mannigfaltigen Gestaltungen
und Anlagen, die wir bei den Häusern aus der letzten Zeit
des gothiscben Styles, davon noch manche erhalten sind,
erblicken. Das Pariour lag bald unten, bald oben, und so
auch die Schlafgemächer, doch befanden sie sich fortan
vorzugsweise im Oberstock, während das Erdgeschoss
noch Küche und Vorrathskammer enthielt. GrössereHäuser
waren auch um einen Hof gebaut, der in der Mitte einen
Brunnen hatte. So sehen wir das ganze alte System bereits
in das Schwanken gerathen und theilweise schon über den
Haufen geworfen.
Viel weniger war das eigentlich mit der Ausstattung
der Räume der Fall. Wie wir schon bemerkt haben, war
die Anzahl der Mobilien grösser geworden und ihre künst-
lerische Zierde hatte sich reicher gestaltet, denn es war
eben die Periode der letzten, in Überfülle des Ornaments
entarteten Gothik, aber eigentlich Neues von Bedeutung
war nicht hinzugekommen. Die Halle hatte einen stehenden
Tisch vor dem Ehrensitz erhalten und das Bett war anstatt
der von der Decke herabfallenden Vorhänge mit einem
festen Himmeldache gekrönt worden, das aber noch an
der Decke befestigt war. Erst im XVI. Jahrhundert begann
man vier Eckpfosten des Bettes zu erbeben, dass sie als
Säulen den Himmel mit seinem Behang zu tragen erhielten.
Die Wände wurden seltener nackt gelassen, neben reiche-
rem Teppichbehang wird auch figürliche oder ornamentale
Bemalung der Wände häufiger.
Die Renaissance, die mit dem XVI. Jahrhundert kam,
änderte, wie erwähnt, nicht viel anderes als den Kunst-
styl. Diesen aber so wie die späteren Veränderungen, die
das XVII. Jahrhundert, das englische Revolutions-Zeitalter,
herbeiführte, haben wir liier nicht weiter zu betrachten,
auch der Verfasser berührt sie nur ganz kurz und obenhin.
Die Kirche des hei!. Antonius zu Padua.
Von A. Essen wein.
Wir haben nun die Aufgabe, den Grundgedanken des
Bauwerkes zu beschreiben. Es ist eine dreischiffige Basi-
lica mit weitem Mittelschiffe und engen Seitenschiffen, so
disponirt, dass je zwei Joch des Seitenschiffes einem Joche
des Mittelschiffes entsprechen. Das Langhaus ist verhält-
nissmässig kurz ; ein grosses einschiffiges Querhaus aus
drei Jochen bestehend, die dem Mittelschiffe entsprechen,
von denen das mittlere die Vierung bildet, stossen an das
Langhaus an, von dem sich ein Joch jenseits des Quer-
schiffes wiederholt. Eine Apside mit Chorumgang und Ca-
pellenkranz schliesst sich an. Vergleiche den Grundriss
Fig. 2.
die Familie und die Weit, während das Schlafgemach, das
bisher auch dem Besuch offen gestanden hatte, für die
Weit gieich einer Clausur wurde. Erst mit dem Aufkommen
des Pariours eriangte es seine Intimität, seine Heimiichkeit
und Unverietziichkeit. Das Pariour wurde das eigentiiche
Wohn- und Famiiienzimmer, wo die Angehörigen sich des
Tags über aufhieiten, wo die Damen sich mit weihiicher
Arbeit beschäftigten, wo man spieite und sich eriustigte,
wo auch aiie Besuche angenommen wurden. Die Famiiie
speiste auch im Pariour, bevor ein eigenes Speisezimmer
wieder abgetrennt wurde. Die Haiie blieb aiiein zu grös-
seren Festiichkeiten aufgespart, und da diese im bürger-
iichen Leben etwas Seltenes waren, in vielen Häusern aber
gar nicht vorkamen, so musste sie allmählich in völlige
Vernachlässigung sinken, so dass sie schliesslich zu einer
Vorhalle oder Hausflur wurde, die allerdings im heutigen
englischen Leben immer noch mehr Bedeutung hat als bei
uns. An grossen Adelssitzen freilich wahrte sie noch länger
ein gewisses Ansehen, so lange als der feudale Anhang des
Barons sich hielt. Doch kam ihr die reichere Ausstattung,
die im XV. und XVI. Jahrhundert allgemein wurde, in
keiner Weise zugute, so dass sie ihren dürftigen Charakter
durchaus behielt und selbst noch heute zeigt, wo sie zum
Aufenthalte der wartenden Dienerschaft herabgekommen
ist. Auch der Adel nahm im XV. Jahrhundert das Pariour
an und verwendete darauf, was er an Luxus und Comfort
haben wollte. Bezeichnend ist, dass auch der Schautisch,
das Dressoir oder Buffet, mit all seinem Prunkgeräth aus
der Halle in das Pariour hinüberwanderte.
Die geschilderte Neuerung ist aber nicht die einzige,
die mit dem Hause im XV. Jahrhundert vor sich ging, doch
ist sie eine principielle und darum umso bedeutungsvoller.
Die übrigen Änderungen beruhten vorzugsweise auf der
Erweiterung und Ausdehnung und in einer Lockerung des
mittelalterlichen Grundplanes, wie denn eben diese Periode
die Zeit der Auflösung aller Grundverhältnisse und Grund-
principien des Mittelalters war. In ersterer Beziehung, was
die Erweiterung des Hauses betrifft, so gab sie sich beson-
ders durch eine vermehrte Zahl der Schlafgemächer zu
erkennen; auch das bürgerliche Haus begnügte sich nicht
mehr mit einem und grössere erhielten deren eine ganze
Reihe. Eben so kommen auch mehrere Pariours in dem-
selben Hause vor. Nur allein die Halle behauptete sich in
der Einzahl, wie sie denn auch unerschütterlich ihre Stelle
im Erdgeschoss mit dem Haupteingang bewahrte. Doch
finden wir auch wohl im Hofe wieder eine Stiege von
aussen her zum Oberstock emporsteigen, um welches theil-
weise eine Gallerie lief. Hiermit sehen wir den alten Grund-
plan gebrochen und es war der willkürlichen Phantasie
Spielraum gelassen. Daher die mannigfaltigen Gestaltungen
und Anlagen, die wir bei den Häusern aus der letzten Zeit
des gothiscben Styles, davon noch manche erhalten sind,
erblicken. Das Pariour lag bald unten, bald oben, und so
auch die Schlafgemächer, doch befanden sie sich fortan
vorzugsweise im Oberstock, während das Erdgeschoss
noch Küche und Vorrathskammer enthielt. GrössereHäuser
waren auch um einen Hof gebaut, der in der Mitte einen
Brunnen hatte. So sehen wir das ganze alte System bereits
in das Schwanken gerathen und theilweise schon über den
Haufen geworfen.
Viel weniger war das eigentlich mit der Ausstattung
der Räume der Fall. Wie wir schon bemerkt haben, war
die Anzahl der Mobilien grösser geworden und ihre künst-
lerische Zierde hatte sich reicher gestaltet, denn es war
eben die Periode der letzten, in Überfülle des Ornaments
entarteten Gothik, aber eigentlich Neues von Bedeutung
war nicht hinzugekommen. Die Halle hatte einen stehenden
Tisch vor dem Ehrensitz erhalten und das Bett war anstatt
der von der Decke herabfallenden Vorhänge mit einem
festen Himmeldache gekrönt worden, das aber noch an
der Decke befestigt war. Erst im XVI. Jahrhundert begann
man vier Eckpfosten des Bettes zu erbeben, dass sie als
Säulen den Himmel mit seinem Behang zu tragen erhielten.
Die Wände wurden seltener nackt gelassen, neben reiche-
rem Teppichbehang wird auch figürliche oder ornamentale
Bemalung der Wände häufiger.
Die Renaissance, die mit dem XVI. Jahrhundert kam,
änderte, wie erwähnt, nicht viel anderes als den Kunst-
styl. Diesen aber so wie die späteren Veränderungen, die
das XVII. Jahrhundert, das englische Revolutions-Zeitalter,
herbeiführte, haben wir liier nicht weiter zu betrachten,
auch der Verfasser berührt sie nur ganz kurz und obenhin.
Die Kirche des hei!. Antonius zu Padua.
Von A. Essen wein.
Wir haben nun die Aufgabe, den Grundgedanken des
Bauwerkes zu beschreiben. Es ist eine dreischiffige Basi-
lica mit weitem Mittelschiffe und engen Seitenschiffen, so
disponirt, dass je zwei Joch des Seitenschiffes einem Joche
des Mittelschiffes entsprechen. Das Langhaus ist verhält-
nissmässig kurz ; ein grosses einschiffiges Querhaus aus
drei Jochen bestehend, die dem Mittelschiffe entsprechen,
von denen das mittlere die Vierung bildet, stossen an das
Langhaus an, von dem sich ein Joch jenseits des Quer-
schiffes wiederholt. Eine Apside mit Chorumgang und Ca-
pellenkranz schliesst sich an. Vergleiche den Grundriss
Fig. 2.