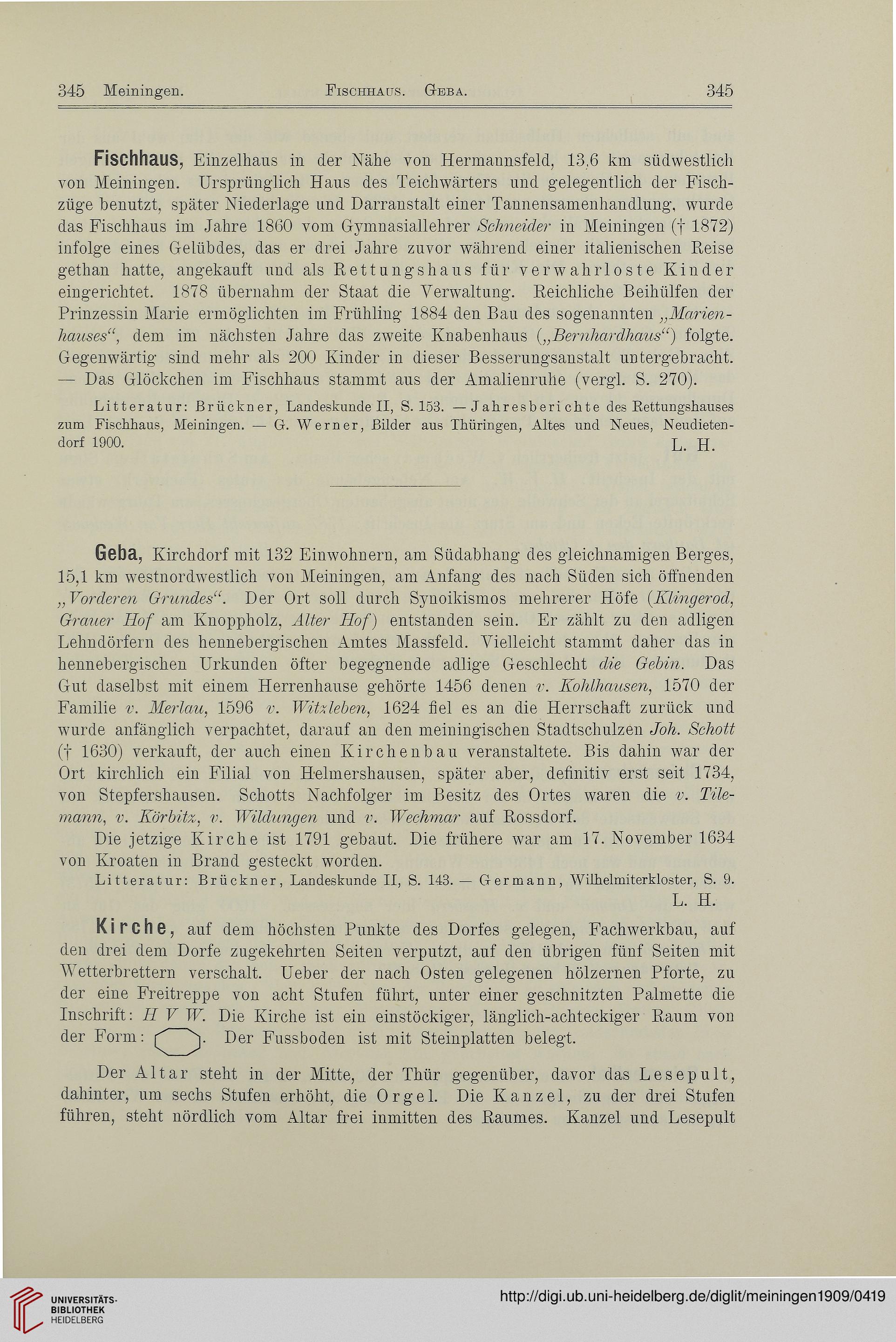Fischhaus, Einzelhaus in der Nähe von Hermannsfeld, 13.6 km südwestlich
von Memingen. Ursprünglich Haus des Teichwärters und gelegentlich der Fisch-
züge benutzt, später Niederlage und Darranstalt einer Tannensamenhandlung, wurde
das Fischhaus im Jahre 1860 vom Gymnasiallehrer Schneider in Meiningen (f 1872)
infolge eines Gelübdes, das er drei Jahre zuvor während einer italienischen Reise
gethan hatte, augekauft und als Rettungshaus für verwahrloste Kinder
eingerichtet. 1878 übernahm der Staat die Verwaltung. Reichliche Beihülfen der
Prinzessin Marie ermöglichten im Frühling 1884 den Bau des sogenannten „Marien-
hauses", dem im nächsten Jahre das zweite Knabenhaus {„Bernhardhaus") folgte.
Gegenwärtig sind mehr als 200 Kinder in dieser Besserungsanstalt untergebracht.
— Das Glöckchen im Fischhaus stammt aus der Amalienruhe (vergl. S. 270).
Litteratur: Brückner, Landeskunde II, S. 153. —Jahresberichte des Eettungshauses
zum Fischhaus, Meiningen. — G. Werner, Bilder aus Thüringen, Altes und Neues, Neudieten-
dorf 1900. L. H.
Geba, Kirchdorf mit 132 Einwohnern, am Südabhang des gleichnamigen Berges,
15,1 km westnordwestlich von Meiningen, am Anfang des nach Süden sich öffnenden
„Vorderen Grundes". Der Ort soll durch Synoikismos mehrerer Höfe (Klingerod,
Grauer Hof am Knoppholz, Alter Hof) entstanden sein. Er zählt zu den adligen
Lehndörfern des hennebergischen Amtes Massfeld. Vielleicht stammt daher das in
hennebergischen Urkunden öfter begegnende adlige Geschlecht die Gebin. Das
Gut daselbst mit einem Herrenhause gehörte 1456 denen r. Kohlhausen, 1570 der
Familie v. Merlau, 1596 v. Witxleben, 1624 fiel es an die Herrschaft zurück und
wurde anfänglich verpachtet, darauf an den meiningischen Stadtschurzen Joh. Schott
(f 1630) verkauft, der auch einen Kirchenbau veranstaltete. Bis dahin war der
Ort kirchlich ein Filial von Helmershausen, später aber, definitiv erst seit 1734,
von Stepfershausen. Schotts Nachfolger im Besitz des Ortes waren die v. Tile-
mann, v. Kürbitz, v. Wildungen und v. Wechmar auf Rossdorf.
Die jetzige Kirche ist 1791 gebaut. Die frühere war am 17. November 1634
von Kroaten in Brand gesteckt worden.
Litteratur: Brückner, Landeskunde II, S. 143. — Germann, Wilhelmiterkloster, S. 9.
L. H.
Kirche, auf dem höchsten Punkte des Dorfes gelegen, Fachwerkbau, auf
den drei dem Dorfe zugekehrten Seiten verputzt, auf den übrigen fünf Seiten mit
Wetterbrettern verschalt. Ueber der nach Osten gelegenen hölzernen Pforte, zu
der eine Freitreppe von acht Stufen führt, unter einer geschnitzten Palmette die
Inschrift: H V W. Die Kirche ist ein einstöckiger, länglich-achteckiger Raum von
der Form: ^. Der Fussboden ist mit Steinplatten belegt.
Der Altar steht in der Mitte, der Thür gegenüber, davor das Lesepult,
dahinter, um sechs Stufen erhöht, die Orgel. Die Kanzel, zu der drei Stufen
führen, steht nördlich vom Altar frei inmitten des Raumes. Kanzel und Lesepult
von Memingen. Ursprünglich Haus des Teichwärters und gelegentlich der Fisch-
züge benutzt, später Niederlage und Darranstalt einer Tannensamenhandlung, wurde
das Fischhaus im Jahre 1860 vom Gymnasiallehrer Schneider in Meiningen (f 1872)
infolge eines Gelübdes, das er drei Jahre zuvor während einer italienischen Reise
gethan hatte, augekauft und als Rettungshaus für verwahrloste Kinder
eingerichtet. 1878 übernahm der Staat die Verwaltung. Reichliche Beihülfen der
Prinzessin Marie ermöglichten im Frühling 1884 den Bau des sogenannten „Marien-
hauses", dem im nächsten Jahre das zweite Knabenhaus {„Bernhardhaus") folgte.
Gegenwärtig sind mehr als 200 Kinder in dieser Besserungsanstalt untergebracht.
— Das Glöckchen im Fischhaus stammt aus der Amalienruhe (vergl. S. 270).
Litteratur: Brückner, Landeskunde II, S. 153. —Jahresberichte des Eettungshauses
zum Fischhaus, Meiningen. — G. Werner, Bilder aus Thüringen, Altes und Neues, Neudieten-
dorf 1900. L. H.
Geba, Kirchdorf mit 132 Einwohnern, am Südabhang des gleichnamigen Berges,
15,1 km westnordwestlich von Meiningen, am Anfang des nach Süden sich öffnenden
„Vorderen Grundes". Der Ort soll durch Synoikismos mehrerer Höfe (Klingerod,
Grauer Hof am Knoppholz, Alter Hof) entstanden sein. Er zählt zu den adligen
Lehndörfern des hennebergischen Amtes Massfeld. Vielleicht stammt daher das in
hennebergischen Urkunden öfter begegnende adlige Geschlecht die Gebin. Das
Gut daselbst mit einem Herrenhause gehörte 1456 denen r. Kohlhausen, 1570 der
Familie v. Merlau, 1596 v. Witxleben, 1624 fiel es an die Herrschaft zurück und
wurde anfänglich verpachtet, darauf an den meiningischen Stadtschurzen Joh. Schott
(f 1630) verkauft, der auch einen Kirchenbau veranstaltete. Bis dahin war der
Ort kirchlich ein Filial von Helmershausen, später aber, definitiv erst seit 1734,
von Stepfershausen. Schotts Nachfolger im Besitz des Ortes waren die v. Tile-
mann, v. Kürbitz, v. Wildungen und v. Wechmar auf Rossdorf.
Die jetzige Kirche ist 1791 gebaut. Die frühere war am 17. November 1634
von Kroaten in Brand gesteckt worden.
Litteratur: Brückner, Landeskunde II, S. 143. — Germann, Wilhelmiterkloster, S. 9.
L. H.
Kirche, auf dem höchsten Punkte des Dorfes gelegen, Fachwerkbau, auf
den drei dem Dorfe zugekehrten Seiten verputzt, auf den übrigen fünf Seiten mit
Wetterbrettern verschalt. Ueber der nach Osten gelegenen hölzernen Pforte, zu
der eine Freitreppe von acht Stufen führt, unter einer geschnitzten Palmette die
Inschrift: H V W. Die Kirche ist ein einstöckiger, länglich-achteckiger Raum von
der Form: ^. Der Fussboden ist mit Steinplatten belegt.
Der Altar steht in der Mitte, der Thür gegenüber, davor das Lesepult,
dahinter, um sechs Stufen erhöht, die Orgel. Die Kanzel, zu der drei Stufen
führen, steht nördlich vom Altar frei inmitten des Raumes. Kanzel und Lesepult