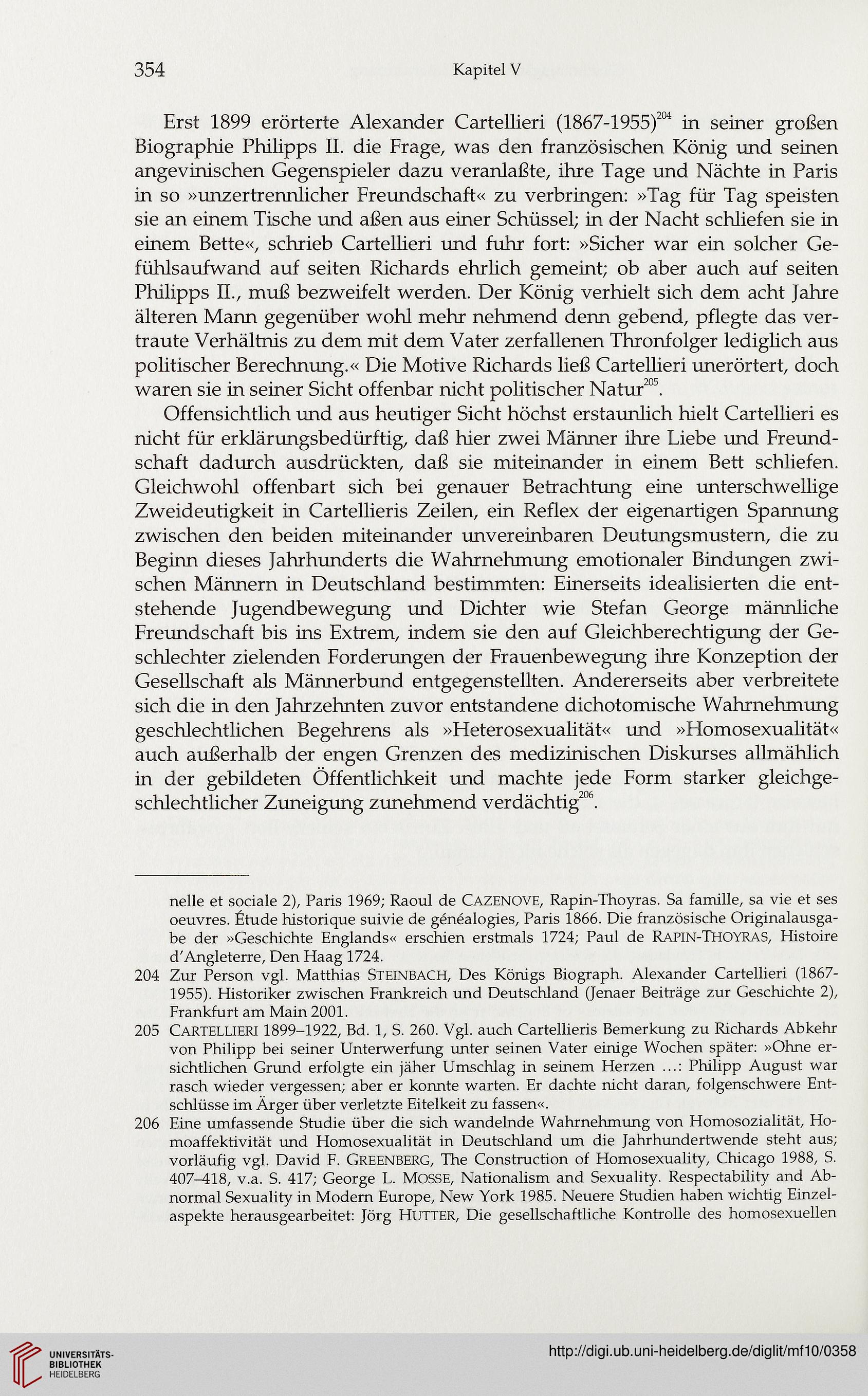354
KapitelV
Erst 1899 erörterte Alexander Cartellieri (1867-1955)^ in seiner großen
Biographie Philipps II. die Frage, was den französischen König und seinen
angevinischen Gegenspieler dazu veranlaßte, ihre Tage und Nächte in Paris
in so »unzertrennlicher Freundschaft« zu verbringen: »Tag für Tag speisten
sie an einem Tische und aßen aus einer Schüssel; in der Nacht schliefen sie in
einem Bette«, schrieb Cartellieri und fuhr fort: »Sicher war ein solcher Ge-
fühlsaufwand auf seiten Richards ehrlich gemeint; ob aber auch auf seiten
Philipps II., muß bezweifelt werden. Der König verhielt sich dem acht Jahre
älteren Mann gegenüber wohl mehr nehmend denn gebend, pflegte das ver-
traute Verhältnis zu dem mit dem Vater zerfallenen Thronfolger lediglich aus
politischer Berechnung.« Die Motive Richards ließ Cartellieri unerörtert, doch
waren sie in seiner Sicht offenbar nicht politischer Natur' ".
Offensichtlich und aus heutiger Sicht höchst erstaunlich hielt Cartellieri es
nicht für erklärungsbedürftig, daß hier zwei Männer ihre Fiebe und Freund-
schaft dadurch ausdrückten, daß sie miteinander in einem Bett schliefen.
Gleichwohl offenbart sich bei genauer Betrachtung eine unterschwellige
Zweideutigkeit in Cartellieris Zeilen, ein Reflex der eigenartigen Spannung
zwischen den beiden miteinander unvereinbaren Deutungsmustern, die zu
Beginn dieses Jahrhunderts die Wahrnehmung emotionaler Bindungen zwi-
schen Männern in Deutschland bestimmten: Einerseits idealisierten die ent-
stehende Jugendbewegung und Dichter wie Stefan George männliche
Freundschaft bis ins Extrem, indem sie den auf Gleichberechtigung der Ge-
schlechter zielenden Forderungen der Frauenbewegung ihre Konzeption der
Gesellschaft als Männerbund entgegenstellten. Andererseits aber verbreitete
sich die in den Jahrzehnten zuvor entstandene dichotomische Wahrnehmung
geschlechtlichen Begehrens als »Fleterosexualität« und »Homosexualität«
auch außerhalb der engen Grenzen des medizinischen Diskurses allmählich
in der gebildeten Öffentlichkeit und machte jede Form starker gleichge-
schlechtlicher Zuneigung zunehmend verdächtigt.
nelle et sociale 2), Paris 1969; Raoul de CAZENOVE, Rapin-Thoyras. Sa famiile, sa vie et ses
oeuvres. Etüde historique suivie de genealogies, Paris 1866. Die französische Originalausga-
be der »Geschichte Englands« erschien erstmals 1724; Paul de RAPIN-THOYRAS, Histoire
d'Angleterre, Den Haag 1724.
204 Zur Person vgl. Matthias STEINBACH, Des Königs Biograph. Alexander Cartellieri (1867-
1955). Historiker zwischen Frankreich und Deutschland (Jenaer Beiträge zur Geschichte 2),
Frankfurt am Main 2001.
205 CARTELLIERI 1899-1922, Bd. 1, S. 260. Vgl. auch Cartellieris Bemerkung zu Richards Abkehr
von Philipp bei seiner Unterwerfung unter seinen Vater einige Wochen später: »Ohne er-
sichtlichen Grund erfolgte ein jäher Umschlag in seinem Herzen ...: Philipp August war
rasch wieder vergessen; aber er konnte warten. Er dachte nicht daran, folgenschwere Ent-
schlüsse im Ärger über verletzte Eitelkeit zu fassen«.
206 Eine umfassende Studie über die sich wandelnde Wahrnehmung von Homosozialität, Ho-
moaffektivität und Homosexualität in Deutschland um die Jahrhundertwende steht aus;
vorläufig vgl. David F. GREENBERC, The Construction of Homosexuality, Chicago 1988, S.
407M18, v.a. S. 417; George L. MOSSE, Nationalism and Sexuality. Respectability and Ab-
normal Sexuality in Modern Europe, New York 1985. Neuere Studien haben wichtig Einzel-
aspekte herausgearbeitet: Jörg HUTTER, Die gesellschaftliche Kontrolle des homosexuellen
KapitelV
Erst 1899 erörterte Alexander Cartellieri (1867-1955)^ in seiner großen
Biographie Philipps II. die Frage, was den französischen König und seinen
angevinischen Gegenspieler dazu veranlaßte, ihre Tage und Nächte in Paris
in so »unzertrennlicher Freundschaft« zu verbringen: »Tag für Tag speisten
sie an einem Tische und aßen aus einer Schüssel; in der Nacht schliefen sie in
einem Bette«, schrieb Cartellieri und fuhr fort: »Sicher war ein solcher Ge-
fühlsaufwand auf seiten Richards ehrlich gemeint; ob aber auch auf seiten
Philipps II., muß bezweifelt werden. Der König verhielt sich dem acht Jahre
älteren Mann gegenüber wohl mehr nehmend denn gebend, pflegte das ver-
traute Verhältnis zu dem mit dem Vater zerfallenen Thronfolger lediglich aus
politischer Berechnung.« Die Motive Richards ließ Cartellieri unerörtert, doch
waren sie in seiner Sicht offenbar nicht politischer Natur' ".
Offensichtlich und aus heutiger Sicht höchst erstaunlich hielt Cartellieri es
nicht für erklärungsbedürftig, daß hier zwei Männer ihre Fiebe und Freund-
schaft dadurch ausdrückten, daß sie miteinander in einem Bett schliefen.
Gleichwohl offenbart sich bei genauer Betrachtung eine unterschwellige
Zweideutigkeit in Cartellieris Zeilen, ein Reflex der eigenartigen Spannung
zwischen den beiden miteinander unvereinbaren Deutungsmustern, die zu
Beginn dieses Jahrhunderts die Wahrnehmung emotionaler Bindungen zwi-
schen Männern in Deutschland bestimmten: Einerseits idealisierten die ent-
stehende Jugendbewegung und Dichter wie Stefan George männliche
Freundschaft bis ins Extrem, indem sie den auf Gleichberechtigung der Ge-
schlechter zielenden Forderungen der Frauenbewegung ihre Konzeption der
Gesellschaft als Männerbund entgegenstellten. Andererseits aber verbreitete
sich die in den Jahrzehnten zuvor entstandene dichotomische Wahrnehmung
geschlechtlichen Begehrens als »Fleterosexualität« und »Homosexualität«
auch außerhalb der engen Grenzen des medizinischen Diskurses allmählich
in der gebildeten Öffentlichkeit und machte jede Form starker gleichge-
schlechtlicher Zuneigung zunehmend verdächtigt.
nelle et sociale 2), Paris 1969; Raoul de CAZENOVE, Rapin-Thoyras. Sa famiile, sa vie et ses
oeuvres. Etüde historique suivie de genealogies, Paris 1866. Die französische Originalausga-
be der »Geschichte Englands« erschien erstmals 1724; Paul de RAPIN-THOYRAS, Histoire
d'Angleterre, Den Haag 1724.
204 Zur Person vgl. Matthias STEINBACH, Des Königs Biograph. Alexander Cartellieri (1867-
1955). Historiker zwischen Frankreich und Deutschland (Jenaer Beiträge zur Geschichte 2),
Frankfurt am Main 2001.
205 CARTELLIERI 1899-1922, Bd. 1, S. 260. Vgl. auch Cartellieris Bemerkung zu Richards Abkehr
von Philipp bei seiner Unterwerfung unter seinen Vater einige Wochen später: »Ohne er-
sichtlichen Grund erfolgte ein jäher Umschlag in seinem Herzen ...: Philipp August war
rasch wieder vergessen; aber er konnte warten. Er dachte nicht daran, folgenschwere Ent-
schlüsse im Ärger über verletzte Eitelkeit zu fassen«.
206 Eine umfassende Studie über die sich wandelnde Wahrnehmung von Homosozialität, Ho-
moaffektivität und Homosexualität in Deutschland um die Jahrhundertwende steht aus;
vorläufig vgl. David F. GREENBERC, The Construction of Homosexuality, Chicago 1988, S.
407M18, v.a. S. 417; George L. MOSSE, Nationalism and Sexuality. Respectability and Ab-
normal Sexuality in Modern Europe, New York 1985. Neuere Studien haben wichtig Einzel-
aspekte herausgearbeitet: Jörg HUTTER, Die gesellschaftliche Kontrolle des homosexuellen