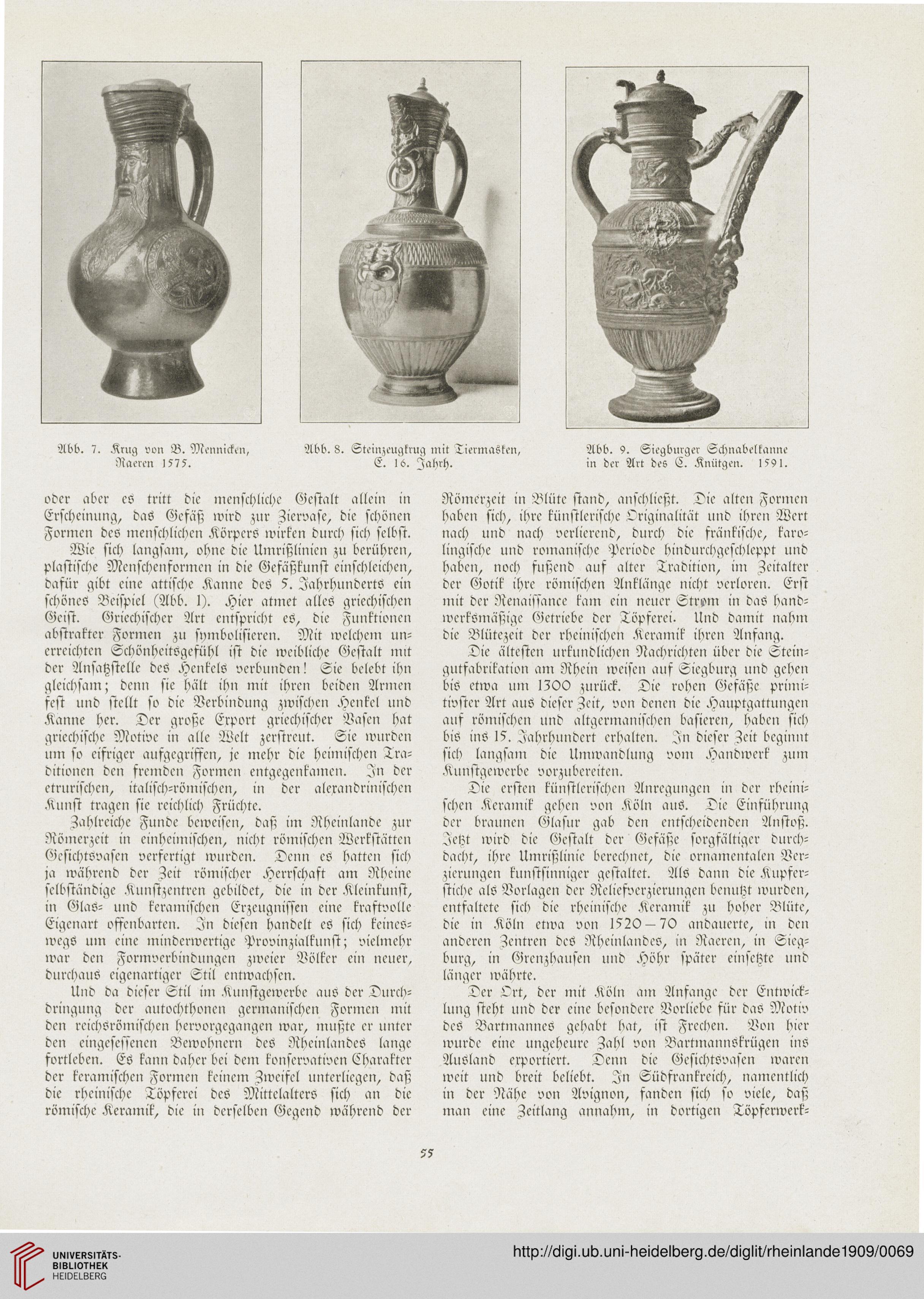oder nbcr es tritt dic menschliche Gcftnlt nllcin >n
Erschcinung, dnS Gefäß wird zur Zicrvnse, die schönen
Formen des menschlichen Körpers wirken durch sich selbst.
Wie sich lnngsnm, ohne die Umrißlinicn zu berühren,
plnstische Menschenformen in die Gefnßkunst einschleichen,
dnsür gibt eine attische Kanne des 5. Jahrhunderts ein
schöncs Beispiel (Abb. I). Hier ntmet nlles griechischen
Geist. Griechischer Art entspricht es, die Funktioncn
abstrnkter Formen zu symbolisieren. Mit welchem un-
crrcichten Schönhcitsgesühl ist die weibliche Gestnlt uut
der Ansntzstelle des Henkcls verbunden! Sie belebt ihn
gleichsnm; denn sie hält ihn mit ihren beiden Armen
sest und stellt so die Verbindung zwischen Henkel und
Knnne her. Der große Export griechischer Vnsen hat
griechische Motive in alle Welt zerstreut. Sie wurden
um so cisriger nufgegriffen, jc mehr die heimischen Trn-
ditionen den frcmdcn Formen entgegenknmcn. Jn der
etrurischen, italisch-römischen, in der alexnndrinischen
Kunst trngen sie reichlich Früchtc.
Znhlreiche Fundc bcweisen, dnß im Rheinlnnde zur
Römerzeit in einheimischen, nicht römischen Werkstätten
GcsichtSvnsen verscrtigt wurdcn. Dcnn cS hnttcn sich
jn während der Zeit römischer Herrschaft nm Rheine
selbftändige Kunstzentren gebildet, die in der Kleinkunst,
in Glns- und kernmischen Erzeugnissen eine krnstvolle
Eigcnnrt offcnbarten. Jn diesen hnndelt eö sich keincs-
wegs um eine minderwertige Provinzialkunst; vielmehr
wnr deu Formverbindungen zweier Dölker ein ncuer,
durchnuS eigcnartigcr Stil entwnchscn.
Und da dieser Stil im Kunstgewerbe nus der Durch-
dringung dcr nutochthonen germnnischen Formcn mil
dcn rcichörömischen hervorgcgnngen wnr, nmßte cr unter
den eingesessencn Bewobncrn deö Rheinlnndes lnnge
sortleben. Es knnn dnher bei dcm konscrvntiven Chnrnktcr
der kernmischen Forinen keincm Zweifel unterliegen, dnß
die rhcinische Töpserei des Mittclalters sich nn dic
römische Kernmik, die in derselbcn Gegend währcnd der
Römerzeit in Blütc stnnd, nnschlicßt. Dic nlten Formcn
hnbcn sich, ihrc künstlerische Originnlitnt und ihren Wert
nnch und nach vcrlicrcnd, durch die sränkische, knro-
lingische und romnnische Periode hindurchgeschleppt und
hnbcn, noch sußend nus nlter Trndition, im Zeitnlter
der Gotik ihre römischen Anklnnge m'cht verloren. Erst
mit der Rennissnnce knm ein neucr Strom in dns hnnd-
wcrkömäßige Getriebe der Töpserei. llnd dnmit nnbm
die Blütczeit der rheinischcn Kernnn'k ihren Ansnng.
Die ältestcn urkundlichen Nnchrichtcn über die Stein-
gutsnbrikntion nm Rhein weisen nus Siegburg und gehen
bis etwn um IZOO zurück. Die rohen Gesnßc prinn'-
tivster Art nus dieser Zcit, von dencn die Hnuptgnttungen
aus römischen und nltgcrmnnischen bnsicrcn, habcn sich
bis ins 15. Jnhrhundert crhnlten. Jn dicser Zeit beginnt
sich lnngsnm die Umwnndlung vom Hnndwerk zum
Kunstgewerbe vorzubereiten.
Die crsten künstlcrischen Anrcgungcn in dcr rhcini-
schen Kernmik gehen von Köln nus. Die Einsührung
der brnunen Glnsur gnb den entscheidenden Austoß.
Ietzt wird die Gcstnlt der Gcsäße sorgsältigcr durch-
dncht, ihre Umrißlim'e berechnct, dic ornnmentnlen Vcr-
zierungen kunstsinniger gestaltet. Als dann die Kupser-
stiche nls Vorlngen dcr Rcliefvcrzierungen benutzt wurden,
entfnltcte sich dic rhcim'sche Kernmik zu hoher Blütc,
die in Köln etwa von I52O —70 andauerte, in den
nndcren Ientren dcs Rheinlnndcs, in Rnercn, in Sicg-
burg, in Grcnzbnusen und Höhr später einsetzte und
länger währte.
Der Ort, der mit Köln nm Anfnngc dcr Entwick-
lung steht und dcr eine besondere Vorliebe sür dns Moti'v
des Bartmnnnes gehnbt hnt, ist Frechen. Von hier
wurde einc ungeheure Iahl von Bnrtmnnnskrügen ins
Auslnnd exporticrt. Denn dic Gesichtsvnsen wnrcn
weit und breit beliebt. Jn Südfrankreich, namentlich
in der Nnhe von Avignon, fanden sich so viele, dnß
mnn eine Ieitlnng nnnahm, in dortigen Töpferwerk-
?5
Erschcinung, dnS Gefäß wird zur Zicrvnse, die schönen
Formen des menschlichen Körpers wirken durch sich selbst.
Wie sich lnngsnm, ohne die Umrißlinicn zu berühren,
plnstische Menschenformen in die Gefnßkunst einschleichen,
dnsür gibt eine attische Kanne des 5. Jahrhunderts ein
schöncs Beispiel (Abb. I). Hier ntmet nlles griechischen
Geist. Griechischer Art entspricht es, die Funktioncn
abstrnkter Formen zu symbolisieren. Mit welchem un-
crrcichten Schönhcitsgesühl ist die weibliche Gestnlt uut
der Ansntzstelle des Henkcls verbunden! Sie belebt ihn
gleichsnm; denn sie hält ihn mit ihren beiden Armen
sest und stellt so die Verbindung zwischen Henkel und
Knnne her. Der große Export griechischer Vnsen hat
griechische Motive in alle Welt zerstreut. Sie wurden
um so cisriger nufgegriffen, jc mehr die heimischen Trn-
ditionen den frcmdcn Formen entgegenknmcn. Jn der
etrurischen, italisch-römischen, in der alexnndrinischen
Kunst trngen sie reichlich Früchtc.
Znhlreiche Fundc bcweisen, dnß im Rheinlnnde zur
Römerzeit in einheimischen, nicht römischen Werkstätten
GcsichtSvnsen verscrtigt wurdcn. Dcnn cS hnttcn sich
jn während der Zeit römischer Herrschaft nm Rheine
selbftändige Kunstzentren gebildet, die in der Kleinkunst,
in Glns- und kernmischen Erzeugnissen eine krnstvolle
Eigcnnrt offcnbarten. Jn diesen hnndelt eö sich keincs-
wegs um eine minderwertige Provinzialkunst; vielmehr
wnr deu Formverbindungen zweier Dölker ein ncuer,
durchnuS eigcnartigcr Stil entwnchscn.
Und da dieser Stil im Kunstgewerbe nus der Durch-
dringung dcr nutochthonen germnnischen Formcn mil
dcn rcichörömischen hervorgcgnngen wnr, nmßte cr unter
den eingesessencn Bewobncrn deö Rheinlnndes lnnge
sortleben. Es knnn dnher bei dcm konscrvntiven Chnrnktcr
der kernmischen Forinen keincm Zweifel unterliegen, dnß
die rhcinische Töpserei des Mittclalters sich nn dic
römische Kernmik, die in derselbcn Gegend währcnd der
Römerzeit in Blütc stnnd, nnschlicßt. Dic nlten Formcn
hnbcn sich, ihrc künstlerische Originnlitnt und ihren Wert
nnch und nach vcrlicrcnd, durch die sränkische, knro-
lingische und romnnische Periode hindurchgeschleppt und
hnbcn, noch sußend nus nlter Trndition, im Zeitnlter
der Gotik ihre römischen Anklnnge m'cht verloren. Erst
mit der Rennissnnce knm ein neucr Strom in dns hnnd-
wcrkömäßige Getriebe der Töpserei. llnd dnmit nnbm
die Blütczeit der rheinischcn Kernnn'k ihren Ansnng.
Die ältestcn urkundlichen Nnchrichtcn über die Stein-
gutsnbrikntion nm Rhein weisen nus Siegburg und gehen
bis etwn um IZOO zurück. Die rohen Gesnßc prinn'-
tivster Art nus dieser Zcit, von dencn die Hnuptgnttungen
aus römischen und nltgcrmnnischen bnsicrcn, habcn sich
bis ins 15. Jnhrhundert crhnlten. Jn dicser Zeit beginnt
sich lnngsnm die Umwnndlung vom Hnndwerk zum
Kunstgewerbe vorzubereiten.
Die crsten künstlcrischen Anrcgungcn in dcr rhcini-
schen Kernmik gehen von Köln nus. Die Einsührung
der brnunen Glnsur gnb den entscheidenden Austoß.
Ietzt wird die Gcstnlt der Gcsäße sorgsältigcr durch-
dncht, ihre Umrißlim'e berechnct, dic ornnmentnlen Vcr-
zierungen kunstsinniger gestaltet. Als dann die Kupser-
stiche nls Vorlngen dcr Rcliefvcrzierungen benutzt wurden,
entfnltcte sich dic rhcim'sche Kernmik zu hoher Blütc,
die in Köln etwa von I52O —70 andauerte, in den
nndcren Ientren dcs Rheinlnndcs, in Rnercn, in Sicg-
burg, in Grcnzbnusen und Höhr später einsetzte und
länger währte.
Der Ort, der mit Köln nm Anfnngc dcr Entwick-
lung steht und dcr eine besondere Vorliebe sür dns Moti'v
des Bartmnnnes gehnbt hnt, ist Frechen. Von hier
wurde einc ungeheure Iahl von Bnrtmnnnskrügen ins
Auslnnd exporticrt. Denn dic Gesichtsvnsen wnrcn
weit und breit beliebt. Jn Südfrankreich, namentlich
in der Nnhe von Avignon, fanden sich so viele, dnß
mnn eine Ieitlnng nnnahm, in dortigen Töpferwerk-
?5