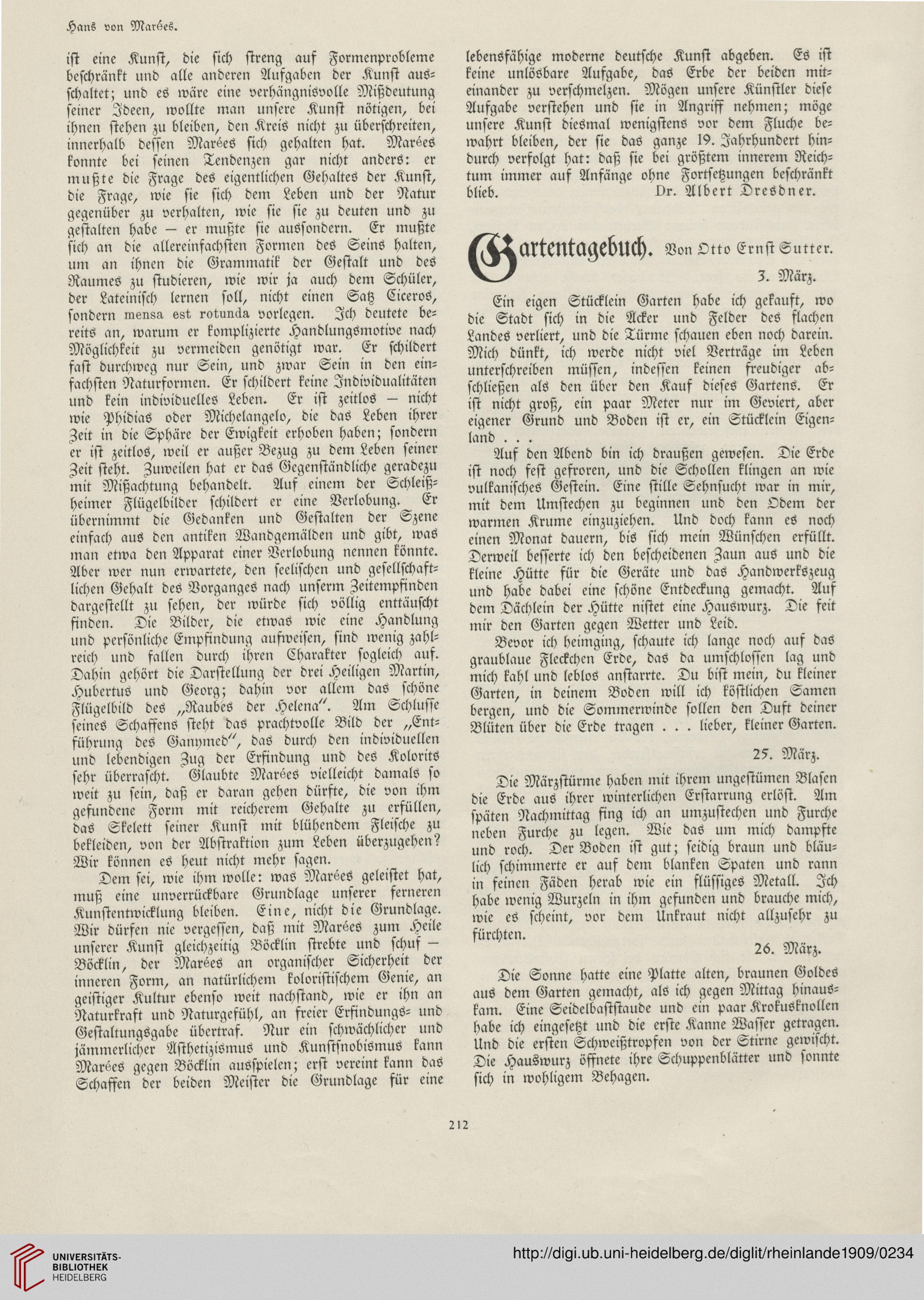Hans von Mar6es.
ift eine Kunft, die sich ftreng auf Formenprobleme
beschränkt und alle anderen Ausgaben der Kunft aus-
schaltet; und es wäre eine verhängnisvolle Mißdeutung
seiner Jdeen, wollte man unsere Kunft nötigen, bei
ihnen ftehen zu bleiben, den Kreiö nicht zu überschreiten,
innerhalb dessen Maröes sich gehalten hat. Maröes
konnte bei seinen Tendenzen gar nicht anders: er
mußte die Frage des eigentlichen Gehaltes der Kunst,
die Frage, wie sie sich dem Leben und der Natur
gegenüber zu verhalten, wie sie sie zu deuten und zu
geftalten habe — er mußte sie aussondern. Er mußte
sich an die allereinfachften Formen des SeinS halten,
um an ihnen die Grammatik der Geftalt und des
Raumes zu ftudieren, wie wir ja auch dem Schüler,
der Lateinisch lernen soll, nicht einen Satz Ciceros,
sondern laeasa 88t rotcwäa vorlegen. Jch deutete be-
reits an, warum er komplizierte Handlungsmotive nach
Möglichkeit zu vermeiden genötigt war. Er schildert
saft durchweg nur Sein, und zwar Sein in den ein-
sachsten Naturformen. Er schildert keine Jndividualitäten
und kein individuelleS Leben. Er ift zeitlos — nicht
wie Phidias oder Michelangelo, die das Leben ihrer
Zeit in die Sphäre der Ewigkeit erhoben haben; sondern
er ist zeitlos, weil er außer Bezug zu dem Leben seiner
Ieit fteht. Zuweilen hat er das Gegenständliche geradezu
mit Mißachtung behandelt. Aus einem der Schleiß-
heimer Flügelbilder schildert er eine Verlobung. Er
übernimmt die Gedanken und Geftalten der Szene
einsach aus dcn antiken Wandgemälden und gibt, was
man etwa den Apparat einer Verlobung nennen könnte.
Aber wer nun erwartete, den seelischen und gesellschaft-
lichen Gchalt deS Vorganges nach unserm Zeitempfinden
dargestellt zu sehen, der würde sich völlig enttäuscht
finden. Die Bilder, die etwas wie eine Handlung
und persönliche Empfindung aufweisen, sind wenig zahl-
reich und fallen durch ihren Charakter sogleich auf.
Dahin gehört die Darstellung der drei Heiligen Martin,
Hubertus und Georg; dahin vor allem das schöne
Flügelbild deS „Raubes der Helena". Am Schlusse
seines Schaffens fteht das prachtvolle Bild der „Ent-
führung deö Ganymed", das durch den individuellen
und lebendigen Iug der Erfindung und des Kolorits
sehr überrascht. Glaubte Maröes vielleicht damals so
weit zu sein, daß er daran gehen dürfte, die von ihm
gesundcne Form mit reicherem Gehalte zu ersüllen,
das Skelett seiner Kunst mit blühendem Fleische zu
bekleiden, von der Abstraktion zum Leben überzugehen?
Wir können es heut nicht mehr sagen.
Dem sei, wie ihm wolle: was Maröes geleistet hat,
muß eine unverrückbare Grundlage unserer ferneren
Kunstentwicklung bleiben. Eine, nicht die Grundlage.
Wir dürsen nie vergessen, daß mit Marses zum Heile
unserer Kunft gleichzeitig Böcklin ftrebte und schuf —
Böcklin, der Marses an organischer Sicherheit der
inneren Form, an natürlichem koloristischem Genie, an
geiftiger Kultur ebenso weit nachstand, wie er ihn an
Naturkraft und Naturgefühl, an freier Erfindungs- und
Gestaltungsgabe übertras. Nur ein schwächlicher und
jämmerlicher Afthetizismus und KunstsnobismuS kann
Maröes gegen Böcklin ausspielen; erst vereint kann das
Schaffen der beiden Meifter die Grundlage für eine
lebenssähige moderne deutsche Kunft abgeben. Es ift
keine unlööbare Ausgabe, das Erbe der beiden mit-
einander zu verschmelzen. Mögen unsere Künftler diese
Aufgabe verftehen und sie in Angriff nehmen; möge
unsere Kunst diesmal wenigstens vor dem Fluche be-
wahrt bleiben, der sie das ganze 19. Jahrhundert hin-
durch verfolgt hat: daß sie bei größtem innerem Reich-
tum immer auf Anfänge ohne Fortsetzungen beschränkt
blieb. Dr. Albert Dresdner.
Von Otto Ernst Suttcr.
3. März.
Ein eigen Stücklein Garten habe ich gekauft, wo
die Stadt sich in die Acker und Felder des flachen
Landes verliert, und die Türme schauen eben noch darein.
Mich dünkt, ich werde nicht viel Verträge im Leben
unterschreiben müffen, indessen keinen sreudiger ab-
schließen als den über den Kaus dieses Gartens. Er
ift nicht groß, ein paar Meter nur im Geviert, aber
eigener Grund und Boden ist er, ein Stücklein Eigen-
land . . .
Aus den Abend bin ich draußen gewesen. Die Erde
ist noch fest gefroren, und die Schollen klingen an wie
vulkanisches Geftein. Eine ftille Sehnsucht war in mir,
mit dem Umstechen zu beginnen und den Odem der
warmen Krume einzuziehen. Und doch kann es noch
einen Monat dauern, bis sich mein Wünschen erfüllt.
Derweil besserte ich den bescheidenen Iaun aus und die
kleine Hütte für die Geräte und daö Handwerkszeug
und habe dabei eine schöne Entdeckung gemacht. Aus
dem Dächlein der Hütte nistet eine Hauswurz. Die seit
mir den Garten gegen Wetter und Leid.
Bevor ich heimging, schaute ich lange noch aus das
graublaue Fleckchen Erde, das da umschloffen lag und
mich kahl und leblos anftarrte. Du bift mein, du kleiner
Garten, in deinem Boden will ich köstlichen Samen
bergen, und die Sommerwinde sollen den Duft deiner
Blüten über die Erde tragen . . . lieber, kleiner Garten.
25. März.
Die Märzftürme haben mit ihrem ungestümen Blasen
die Erde aus ihrer winterlichen Erftarrung erlöst. Am
späten Nachmittag fing ich an umzuftechen und Furche
neben Furche zu legen. Wie das um mich dampste
und roch. Der Boden ift gut; seidig braun und bläu-
lich schimmerte er aus dem blanken Spaten und rann
in feinen Fäden herab wie ein flüssiges Metall. Jch
habe wenig Wurzeln in ihm gefunden und brauche mich,
wie es scheint, vor dem Unkraut nicht allzusehr zu
fürchten.
26. März.
Die Sonne hatte eine Platte alten, braunen Goldes
aus dem Garten gemacht, als ich gegen Mittag hinaus-
kam. Eine Seidelbaststaude und ein paar Krokusknollen
habe ich eingesetzt und die erfte Kanne Waffer getragen.
Ünd die erften Schweißtropfen von der Stirne gewischt.
Die Hauswurz öffnete ihre Schuppenblätter und sonnte
sich in wohligem Behagen.
ift eine Kunft, die sich ftreng auf Formenprobleme
beschränkt und alle anderen Ausgaben der Kunft aus-
schaltet; und es wäre eine verhängnisvolle Mißdeutung
seiner Jdeen, wollte man unsere Kunft nötigen, bei
ihnen ftehen zu bleiben, den Kreiö nicht zu überschreiten,
innerhalb dessen Maröes sich gehalten hat. Maröes
konnte bei seinen Tendenzen gar nicht anders: er
mußte die Frage des eigentlichen Gehaltes der Kunst,
die Frage, wie sie sich dem Leben und der Natur
gegenüber zu verhalten, wie sie sie zu deuten und zu
geftalten habe — er mußte sie aussondern. Er mußte
sich an die allereinfachften Formen des SeinS halten,
um an ihnen die Grammatik der Geftalt und des
Raumes zu ftudieren, wie wir ja auch dem Schüler,
der Lateinisch lernen soll, nicht einen Satz Ciceros,
sondern laeasa 88t rotcwäa vorlegen. Jch deutete be-
reits an, warum er komplizierte Handlungsmotive nach
Möglichkeit zu vermeiden genötigt war. Er schildert
saft durchweg nur Sein, und zwar Sein in den ein-
sachsten Naturformen. Er schildert keine Jndividualitäten
und kein individuelleS Leben. Er ift zeitlos — nicht
wie Phidias oder Michelangelo, die das Leben ihrer
Zeit in die Sphäre der Ewigkeit erhoben haben; sondern
er ist zeitlos, weil er außer Bezug zu dem Leben seiner
Ieit fteht. Zuweilen hat er das Gegenständliche geradezu
mit Mißachtung behandelt. Aus einem der Schleiß-
heimer Flügelbilder schildert er eine Verlobung. Er
übernimmt die Gedanken und Geftalten der Szene
einsach aus dcn antiken Wandgemälden und gibt, was
man etwa den Apparat einer Verlobung nennen könnte.
Aber wer nun erwartete, den seelischen und gesellschaft-
lichen Gchalt deS Vorganges nach unserm Zeitempfinden
dargestellt zu sehen, der würde sich völlig enttäuscht
finden. Die Bilder, die etwas wie eine Handlung
und persönliche Empfindung aufweisen, sind wenig zahl-
reich und fallen durch ihren Charakter sogleich auf.
Dahin gehört die Darstellung der drei Heiligen Martin,
Hubertus und Georg; dahin vor allem das schöne
Flügelbild deS „Raubes der Helena". Am Schlusse
seines Schaffens fteht das prachtvolle Bild der „Ent-
führung deö Ganymed", das durch den individuellen
und lebendigen Iug der Erfindung und des Kolorits
sehr überrascht. Glaubte Maröes vielleicht damals so
weit zu sein, daß er daran gehen dürfte, die von ihm
gesundcne Form mit reicherem Gehalte zu ersüllen,
das Skelett seiner Kunst mit blühendem Fleische zu
bekleiden, von der Abstraktion zum Leben überzugehen?
Wir können es heut nicht mehr sagen.
Dem sei, wie ihm wolle: was Maröes geleistet hat,
muß eine unverrückbare Grundlage unserer ferneren
Kunstentwicklung bleiben. Eine, nicht die Grundlage.
Wir dürsen nie vergessen, daß mit Marses zum Heile
unserer Kunft gleichzeitig Böcklin ftrebte und schuf —
Böcklin, der Marses an organischer Sicherheit der
inneren Form, an natürlichem koloristischem Genie, an
geiftiger Kultur ebenso weit nachstand, wie er ihn an
Naturkraft und Naturgefühl, an freier Erfindungs- und
Gestaltungsgabe übertras. Nur ein schwächlicher und
jämmerlicher Afthetizismus und KunstsnobismuS kann
Maröes gegen Böcklin ausspielen; erst vereint kann das
Schaffen der beiden Meifter die Grundlage für eine
lebenssähige moderne deutsche Kunft abgeben. Es ift
keine unlööbare Ausgabe, das Erbe der beiden mit-
einander zu verschmelzen. Mögen unsere Künftler diese
Aufgabe verftehen und sie in Angriff nehmen; möge
unsere Kunst diesmal wenigstens vor dem Fluche be-
wahrt bleiben, der sie das ganze 19. Jahrhundert hin-
durch verfolgt hat: daß sie bei größtem innerem Reich-
tum immer auf Anfänge ohne Fortsetzungen beschränkt
blieb. Dr. Albert Dresdner.
Von Otto Ernst Suttcr.
3. März.
Ein eigen Stücklein Garten habe ich gekauft, wo
die Stadt sich in die Acker und Felder des flachen
Landes verliert, und die Türme schauen eben noch darein.
Mich dünkt, ich werde nicht viel Verträge im Leben
unterschreiben müffen, indessen keinen sreudiger ab-
schließen als den über den Kaus dieses Gartens. Er
ift nicht groß, ein paar Meter nur im Geviert, aber
eigener Grund und Boden ist er, ein Stücklein Eigen-
land . . .
Aus den Abend bin ich draußen gewesen. Die Erde
ist noch fest gefroren, und die Schollen klingen an wie
vulkanisches Geftein. Eine ftille Sehnsucht war in mir,
mit dem Umstechen zu beginnen und den Odem der
warmen Krume einzuziehen. Und doch kann es noch
einen Monat dauern, bis sich mein Wünschen erfüllt.
Derweil besserte ich den bescheidenen Iaun aus und die
kleine Hütte für die Geräte und daö Handwerkszeug
und habe dabei eine schöne Entdeckung gemacht. Aus
dem Dächlein der Hütte nistet eine Hauswurz. Die seit
mir den Garten gegen Wetter und Leid.
Bevor ich heimging, schaute ich lange noch aus das
graublaue Fleckchen Erde, das da umschloffen lag und
mich kahl und leblos anftarrte. Du bift mein, du kleiner
Garten, in deinem Boden will ich köstlichen Samen
bergen, und die Sommerwinde sollen den Duft deiner
Blüten über die Erde tragen . . . lieber, kleiner Garten.
25. März.
Die Märzftürme haben mit ihrem ungestümen Blasen
die Erde aus ihrer winterlichen Erftarrung erlöst. Am
späten Nachmittag fing ich an umzuftechen und Furche
neben Furche zu legen. Wie das um mich dampste
und roch. Der Boden ift gut; seidig braun und bläu-
lich schimmerte er aus dem blanken Spaten und rann
in feinen Fäden herab wie ein flüssiges Metall. Jch
habe wenig Wurzeln in ihm gefunden und brauche mich,
wie es scheint, vor dem Unkraut nicht allzusehr zu
fürchten.
26. März.
Die Sonne hatte eine Platte alten, braunen Goldes
aus dem Garten gemacht, als ich gegen Mittag hinaus-
kam. Eine Seidelbaststaude und ein paar Krokusknollen
habe ich eingesetzt und die erfte Kanne Waffer getragen.
Ünd die erften Schweißtropfen von der Stirne gewischt.
Die Hauswurz öffnete ihre Schuppenblätter und sonnte
sich in wohligem Behagen.