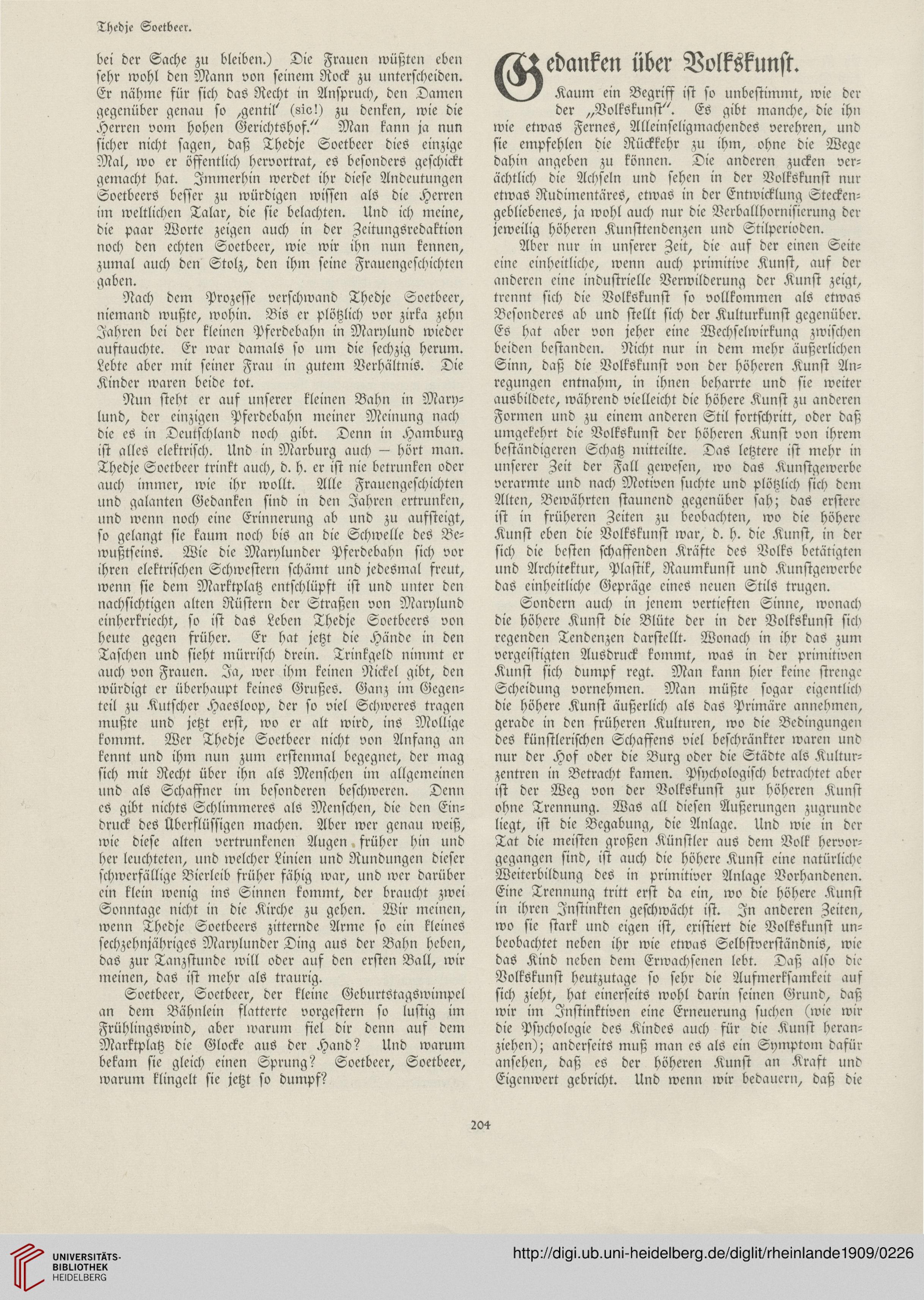Thedje Soetbeer.
bei der Sache zu bleiben.) Die Frauen wüßten eben
sehr wohl den Mann von seinem Rock zu unterscheiden.
Er nähme für sich daö Recht in Anspruch, den Damcn
gegenüber genau so ,gentih (sio!) zu denken, wie die
Herren vom hohen Gerichtshof." Man kann ja nun
sicher nicht sagen, daß Thedje Soetbeer dicö einzige
Mal, wo er öffentlich hervortrat, es besonders geschickt
gemacht hat. Immerhin werdet ihr diese Andeutungen
Soetbeers beffer zu würdigen wissen als die Herren
im weltlichen Talar, die sie belachten. Und ich meine,
die paar Worte zeigen auch in der Zeitungsredaktion
noch den echten Soetbeer, wie wir ihn nun kennen,
zumal auch den Stolz, den ihm seine Frauengeschichten
gaben.
Nach dem Prozesse verschwand Thedje Soetbeer,
niemand wußte, wohin. Bis er plötzlich vor zirka zehn
Iahren bei der kleincn Pferdebahn in Marylund wiedcr
auftauchte. Er war damalö so um die sechzig herum.
Lebte aber mit seiner Frau in gutem Verhältnis. Die
Kinder waren beide tot.
Nun fteht er aus unserer kleinen Bahn in Mary-
lund, der einzigen Pferdebahn meiner Meinung nach
die es in Deutschland noch gibt. Denn in Hamburg
ist alles elektrisch. Und in Marburg auch - hört man.
Thedje Soetbeer trinkt auch, d. h. er ift nie bctrunken oder
auch immer, wie ihr wollt. Alle Frauengeschichten
und galanten Gedanken sind in den Zahren ertrunken,
und wenn noch eine Erinnerung ab und zu auffteigt,
so gelangt sie kaum noch bis an die Schwelle des Be-
wußtseins. Wie die Marylunder Pferdebahn sich vor
ihren elektrischen Schwestern schämt und jedesmal freut,
wenn sie dem Marktplatz entschlüpft ist und unter dcn
nachsichtlgen alten Rüstern dcr Straßen von Marylund
einherkriecht, so ist das Leben Thedje Soetbcerö von
heute gegen früher. Er hat jetzt die Hände in den
Taschen und sieht mürrisch drein. Trinkgeld nimmt er
auch von Frauen. Za, wer ihm keinen Nickel gibt, den
würdigt er überhaupt keines Grußeö. Ganz im Gegen-
tcil zu Kutscher Haesloop, der so viel Schweres tragen
mußte und jetzt erst, wo er alt wird, ins Mollige
kommt. Wer Thedje Soetbeer nicht von Ansang an
kennt und ihm nun zum erstenmal begegnet, der mag
sich mit Recht über ihn als Menschen im allgcmeinen
und alö Schaffncr im besonderen beschwcren. Denn
cs gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die den Ein-
druck des Überflüssigen machen. Aber wer genau weiß,
wie diese alten vertrunkenen Augen früher hin und
her leuchteten, und welcher Linien und Rundungen dieser
schwerfällige Bierlcib früher fähig war, und wer darüber
ein klein wenig ins Sinnen kommt, der braucht zwei
Sonntage nicht in die Kirche zu gehen. Wir meinen,
wenn Thedje Soetbeerö zitternde Arme so ein kleines
sechzehnjäbrigeö Marylunder Ding aus der Bahn heben,
daö zur Tanzstunde will oder auf dcn crsten Ball, wir
meinen, das ist mehr als traurig.
Soetbeer, Soetbeer, der kleine Geburtötagswimpel
an dem Bähnlein flatterte vorgestern so lustig im
Frühlingswind, aber warum fiel dir denn auf dem
Marktplatz die Glocke aus der Hand? Und warum
bekam sie gleich einen Sprung? Soetbeer, Soetbeer,
warum klingclt sie jetzt so dumpf?
edanken über Volkskunst.
Kaum ein Begriff ist so unbestimmt, wie der
der „Volkskunst". Es gibt manche, die ihn
wie etwas Fernes, Alleinseligmachendes verehren, und
sie empfehlen die Rückkehr zu ihm, ohne die Wege
dahin angeben zu können. Die anderen zucken ver-
ächtlich die Achseln und sehen in der Volkskunst nur
etwas Rudimentäreö, etwas in der Entwicklung Stecken-
gebliebenes, ja wohl auch nur die Verballhornisierung der
jeweilig höheren Kunsttendenzen und Stilperioden.
Aber nur in unserer Zeit, die auf der einen Seite
eine einheitliche, wenn auch primitive Kunft, auf der
anderen eine industrielle Verwilderung der Kunft zeigt,
trennt sich die Volkskunft so vollkommen als etwas
Besonderes ab und ftellt sich der Kulturkunst gegenüber.
Es hat aber von jeher eine Wechselwirkung zwischen
beiden bestanden. Nicht nur in dem mehr äußerlichen
Sinn, daß die Volkskunst von der höheren Kunst An-
regungen entnahm, in ihnen beharrte und sie weiter
ausbildete, während vielleicht die höhere Kunft zu anderen
Formen und zu einem anderen Stil fortschritt, oder daß
umgekehrt die Volkskunst der höheren Kunst von ihrem
beständigeren Schatz nn'tteilte. Das letztere ist mehr in
unserer Zeit der Fall gewesen, wo das Kunftgewerbe
verarmte und nach Motiven suchte und plötzlich sich dem
Alten, Bewährten staunend gegenüber sah; das ersterc
ist in früheren Zeiten zu beobachten, wo die höhere
Kunst eben die Volkskunst war, d. h. die Kunst, in der
sich die besten schaffenden Kräfte des Volks betätigten
und Architektur, Plastik, Raumkunst und Kunftgewerbe
das einheitliche Gepräge eineö neuen Stils trugen.
Sondern auch in jenem vertieften Sinne, wonach
die höhere Kunst die Blüte der in der Volkökunst sich
regenden Tendenzen darstellt- Wonach in ihr das zum
vergeistigten Ausdruck kommt, was in der primitiven
Kunst sich dumpf regt. Man kann hier keine strenge
Scheidung vornehmen. Man müßte sogar eigentlich
die höhere Kunst äußerlich als daö Primäre annehmen,
gerade in den früheren Kulturen, wo die Bedingungen
deö künstlerischen Schaffens viel beschränkter warcn und
nur der Hof oder die Burg oder die Städte als Kultur-
zentren in Betracht kamen. Psychologisch betrachtet aber
ist der Weg von der Volkskunst zur höheren Kunst
ohne Trennung. Was all diesen Außerungen zugrunde
liegt, ist die Begabung, die Anlage. Und wie in dcr
Tat die meisten großen Künstler aus dem Volk hervor-
gegangen sind, ist auch die höhere Kunft eine natürliche
Weiterbildung des in primitiver Anlage Vorhandenen.
Eine Trennung tritt erft da ein, wo die höhere Kunst
in ihren Instinkten geschwächt ist. Zn anderen Ieiten,
wo sie ftark und eigen ist, existiert die Volkskunst un-
beobachtet neben ihr wie etwus Selbstverftändnis, wie
daö Kind neben dem Erwachsenen lebt. Daß also dic
Volkskunft heutzutage so sehr die Aufmerksamkeit auf
sich zieht, hat einerseitö wohl darin seinen Grund, daß
wir im Jnstinktiven eine Erneuerung suchen (wie wir
die Psychologie deö Kindes auch für die Kunst heran-
ziehen); anderseits muß man es als ein Symptom dafür
ansehen, daß es der höheren Kunft an Kraft und
Eigenwert gebricht. Und wenn wir bedauern, daß die
ro4
bei der Sache zu bleiben.) Die Frauen wüßten eben
sehr wohl den Mann von seinem Rock zu unterscheiden.
Er nähme für sich daö Recht in Anspruch, den Damcn
gegenüber genau so ,gentih (sio!) zu denken, wie die
Herren vom hohen Gerichtshof." Man kann ja nun
sicher nicht sagen, daß Thedje Soetbeer dicö einzige
Mal, wo er öffentlich hervortrat, es besonders geschickt
gemacht hat. Immerhin werdet ihr diese Andeutungen
Soetbeers beffer zu würdigen wissen als die Herren
im weltlichen Talar, die sie belachten. Und ich meine,
die paar Worte zeigen auch in der Zeitungsredaktion
noch den echten Soetbeer, wie wir ihn nun kennen,
zumal auch den Stolz, den ihm seine Frauengeschichten
gaben.
Nach dem Prozesse verschwand Thedje Soetbeer,
niemand wußte, wohin. Bis er plötzlich vor zirka zehn
Iahren bei der kleincn Pferdebahn in Marylund wiedcr
auftauchte. Er war damalö so um die sechzig herum.
Lebte aber mit seiner Frau in gutem Verhältnis. Die
Kinder waren beide tot.
Nun fteht er aus unserer kleinen Bahn in Mary-
lund, der einzigen Pferdebahn meiner Meinung nach
die es in Deutschland noch gibt. Denn in Hamburg
ist alles elektrisch. Und in Marburg auch - hört man.
Thedje Soetbeer trinkt auch, d. h. er ift nie bctrunken oder
auch immer, wie ihr wollt. Alle Frauengeschichten
und galanten Gedanken sind in den Zahren ertrunken,
und wenn noch eine Erinnerung ab und zu auffteigt,
so gelangt sie kaum noch bis an die Schwelle des Be-
wußtseins. Wie die Marylunder Pferdebahn sich vor
ihren elektrischen Schwestern schämt und jedesmal freut,
wenn sie dem Marktplatz entschlüpft ist und unter dcn
nachsichtlgen alten Rüstern dcr Straßen von Marylund
einherkriecht, so ist das Leben Thedje Soetbcerö von
heute gegen früher. Er hat jetzt die Hände in den
Taschen und sieht mürrisch drein. Trinkgeld nimmt er
auch von Frauen. Za, wer ihm keinen Nickel gibt, den
würdigt er überhaupt keines Grußeö. Ganz im Gegen-
tcil zu Kutscher Haesloop, der so viel Schweres tragen
mußte und jetzt erst, wo er alt wird, ins Mollige
kommt. Wer Thedje Soetbeer nicht von Ansang an
kennt und ihm nun zum erstenmal begegnet, der mag
sich mit Recht über ihn als Menschen im allgcmeinen
und alö Schaffncr im besonderen beschwcren. Denn
cs gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die den Ein-
druck des Überflüssigen machen. Aber wer genau weiß,
wie diese alten vertrunkenen Augen früher hin und
her leuchteten, und welcher Linien und Rundungen dieser
schwerfällige Bierlcib früher fähig war, und wer darüber
ein klein wenig ins Sinnen kommt, der braucht zwei
Sonntage nicht in die Kirche zu gehen. Wir meinen,
wenn Thedje Soetbeerö zitternde Arme so ein kleines
sechzehnjäbrigeö Marylunder Ding aus der Bahn heben,
daö zur Tanzstunde will oder auf dcn crsten Ball, wir
meinen, das ist mehr als traurig.
Soetbeer, Soetbeer, der kleine Geburtötagswimpel
an dem Bähnlein flatterte vorgestern so lustig im
Frühlingswind, aber warum fiel dir denn auf dem
Marktplatz die Glocke aus der Hand? Und warum
bekam sie gleich einen Sprung? Soetbeer, Soetbeer,
warum klingclt sie jetzt so dumpf?
edanken über Volkskunst.
Kaum ein Begriff ist so unbestimmt, wie der
der „Volkskunst". Es gibt manche, die ihn
wie etwas Fernes, Alleinseligmachendes verehren, und
sie empfehlen die Rückkehr zu ihm, ohne die Wege
dahin angeben zu können. Die anderen zucken ver-
ächtlich die Achseln und sehen in der Volkskunst nur
etwas Rudimentäreö, etwas in der Entwicklung Stecken-
gebliebenes, ja wohl auch nur die Verballhornisierung der
jeweilig höheren Kunsttendenzen und Stilperioden.
Aber nur in unserer Zeit, die auf der einen Seite
eine einheitliche, wenn auch primitive Kunft, auf der
anderen eine industrielle Verwilderung der Kunft zeigt,
trennt sich die Volkskunft so vollkommen als etwas
Besonderes ab und ftellt sich der Kulturkunst gegenüber.
Es hat aber von jeher eine Wechselwirkung zwischen
beiden bestanden. Nicht nur in dem mehr äußerlichen
Sinn, daß die Volkskunst von der höheren Kunst An-
regungen entnahm, in ihnen beharrte und sie weiter
ausbildete, während vielleicht die höhere Kunft zu anderen
Formen und zu einem anderen Stil fortschritt, oder daß
umgekehrt die Volkskunst der höheren Kunst von ihrem
beständigeren Schatz nn'tteilte. Das letztere ist mehr in
unserer Zeit der Fall gewesen, wo das Kunftgewerbe
verarmte und nach Motiven suchte und plötzlich sich dem
Alten, Bewährten staunend gegenüber sah; das ersterc
ist in früheren Zeiten zu beobachten, wo die höhere
Kunst eben die Volkskunst war, d. h. die Kunst, in der
sich die besten schaffenden Kräfte des Volks betätigten
und Architektur, Plastik, Raumkunst und Kunftgewerbe
das einheitliche Gepräge eineö neuen Stils trugen.
Sondern auch in jenem vertieften Sinne, wonach
die höhere Kunst die Blüte der in der Volkökunst sich
regenden Tendenzen darstellt- Wonach in ihr das zum
vergeistigten Ausdruck kommt, was in der primitiven
Kunst sich dumpf regt. Man kann hier keine strenge
Scheidung vornehmen. Man müßte sogar eigentlich
die höhere Kunst äußerlich als daö Primäre annehmen,
gerade in den früheren Kulturen, wo die Bedingungen
deö künstlerischen Schaffens viel beschränkter warcn und
nur der Hof oder die Burg oder die Städte als Kultur-
zentren in Betracht kamen. Psychologisch betrachtet aber
ist der Weg von der Volkskunst zur höheren Kunst
ohne Trennung. Was all diesen Außerungen zugrunde
liegt, ist die Begabung, die Anlage. Und wie in dcr
Tat die meisten großen Künstler aus dem Volk hervor-
gegangen sind, ist auch die höhere Kunft eine natürliche
Weiterbildung des in primitiver Anlage Vorhandenen.
Eine Trennung tritt erft da ein, wo die höhere Kunst
in ihren Instinkten geschwächt ist. Zn anderen Ieiten,
wo sie ftark und eigen ist, existiert die Volkskunst un-
beobachtet neben ihr wie etwus Selbstverftändnis, wie
daö Kind neben dem Erwachsenen lebt. Daß also dic
Volkskunft heutzutage so sehr die Aufmerksamkeit auf
sich zieht, hat einerseitö wohl darin seinen Grund, daß
wir im Jnstinktiven eine Erneuerung suchen (wie wir
die Psychologie deö Kindes auch für die Kunst heran-
ziehen); anderseits muß man es als ein Symptom dafür
ansehen, daß es der höheren Kunft an Kraft und
Eigenwert gebricht. Und wenn wir bedauern, daß die
ro4