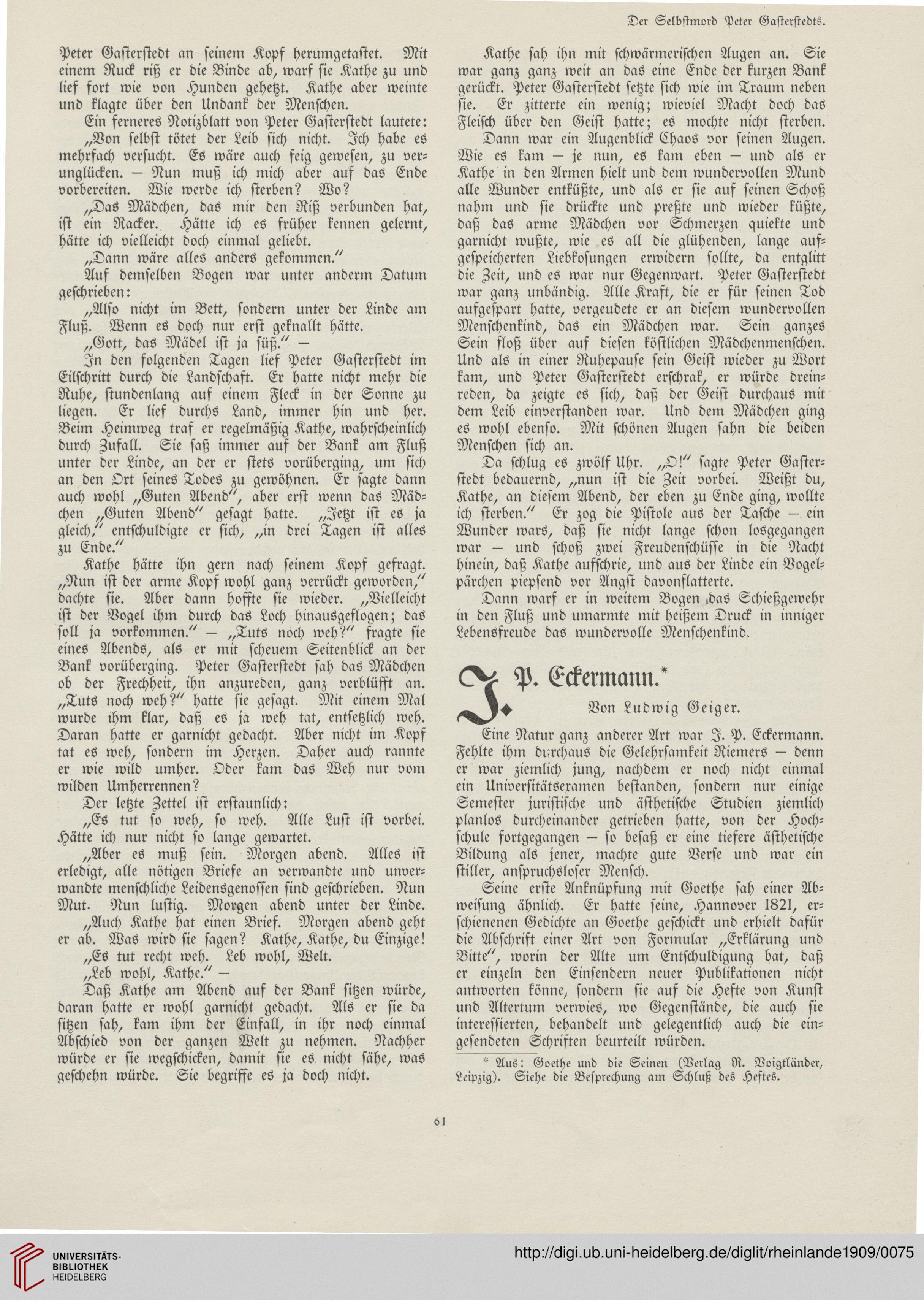Der Selbstmord Petcr Gastcrstedtß.
Peter Gafterstedt an seinem Kopf herumgetastet. Mit
einem Ruck riß er die Binde ab, warf sie Kathe zu und
lief fort wie von Hunden gehetzt. Kathe aber weinte
und klagte über den Undank der Menschen.
Ein ferneres Notizblatt von Peter Gafterstedt lautete:
„Von selbst tötet der Leib sich nicht. Jch habe es
mehrfach versucht. Es wäre auch feig gewcsen, zu ver-
unglücken. — Nun muß ich mich aber auf das Ende
vorbereiten. Wie werde ich sterben? Wo?
,^T>as Mädchen, daS mir den Riß verbunden hat,
ist ein Racker. Hätte ich es früher kenncn gelernt,
hätte ich vielleicht doch einmal geliebt.
„Dann wäre alles anders gekommen."
Auf demselben Bogen war unter anderm Datum
geschrieben:
„Also nicht im Bett, sondern unter der Linde am
Fluß. Wenn es doch nur erft geknallt hätte.
„Gott, das Mädel ist ja süß." —
Jn den folgenden Tagen lief Peter Gasterstedt im
Eilschritt durch die Landschaft. Er hatte nicht mehr die
Ruhe, ftundenlang auf einem Fleck in der Sonne zu
liegen. Er lief durchs Land, immer hin und her.
Beim Heimweg traf er regelmäßig Kathe, wahrscheinlich
durch Zufall. Sie saß immer auf der Bank am Fluß
unter der Linde, an der er stets vorüberging, um sich
an den Ort seineö Todes zu gewöhnen. Er sagte dann
auch wohl „Guten Abend", aber erst wenn daS Mäd-
chen „Guten Abend" gesagt hatte. „Zetzt ist eS ja
gleich," entschuldigte er sich, „in drei Tagen ift alleS
zu Ende."
Kathe hätte ihn gern nach seinem Kopf gefragt.
„Nun ift der arme Kopf wohl ganz verrückt gewordcn,"
dachte sie. Aber dann hoffte sie wieder. „Vielleicht
ift der Vogel ihm durch das Loch hinausgeflogen; daö
soll ja vorkommen." — „Tuts noch weh?" fragte sie
eineö Abends, als er mit schenem Seitenblick an der
Bank vorüberging. Peter Gasterstedt sah das Mädchen
ob der Frechheit, ihn anzuredcn, ganz vcrblüfft an.
„Tuts noch weh?" hatte sie gesagt. Mit einem Mal
wurde ihm klar, daß eS ja weh tat, entsetzlich weh.
Daran hatte er garnicht gedacht. Aber nicht im Kopf
tat es wch, sondern im Herzen. Daher auch rannte
er wie wild umher. Oder kam daö Weh nur vom
wilden Umherrennen?
Der letzte Iettel ift erftaunlich:
„Es tut so weh, so weh. Alle Luft ist vorbei.
Hätte ich nur nicht so lange gewartet.
„Aber es muß sein. Morgen abend. AlleS ift
erledigt, alle nötigen Briefe an verwandte und unver-
wandte menschliche Leidensgenossen sind geschrieben. Nun
Mut. Nun lustig. Morgen abend unter der Linde.
„Auch Kathe hat einen Brief. Morgen abend geht
er ab. Waö wird sie sagen? Kathe, Kathe, du Einzige!
„Es tut recht weh. Leb wohl, Welt.
„Leb wohl, Kathe." —
Daß Kathe am Abend auf der Bank sitzen würde,
daran hatte er wohl garnicht gedacht. Als er sie da
sitzen sah, kam ihm der Einfall, in ihr noch einmal
Abschied von der ganzen Welt zu nehmen. Nachher
würde er sie wegschicken, damit sie eS nicht sähe, was
geschehn würde. Sie begriffe es ja doch nicht.
Kathe sah ihn mit schwärmerischen Augen an. Sie
war ganz ganz weit an das eine Ende der kurzen Bank
gerückt. Peter Gasterstedt setzte sich wie im Traum neben
sie. Er zitterte ein wenig; wieviel Macht doch das
Fleisch über den Geift hatte; es mochte nicht sterben.
Dann war ein Augenblick Chaos vor seinen Augen.
Wie es kam — je nun, es kam eben — und alö er
Kathe in den Armen hielt und dem wundervollen Mund
alle Wunder entküßte, und als er sie auf seinen Schoß
nahm und sie drückte und preßte und wieder küßte,
daß das arme Mädchen vor Schmerzen quiekte und
garnicht wußte, wie es all die glühenden, lange auf-
gespeicherten Liebkosungcn erwidern sollte, da entglitt
die Zeit, und es war nur Gegenwart. Peter Gasterstedt
war ganz unbändig. Alle Kraft, die er für seinen Tod
aufgespart hatte, vergeudete er an diesem wundervollen
Menschenkind, das ein Mädchen war. Sein ganzeö
Sein floß übcr auf dicsen köstlichen Mädchcnmenschen.
Und als in einer Ruhepause sein Geist wieder zu Wort
kam, und Peter Gafterftedt erschrak, er würde drein-
reden, da zeigte es sich, daß der Geist durchaus mit
dem Leib einvcrstanden war. Und dem Mädchen ging
es wohl ebenso. Mit schönen Augen sahn die beiden
Menschen sich an.
Da schlug es zwölf Uhr. „O!" sagte Peter Gaster-
stedt bedanernd, „nun ift die Icit vorbei. Weißt du,
Kathe, an diesem Abend, der eben zu Ende ging, wollte
ich sterben." Er zog die Pistole aus der Tasche — ein
Wunder wars, daß sie nicht lange schon losgegangen
war — und schoß zwei Freudenschüsse in die Nacht
hinein, daß Kathe aufschrie, und aus der Linde ein Vogcl-
pärchen piepsend vor Angst davonflatterte.
Dann wars er in weitem Bogen «das Schießgewehr
in den Fluß und umarmte mit heißem Druck in inniger
Lebensfreude das wundervolle Menschenkind.
P. Eckermann?
Von Ludwig Gciger.
Eine Natur ganz anderer Art war I. P. Eckermann.
Fehlte ihm durchaus die Gelehrsamkeit Riemers — denn
cr war ziemlich jung, nachdem er noch nicht einmal
ein Universitätsexamen bestanden, sondern nur einige
Semefter juristische und ästhctische Studien ziemlich
planlos durcheinander getrieben hatte, von der Hoch-
schule fortgegangen — so bcsaß er eine tiefere ästhetische
Bildung als jener, machte gute Verse und war ein
ftiller, anspruchöloser Mensch.
Seine erste Anknüpfung mit Goethe sah einer Ab-
weisung ähnlich. Er hatte seine, Hannover 1821, er-
schienenen Gedichte an Goethe geschickt und erhielt dafür
die Abschrist einer Art von Formular „Erklärung und
Bitte", worin der Alte um Entschuldigung bat, daß
er einzeln den Einsendern neuer Publikationen nicht
antworten könne, sondern sic auf die Hefte von Kunst
und Altertum verwies, wo Gegenstände, die auch sie
interessierten, behandelt und gelegentlich auch die ein-
gesendeten Schriften beurteilt würden.
* Aus: Goethe und die Seinen (Verlag R. Doigtländer,
Leipzig). Siehe die Besprechung am Schluß des Hestes.
Peter Gafterstedt an seinem Kopf herumgetastet. Mit
einem Ruck riß er die Binde ab, warf sie Kathe zu und
lief fort wie von Hunden gehetzt. Kathe aber weinte
und klagte über den Undank der Menschen.
Ein ferneres Notizblatt von Peter Gafterstedt lautete:
„Von selbst tötet der Leib sich nicht. Jch habe es
mehrfach versucht. Es wäre auch feig gewcsen, zu ver-
unglücken. — Nun muß ich mich aber auf das Ende
vorbereiten. Wie werde ich sterben? Wo?
,^T>as Mädchen, daS mir den Riß verbunden hat,
ist ein Racker. Hätte ich es früher kenncn gelernt,
hätte ich vielleicht doch einmal geliebt.
„Dann wäre alles anders gekommen."
Auf demselben Bogen war unter anderm Datum
geschrieben:
„Also nicht im Bett, sondern unter der Linde am
Fluß. Wenn es doch nur erft geknallt hätte.
„Gott, das Mädel ist ja süß." —
Jn den folgenden Tagen lief Peter Gasterstedt im
Eilschritt durch die Landschaft. Er hatte nicht mehr die
Ruhe, ftundenlang auf einem Fleck in der Sonne zu
liegen. Er lief durchs Land, immer hin und her.
Beim Heimweg traf er regelmäßig Kathe, wahrscheinlich
durch Zufall. Sie saß immer auf der Bank am Fluß
unter der Linde, an der er stets vorüberging, um sich
an den Ort seineö Todes zu gewöhnen. Er sagte dann
auch wohl „Guten Abend", aber erst wenn daS Mäd-
chen „Guten Abend" gesagt hatte. „Zetzt ist eS ja
gleich," entschuldigte er sich, „in drei Tagen ift alleS
zu Ende."
Kathe hätte ihn gern nach seinem Kopf gefragt.
„Nun ift der arme Kopf wohl ganz verrückt gewordcn,"
dachte sie. Aber dann hoffte sie wieder. „Vielleicht
ift der Vogel ihm durch das Loch hinausgeflogen; daö
soll ja vorkommen." — „Tuts noch weh?" fragte sie
eineö Abends, als er mit schenem Seitenblick an der
Bank vorüberging. Peter Gasterstedt sah das Mädchen
ob der Frechheit, ihn anzuredcn, ganz vcrblüfft an.
„Tuts noch weh?" hatte sie gesagt. Mit einem Mal
wurde ihm klar, daß eS ja weh tat, entsetzlich weh.
Daran hatte er garnicht gedacht. Aber nicht im Kopf
tat es wch, sondern im Herzen. Daher auch rannte
er wie wild umher. Oder kam daö Weh nur vom
wilden Umherrennen?
Der letzte Iettel ift erftaunlich:
„Es tut so weh, so weh. Alle Luft ist vorbei.
Hätte ich nur nicht so lange gewartet.
„Aber es muß sein. Morgen abend. AlleS ift
erledigt, alle nötigen Briefe an verwandte und unver-
wandte menschliche Leidensgenossen sind geschrieben. Nun
Mut. Nun lustig. Morgen abend unter der Linde.
„Auch Kathe hat einen Brief. Morgen abend geht
er ab. Waö wird sie sagen? Kathe, Kathe, du Einzige!
„Es tut recht weh. Leb wohl, Welt.
„Leb wohl, Kathe." —
Daß Kathe am Abend auf der Bank sitzen würde,
daran hatte er wohl garnicht gedacht. Als er sie da
sitzen sah, kam ihm der Einfall, in ihr noch einmal
Abschied von der ganzen Welt zu nehmen. Nachher
würde er sie wegschicken, damit sie eS nicht sähe, was
geschehn würde. Sie begriffe es ja doch nicht.
Kathe sah ihn mit schwärmerischen Augen an. Sie
war ganz ganz weit an das eine Ende der kurzen Bank
gerückt. Peter Gasterstedt setzte sich wie im Traum neben
sie. Er zitterte ein wenig; wieviel Macht doch das
Fleisch über den Geift hatte; es mochte nicht sterben.
Dann war ein Augenblick Chaos vor seinen Augen.
Wie es kam — je nun, es kam eben — und alö er
Kathe in den Armen hielt und dem wundervollen Mund
alle Wunder entküßte, und als er sie auf seinen Schoß
nahm und sie drückte und preßte und wieder küßte,
daß das arme Mädchen vor Schmerzen quiekte und
garnicht wußte, wie es all die glühenden, lange auf-
gespeicherten Liebkosungcn erwidern sollte, da entglitt
die Zeit, und es war nur Gegenwart. Peter Gasterstedt
war ganz unbändig. Alle Kraft, die er für seinen Tod
aufgespart hatte, vergeudete er an diesem wundervollen
Menschenkind, das ein Mädchen war. Sein ganzeö
Sein floß übcr auf dicsen köstlichen Mädchcnmenschen.
Und als in einer Ruhepause sein Geist wieder zu Wort
kam, und Peter Gafterftedt erschrak, er würde drein-
reden, da zeigte es sich, daß der Geist durchaus mit
dem Leib einvcrstanden war. Und dem Mädchen ging
es wohl ebenso. Mit schönen Augen sahn die beiden
Menschen sich an.
Da schlug es zwölf Uhr. „O!" sagte Peter Gaster-
stedt bedanernd, „nun ift die Icit vorbei. Weißt du,
Kathe, an diesem Abend, der eben zu Ende ging, wollte
ich sterben." Er zog die Pistole aus der Tasche — ein
Wunder wars, daß sie nicht lange schon losgegangen
war — und schoß zwei Freudenschüsse in die Nacht
hinein, daß Kathe aufschrie, und aus der Linde ein Vogcl-
pärchen piepsend vor Angst davonflatterte.
Dann wars er in weitem Bogen «das Schießgewehr
in den Fluß und umarmte mit heißem Druck in inniger
Lebensfreude das wundervolle Menschenkind.
P. Eckermann?
Von Ludwig Gciger.
Eine Natur ganz anderer Art war I. P. Eckermann.
Fehlte ihm durchaus die Gelehrsamkeit Riemers — denn
cr war ziemlich jung, nachdem er noch nicht einmal
ein Universitätsexamen bestanden, sondern nur einige
Semefter juristische und ästhctische Studien ziemlich
planlos durcheinander getrieben hatte, von der Hoch-
schule fortgegangen — so bcsaß er eine tiefere ästhetische
Bildung als jener, machte gute Verse und war ein
ftiller, anspruchöloser Mensch.
Seine erste Anknüpfung mit Goethe sah einer Ab-
weisung ähnlich. Er hatte seine, Hannover 1821, er-
schienenen Gedichte an Goethe geschickt und erhielt dafür
die Abschrist einer Art von Formular „Erklärung und
Bitte", worin der Alte um Entschuldigung bat, daß
er einzeln den Einsendern neuer Publikationen nicht
antworten könne, sondern sic auf die Hefte von Kunst
und Altertum verwies, wo Gegenstände, die auch sie
interessierten, behandelt und gelegentlich auch die ein-
gesendeten Schriften beurteilt würden.
* Aus: Goethe und die Seinen (Verlag R. Doigtländer,
Leipzig). Siehe die Besprechung am Schluß des Hestes.