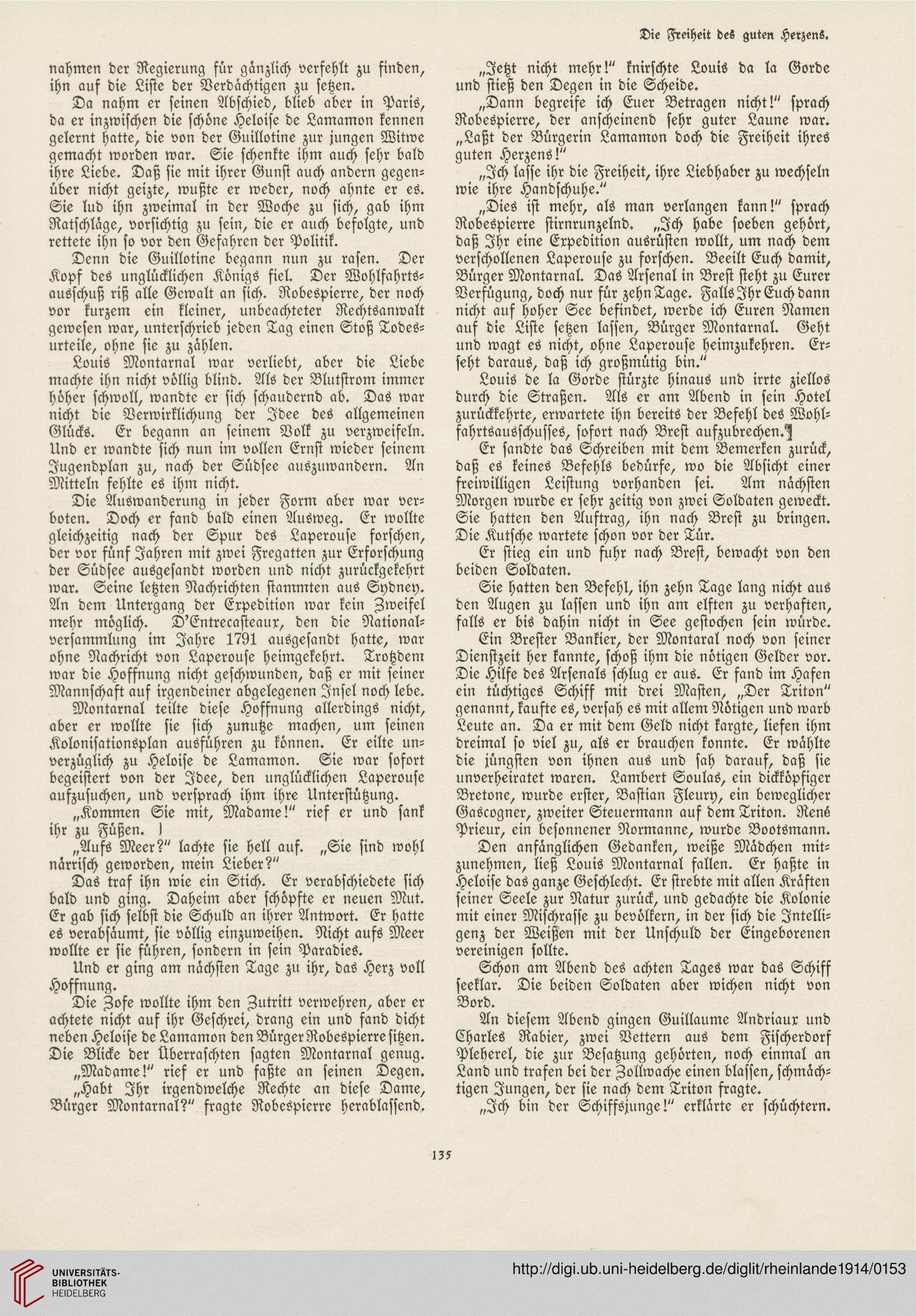Die Freiheit des guten HerzenS.
nahmen der Regierung für gänzlich verfehlt zu finden,
ihn auf die Liste der Verdachtigen zu setzen.
Da nahm er seinen Abschied, blieb aber in Paris,
da er inzwischen die schöne Heloise de Lamamon kennen
gelernt hatte, die von der Guillotine zur jungen Witwe
gemacht worden war. Sie schenkte ihm auch sehr bald
ihre Liebe. Daß sie mit ihrer Gunst auch andern gegen-
über nicht geizte, wußte er weder, noch ahnte er es.
Sie lud ihn zweimal in der Woche zu sich, gab ihm
Ratschlage, vorsichtig zu sein, die er auch befolgte, und
rettete ihn so vor den Gefahren der Politik.
Denn die Guillotine begann nun zu rasen. Der
Kopf des unglücklichen Königs fiel. Der Wohlfahrts-
ausschuß riß alle Gewalt an sich. Robespierre, der noch
vor kurzem ein kleiner, unbeachteter Rechtsanwalt
gewesen war, unterschrieb jeden Tag einen Stoß Todes-
urteile, ohne sie zu zählen.
Louis Montarnal war verliebt, aber die Liebe
machte ihn nicht völlig blind. Als der Blutstrom immer
höher schwoll, wandte er sich schaudernd ab. Das war
nicht die Verwirklichung der Jdee des allgemeinen
Glücks. Er begann an seinem Volk zu verzweifeln.
Und er wandte sich nun im vollen Ernst wieder seinem
Jugendplan zu, nach der Südsee auszuwandern. An
Mitteln fehlte es ihm nicht.
Die Auswanderung in jeder Form aber war ver-
boten. Doch er fand bald einen Ausweg. Er wollte
gleichzeitig nach der Spur des Laperouse forschen,
der vor fünf Jahren mit zwei Fregatten zur Erforschung
der Südsee ausgesandt worden und nicht zurückgekehrt
war. Seine letzten Nachrichten stammten aus Sydney.
An dem Untergang der Erpedition war kein Iweifel
mehr möglich. D'Entrecasteaur, den die National-
versammlung im Jahre 1791 ausgesandt hatte, war
ohne Nachricht von Laperouse heimgekehrt. Trotzdem
war die Hoffnung nicht geschwunden, daß er mit seiner
Mannschaft auf irgendeiner abgelegenen Jnsel noch lebe.
Montarnal teilte diese Hoffnung allerdings nicht,
aber er wollte sie sich zunutze machen, um seinen
Kolonisationsplan ausführen zu können. Er eilte un-
verzüglich zu Heloise de Lamamon. Sie war sofort
begeistert von der Jdee, den unglücklichen Laperouse
aufzusuchen, und versprach ihm ihre Unterstützung.
„Kommen Sie mit, Madame!" rief er und sank
ihr zu Füßen. !
„Aufs Meer?" lachte sie hell aus. „Sie sind wohl
närrisch geworden, mein Lieber?"
Das traf ihn wie ein Stich. Er verabschiedete sich
bald und ging. Daheim aber schöpfte er neuen Mut.
Er gab sich selbst die Schuld an ihrer Antwort. Er hatte
es verabsäumt, sie völlig einzuweihen. Nicht aufs Meer
wollte er sie führen, sondern in sein Paradies.
Und er ging am nächsten Tage zu ihr, das Herz voll
Hoffnung.
Die Aofe wollte ihm den Autritt verwehren, aber er
achtete nicht auf ihr Geschrei, drang ein und fand dicht
neben Heloise de Lamamon den BürgerRobespierre sitzen.
Die Blicke der überraschten sagten Montarnal genug.
„Madame!" rief er und faßte an seinen Degen.
„Habt Jhr irgendwelche Rechte an diese Dame,
Bürger Montarnal?" ftagte Robespierre herablassend.
„Jetzt nicht mehr!" knirschte Louis da la Gorde
und stieß den Degen in die Scheide.
„Dann begreife ich Euer Betragen nicht!" sprach
Robespierre, der anscheinend sehr guter Laune war.
„Laßt der Bürgerin Lamamon doch die Freiheit ihres
guten Herzens!"
„Jch lasse ihr die Freiheit, ihre Liebhaber zu wechseln
wie ihre Handschuhe."
„Dies ist mehr, als man verlangen kann!" sprach
Robespierre stirnrunzelnd. „Jch habe soeben gehört,
daß Jhr eine Erpedition ausrüsten wollt, um nach dem
verschollenen Laperouse zu forschen. Beeilt Euch damit,
Bürger Montarnal. Das Arsenal in Brest steht zu Eurer
Verfügung, doch nur für zehn Tage. FallsJhr Euch dann
nicht auf hoher See befindet, werde ich Euren Namen
auf die Liste setzen lassen, Bürger Montarnal. Geht
und wagt es nicht, ohne Laperouse heimzukehren. Er-
seht daraus, daß ich großmütig bin."
Louis de la Gorde stürzte hinaus und irrte ziellos
durch die Straßen. Als er am Abend in sein Hotel
zurückkehrte, erwartete ihn bereits der Befehl des Wohl-
fahrtsausschusses, sofort nach Brest aufzubrechen.^
Er sandte das Schreiben mit dem Bemerken zurück,
daß es keines Besehls bedürfe, wo die Absicht einer
fteiwilligen Leistung vorhanden sei. Am nächsten
Morgen wurde er sehr zeitig von zwei Soldaten geweckt.
Sie hatten den Auftrag, ihn nach Brest zu bringen.
Die Kutsche wartete schon vor der Tür.
Er stieg ein und fuhr nach Brest, bewacht von den
beiden Soldaten.
Sie hatten den Besehl, ihn zehn Tage lang nicht aus
den Augen zu lassen und ihn am elften zu verhaften,
falls er bis dahin nicht in See gestochen sein würde.
Ein Brester Bankier, der Montaral noch von seincr
Dienstzeit her kannte, schoß ihm die nötigen Gelder vor.
Die Hilfe des Arsenals schlug er aus. Er fand im Hafen
ein tüchtiges Schiff mit drei Masten, „Der Triton"
genannt, kauste es, versah es mit allem Nötigen und warb
Leute an. Da er mit dem Geld nicht kargte, liefen ihm
dreimal so viel zu, als er brauchen konnte. Er wählte
die jüngsten von ihnen aus und sah darauf, daß sie
unverheiratet waren. Lambert Soulas, ein dickköpfiger
Bretone, wurde erster, Bastian Fleury, ein beweglicher
Gascogner, zweiter Steuermann auf dem Triton. Renö
Prieur, ein besonnener Normanne, wurde Bootsmann.
Den anfänglichen Gedanken, weiße Mädchen mit-
zunehmen, ließ Louis Montarnal fallen. Er haßte in
Heloise das ganze Geschlecht. Er strebte mit allen Kräften
seiner Seele zur Natur zurück, und gedachte die Kolonie
mit einer Mischrasse zu bevölkern, in der sich die Jntelli-
genz der Weißen mit der Unschuld der Eingeborenen
vereinigen sollte.
Schon am Abend des achten Tages war das Schiff
seeklar. Die beiden Soldaten aber wichen nicht von
Bord.
An diesem Abend gingen Guillaume Andriaur und
Charles Rabier, zwei Vettern aus dem Fischerdorf
Pleherel, die zur Besatzung gehörten, noch einmal an
Land und trafen bei der Zollwache einen blassen, schmäch-
tigen Jungen, der sie nach dem Triton fragte.
„Jch bin der Schiffsjunge!" erklärte er schüchtern.
nahmen der Regierung für gänzlich verfehlt zu finden,
ihn auf die Liste der Verdachtigen zu setzen.
Da nahm er seinen Abschied, blieb aber in Paris,
da er inzwischen die schöne Heloise de Lamamon kennen
gelernt hatte, die von der Guillotine zur jungen Witwe
gemacht worden war. Sie schenkte ihm auch sehr bald
ihre Liebe. Daß sie mit ihrer Gunst auch andern gegen-
über nicht geizte, wußte er weder, noch ahnte er es.
Sie lud ihn zweimal in der Woche zu sich, gab ihm
Ratschlage, vorsichtig zu sein, die er auch befolgte, und
rettete ihn so vor den Gefahren der Politik.
Denn die Guillotine begann nun zu rasen. Der
Kopf des unglücklichen Königs fiel. Der Wohlfahrts-
ausschuß riß alle Gewalt an sich. Robespierre, der noch
vor kurzem ein kleiner, unbeachteter Rechtsanwalt
gewesen war, unterschrieb jeden Tag einen Stoß Todes-
urteile, ohne sie zu zählen.
Louis Montarnal war verliebt, aber die Liebe
machte ihn nicht völlig blind. Als der Blutstrom immer
höher schwoll, wandte er sich schaudernd ab. Das war
nicht die Verwirklichung der Jdee des allgemeinen
Glücks. Er begann an seinem Volk zu verzweifeln.
Und er wandte sich nun im vollen Ernst wieder seinem
Jugendplan zu, nach der Südsee auszuwandern. An
Mitteln fehlte es ihm nicht.
Die Auswanderung in jeder Form aber war ver-
boten. Doch er fand bald einen Ausweg. Er wollte
gleichzeitig nach der Spur des Laperouse forschen,
der vor fünf Jahren mit zwei Fregatten zur Erforschung
der Südsee ausgesandt worden und nicht zurückgekehrt
war. Seine letzten Nachrichten stammten aus Sydney.
An dem Untergang der Erpedition war kein Iweifel
mehr möglich. D'Entrecasteaur, den die National-
versammlung im Jahre 1791 ausgesandt hatte, war
ohne Nachricht von Laperouse heimgekehrt. Trotzdem
war die Hoffnung nicht geschwunden, daß er mit seiner
Mannschaft auf irgendeiner abgelegenen Jnsel noch lebe.
Montarnal teilte diese Hoffnung allerdings nicht,
aber er wollte sie sich zunutze machen, um seinen
Kolonisationsplan ausführen zu können. Er eilte un-
verzüglich zu Heloise de Lamamon. Sie war sofort
begeistert von der Jdee, den unglücklichen Laperouse
aufzusuchen, und versprach ihm ihre Unterstützung.
„Kommen Sie mit, Madame!" rief er und sank
ihr zu Füßen. !
„Aufs Meer?" lachte sie hell aus. „Sie sind wohl
närrisch geworden, mein Lieber?"
Das traf ihn wie ein Stich. Er verabschiedete sich
bald und ging. Daheim aber schöpfte er neuen Mut.
Er gab sich selbst die Schuld an ihrer Antwort. Er hatte
es verabsäumt, sie völlig einzuweihen. Nicht aufs Meer
wollte er sie führen, sondern in sein Paradies.
Und er ging am nächsten Tage zu ihr, das Herz voll
Hoffnung.
Die Aofe wollte ihm den Autritt verwehren, aber er
achtete nicht auf ihr Geschrei, drang ein und fand dicht
neben Heloise de Lamamon den BürgerRobespierre sitzen.
Die Blicke der überraschten sagten Montarnal genug.
„Madame!" rief er und faßte an seinen Degen.
„Habt Jhr irgendwelche Rechte an diese Dame,
Bürger Montarnal?" ftagte Robespierre herablassend.
„Jetzt nicht mehr!" knirschte Louis da la Gorde
und stieß den Degen in die Scheide.
„Dann begreife ich Euer Betragen nicht!" sprach
Robespierre, der anscheinend sehr guter Laune war.
„Laßt der Bürgerin Lamamon doch die Freiheit ihres
guten Herzens!"
„Jch lasse ihr die Freiheit, ihre Liebhaber zu wechseln
wie ihre Handschuhe."
„Dies ist mehr, als man verlangen kann!" sprach
Robespierre stirnrunzelnd. „Jch habe soeben gehört,
daß Jhr eine Erpedition ausrüsten wollt, um nach dem
verschollenen Laperouse zu forschen. Beeilt Euch damit,
Bürger Montarnal. Das Arsenal in Brest steht zu Eurer
Verfügung, doch nur für zehn Tage. FallsJhr Euch dann
nicht auf hoher See befindet, werde ich Euren Namen
auf die Liste setzen lassen, Bürger Montarnal. Geht
und wagt es nicht, ohne Laperouse heimzukehren. Er-
seht daraus, daß ich großmütig bin."
Louis de la Gorde stürzte hinaus und irrte ziellos
durch die Straßen. Als er am Abend in sein Hotel
zurückkehrte, erwartete ihn bereits der Befehl des Wohl-
fahrtsausschusses, sofort nach Brest aufzubrechen.^
Er sandte das Schreiben mit dem Bemerken zurück,
daß es keines Besehls bedürfe, wo die Absicht einer
fteiwilligen Leistung vorhanden sei. Am nächsten
Morgen wurde er sehr zeitig von zwei Soldaten geweckt.
Sie hatten den Auftrag, ihn nach Brest zu bringen.
Die Kutsche wartete schon vor der Tür.
Er stieg ein und fuhr nach Brest, bewacht von den
beiden Soldaten.
Sie hatten den Besehl, ihn zehn Tage lang nicht aus
den Augen zu lassen und ihn am elften zu verhaften,
falls er bis dahin nicht in See gestochen sein würde.
Ein Brester Bankier, der Montaral noch von seincr
Dienstzeit her kannte, schoß ihm die nötigen Gelder vor.
Die Hilfe des Arsenals schlug er aus. Er fand im Hafen
ein tüchtiges Schiff mit drei Masten, „Der Triton"
genannt, kauste es, versah es mit allem Nötigen und warb
Leute an. Da er mit dem Geld nicht kargte, liefen ihm
dreimal so viel zu, als er brauchen konnte. Er wählte
die jüngsten von ihnen aus und sah darauf, daß sie
unverheiratet waren. Lambert Soulas, ein dickköpfiger
Bretone, wurde erster, Bastian Fleury, ein beweglicher
Gascogner, zweiter Steuermann auf dem Triton. Renö
Prieur, ein besonnener Normanne, wurde Bootsmann.
Den anfänglichen Gedanken, weiße Mädchen mit-
zunehmen, ließ Louis Montarnal fallen. Er haßte in
Heloise das ganze Geschlecht. Er strebte mit allen Kräften
seiner Seele zur Natur zurück, und gedachte die Kolonie
mit einer Mischrasse zu bevölkern, in der sich die Jntelli-
genz der Weißen mit der Unschuld der Eingeborenen
vereinigen sollte.
Schon am Abend des achten Tages war das Schiff
seeklar. Die beiden Soldaten aber wichen nicht von
Bord.
An diesem Abend gingen Guillaume Andriaur und
Charles Rabier, zwei Vettern aus dem Fischerdorf
Pleherel, die zur Besatzung gehörten, noch einmal an
Land und trafen bei der Zollwache einen blassen, schmäch-
tigen Jungen, der sie nach dem Triton fragte.
„Jch bin der Schiffsjunge!" erklärte er schüchtern.