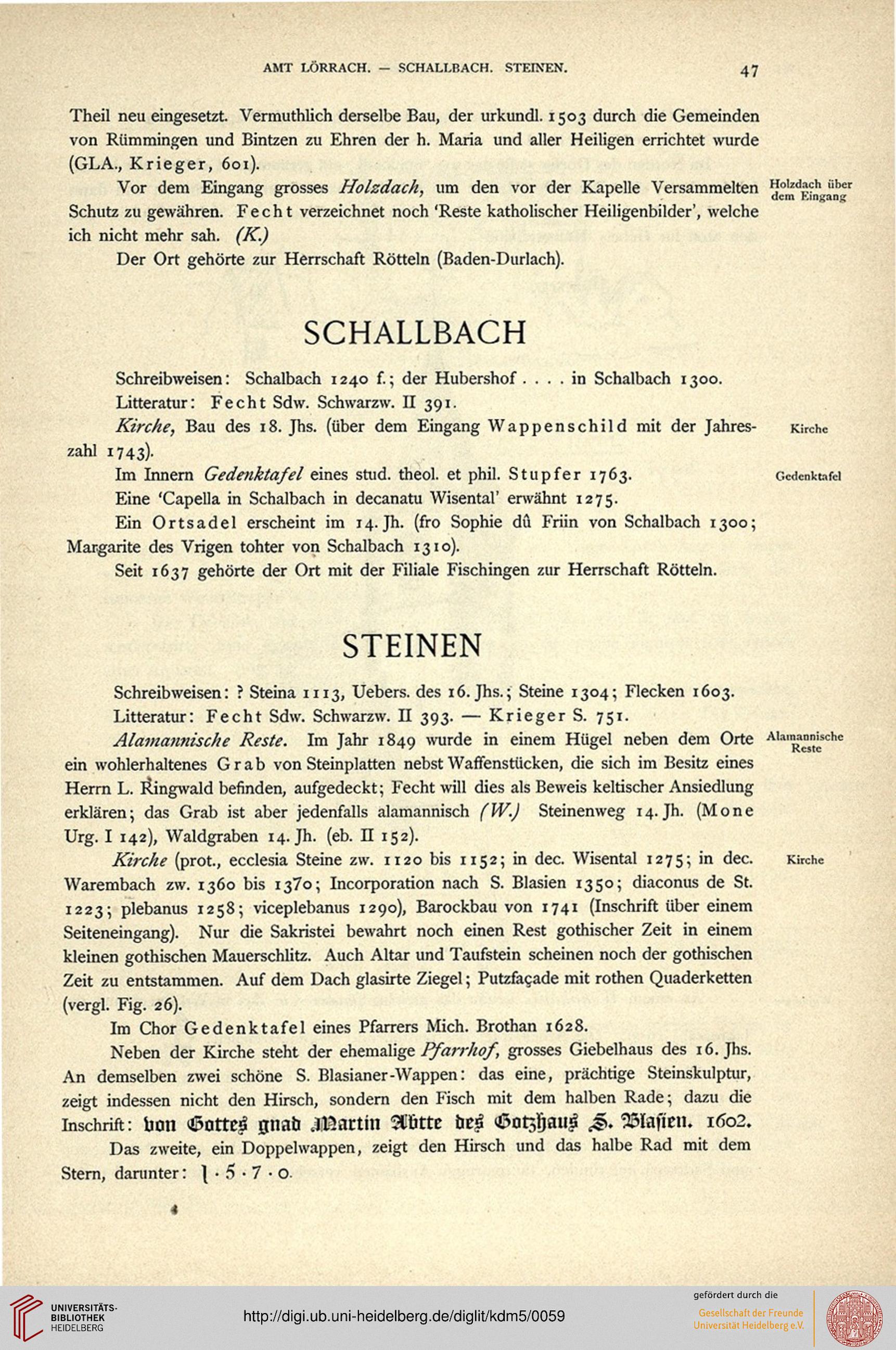AMT I.!)KK,U-J!. SC/IIAI.E.ilACfl. STKISKS".
47
Theil neu eingesetzt. Vermuthlich derselbe Bau, der urkundl. 1503 durch die Gemeinden
von Rümmingen und Bintzen zu Ehren der h. Maria und aller Heiligen errichtet wurde
(GLA-, Krieger, 601).
Vor dem Eingang grosses Holzdach, um den vor der Kapelle Versammelten \
Schutz zu gewähren. Fecht verzeichnet noch 'Reste katholischer Heiligenbilder', weiche
ich nicht mehr sah. (K.)
Der Ort gehörte zur Herrschaft Rötteln (Baden-Durlach).
SCHALLBACH
Schreibweisen: Schalbach 1240 f.; der Hubershof .... in Schalbach 1300,
Litteratur: Fecht Sdw. Schwarziv. II 391.
Kirche, Bau des 18. Jos. (über dem Eingang Wappenschild mit der Jahres
zahl 1743}.
Im Innern Gedenktafel eines stud, theol. et phil. Stupfer 1763.
Eine 'Capeila in Schalbach in decanatu Wisenfàl' erwähnt 1275.
Ein Ortsadel erscheint im 14. Jh. (fro Sophie dû Friin von Schalbach 1300
Margarite des Vrigen tohter von Schalbach 1310}.
Seit 1637 gehörte der Ort mit der Filiale Fischingen zur Herrschaft Rötteln.
STEINEN
Schreibweisen: ? Steina 1113, Uebers. des 16. Jhs.; Steine 1304; Flecken 1603.
Litteratur: Fecht Sdw. Schwatów. II 393. — Krieger S. 751.
Alamunniscke Reste. Im Jahr 1849 wurde in einem Hügel neben dem Orte ■
ein wohlerhaltenes Grab von Steinplatten nebst Waffen stücken, die sich im Besitz eines
Herrn L. Éìngwald befinden, aufgedeckt; Fecht will dies als Beweis keltischer Ansiedlung
erklären; das Grab ist aber jedenfalls alamannisch (W.J Steinenweg r4. Jh. (Mone
Urg. I 142), Waldgraben 14. Jh. (eb. H 152).
Kirche (prot., ecclesia Steine zw. 1120 bis 1152; in dec. Wisental 1275; in dec.
Warembach zw. r30o bis i37o; Incorporation nach S. Blasien 135°; diaconus de St.
1223; plebanus 1258; viceplebanus 1290), Barockbau von 174t (Inschrift über einem
Seiteneingang). Nur die Sakristei bewahrt noch einen Rest gothischer Zeit in einem
kleinen gothischen Mauerschlitz. Auch Altar und Taufstein scheinen noch der gothischen
Zeit zu entstammen. Auf dem Dach glasirte Ziegel; Putzfaçade mit rothen Quaderketten
(vergi. Fig. 26).
Im Chor Gedenktafel eines Pfarrers Mich. Brothan 162S.
Neben der Kirche steht der ehemalige Pfarrhof, grosses Giebelhaus des 16. Jhs.
An demselben zwei schöne S. Blasianer-Wappen: das eine, prächtige Steinskulptur,
zeigt indessen nicht den Hirsch, sondern den Fisch mit dem halben Rade; dazu die
Inschrift: ban *®nttt$ 0iiaö Martin elitre bz$ «3at5|)aii£ <§• Mafien. i<fo2.
Das zweite, ein Doppelwappen, zeigt den Hirsch und das halbe Rad mit dem
Stern, darunter: \ ■■$ • 7 • O-
47
Theil neu eingesetzt. Vermuthlich derselbe Bau, der urkundl. 1503 durch die Gemeinden
von Rümmingen und Bintzen zu Ehren der h. Maria und aller Heiligen errichtet wurde
(GLA-, Krieger, 601).
Vor dem Eingang grosses Holzdach, um den vor der Kapelle Versammelten \
Schutz zu gewähren. Fecht verzeichnet noch 'Reste katholischer Heiligenbilder', weiche
ich nicht mehr sah. (K.)
Der Ort gehörte zur Herrschaft Rötteln (Baden-Durlach).
SCHALLBACH
Schreibweisen: Schalbach 1240 f.; der Hubershof .... in Schalbach 1300,
Litteratur: Fecht Sdw. Schwarziv. II 391.
Kirche, Bau des 18. Jos. (über dem Eingang Wappenschild mit der Jahres
zahl 1743}.
Im Innern Gedenktafel eines stud, theol. et phil. Stupfer 1763.
Eine 'Capeila in Schalbach in decanatu Wisenfàl' erwähnt 1275.
Ein Ortsadel erscheint im 14. Jh. (fro Sophie dû Friin von Schalbach 1300
Margarite des Vrigen tohter von Schalbach 1310}.
Seit 1637 gehörte der Ort mit der Filiale Fischingen zur Herrschaft Rötteln.
STEINEN
Schreibweisen: ? Steina 1113, Uebers. des 16. Jhs.; Steine 1304; Flecken 1603.
Litteratur: Fecht Sdw. Schwatów. II 393. — Krieger S. 751.
Alamunniscke Reste. Im Jahr 1849 wurde in einem Hügel neben dem Orte ■
ein wohlerhaltenes Grab von Steinplatten nebst Waffen stücken, die sich im Besitz eines
Herrn L. Éìngwald befinden, aufgedeckt; Fecht will dies als Beweis keltischer Ansiedlung
erklären; das Grab ist aber jedenfalls alamannisch (W.J Steinenweg r4. Jh. (Mone
Urg. I 142), Waldgraben 14. Jh. (eb. H 152).
Kirche (prot., ecclesia Steine zw. 1120 bis 1152; in dec. Wisental 1275; in dec.
Warembach zw. r30o bis i37o; Incorporation nach S. Blasien 135°; diaconus de St.
1223; plebanus 1258; viceplebanus 1290), Barockbau von 174t (Inschrift über einem
Seiteneingang). Nur die Sakristei bewahrt noch einen Rest gothischer Zeit in einem
kleinen gothischen Mauerschlitz. Auch Altar und Taufstein scheinen noch der gothischen
Zeit zu entstammen. Auf dem Dach glasirte Ziegel; Putzfaçade mit rothen Quaderketten
(vergi. Fig. 26).
Im Chor Gedenktafel eines Pfarrers Mich. Brothan 162S.
Neben der Kirche steht der ehemalige Pfarrhof, grosses Giebelhaus des 16. Jhs.
An demselben zwei schöne S. Blasianer-Wappen: das eine, prächtige Steinskulptur,
zeigt indessen nicht den Hirsch, sondern den Fisch mit dem halben Rade; dazu die
Inschrift: ban *®nttt$ 0iiaö Martin elitre bz$ «3at5|)aii£ <§• Mafien. i<fo2.
Das zweite, ein Doppelwappen, zeigt den Hirsch und das halbe Rad mit dem
Stern, darunter: \ ■■$ • 7 • O-