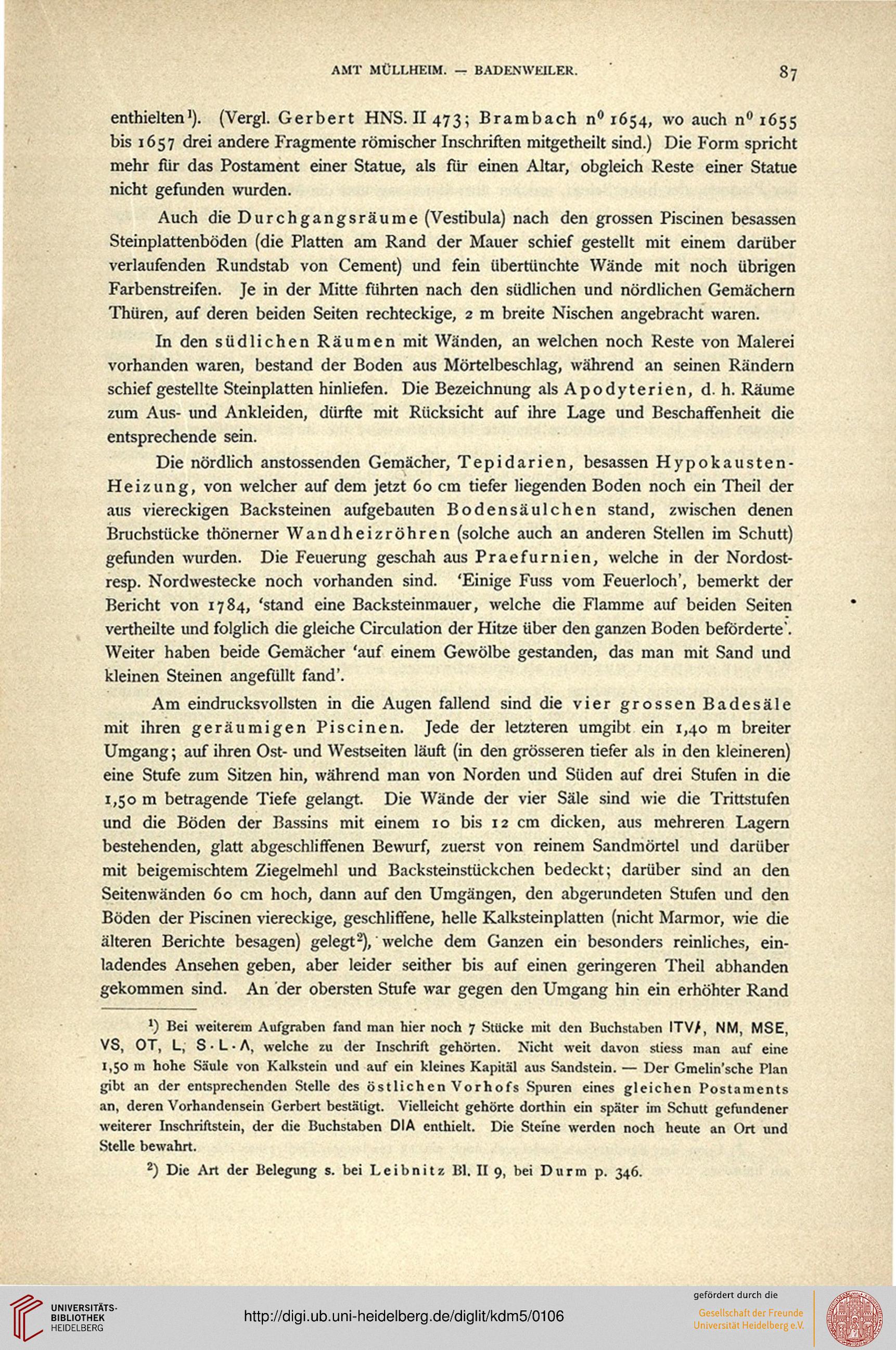enthielten'). (Vergi. Gerbert HNS. II 473; Brambach n° r6S4> wo auch n° 1655
bis 1657 drei andere Fragmente römischer Inschriften mitgetheilt sind.) Die Form spricht
mehr für das Postament einer Statue, als für einen Altar, obgleich Reste einer Statue
nicht gefunden wurden.
Auch die Durchgangsräume (Vestibula) nach den grossen Piscinen besassen
Steinplattenböden (die Platten am Rand der Mauer schief gestellt mit einem darüber
verlaufenden Rundstab von Cement) und fein übertünchte Wände mit noch übrigen
Farbenstreifen. Je in der Mitte führten nach den südlichen und nördlichen Gemachem
Thüren, auf deren beiden Seiten rechteckige, 2 m breite Nischen angebracht waren.
In den südlichen Räumen mit Wänden, an welchen noch Reste von Malerei
vorhanden waren, bestand der Boden aus Mörtelbeschlag, während an seinen Rändern
schief gestellte Steinplatten hinliefen. Die Bezeichnung als Apodyterien, d. h. Räume
zum Aus- und Ankleiden, dürfte mit Rücksicht auf ihre Lage und Beschaffenheit die
entsprechende sein.
Die nördlich anstossenden Gemächer, Tepidarien, besassen Hypokausten-
Heizung, von welcher auf dem jetzt 60 cm tiefer liegenden Boden noch ein Theil der
aus viereckigen Backsteinen aufgebauten Bodensäulchen stand, zwischen denen
Bruchstücke thönerner Wandheizröhren (solche auch an anderen Stellen im Schutt)
gefunden wurden. Die Feuerung geschah aus Praefurnien, welche in der Nordost-
resp. Nordwestecke noch vorhanden sind. 'Einige Fuss vom Feuerloch*, bemerkt der
Bericht von 1784, 'stand eine Backsteinmauer, welche die Flamme auf beiden Seiten
vertheilte und folglich die gleiche Circulation der Hitze über den ganzen Boden beförderte'.
Weiter haben beide Gemächer 'auf einem Gewölbe gestanden, das man mit Sand und
kleinen Steinen angefüllt fand'.
Am eindrucksvollsten in die Augen fallend sind die vier grossen Badesäle
mit ihren geräumigen Piscinen. Jede der letzteren umgibt ein 1,40 m breiter
Umgang ; auf ihren Ost- und Westseiten läuft (in den grösseren tiefer als in den kleineren)
eine Stufe zum Sitzen hin, während man von Norden und Süden auf drei Stufen in die
1,50 m betragende Tiefe gelangt. Die Wände der vier Säle sind wie die Trittstufen
und die Böden der Bassins mit einem 10 bis 12 cm dicken, aus mehreren Lagern
bestehenden, glatt abgeschliffenen Bewurf, zuerst von reinem Snndmörtel und darüber
mit beigemischtem Ziegelmehl und Back Steinstückchen bedeckt; darüber sind an den
Seitenwänden 60 cm hoch, dann auf den Umgängen, den abgerundeten Stufen und den
Böden der Piscinen viereckige, geschliffene, helle Kalkstein platten (nicht Marmor, wie die
älteren Berichte besagen) i;el^t-), welche dem Ganzen ein besonders reinliches, ein-
ladendes Ansehen geben, aber leider seither bis auf einen geringeren Theil abhanden
gekommen sind. An der obersten Stufe war gegen den Umgang hin ein erhöhter Rand
■) Bei weiterem Aufgraben fand man hier noch 7 Stücke mit den Buchstaben ITW, NM, MSE,
VS, OT, L; S-L-A, welche lu der Inschrift gehörten. Nicht weit davon süess man auf eine
1,50 m hohe Sanie von Kalkstein und auf ein kleines Kapital aus Sandstein. — Der Gmeün'sche Plan
gibt an der entsprechenden Stelle des ostlichen Vorhofs Spuren eines gleichen Postaments
an, deren Voi-luindimssin (Scriicvl Wstìii^t. Viullciciu jjeiiiinc cìur:lii 11 0i:i -:,-j:;r im Schutt gefundener
weiterer Inschriitstein, der tue Buchstaben DIA enthielt. Die Steine werden noch heute an Ort und
Stelle bewahrt.
bis 1657 drei andere Fragmente römischer Inschriften mitgetheilt sind.) Die Form spricht
mehr für das Postament einer Statue, als für einen Altar, obgleich Reste einer Statue
nicht gefunden wurden.
Auch die Durchgangsräume (Vestibula) nach den grossen Piscinen besassen
Steinplattenböden (die Platten am Rand der Mauer schief gestellt mit einem darüber
verlaufenden Rundstab von Cement) und fein übertünchte Wände mit noch übrigen
Farbenstreifen. Je in der Mitte führten nach den südlichen und nördlichen Gemachem
Thüren, auf deren beiden Seiten rechteckige, 2 m breite Nischen angebracht waren.
In den südlichen Räumen mit Wänden, an welchen noch Reste von Malerei
vorhanden waren, bestand der Boden aus Mörtelbeschlag, während an seinen Rändern
schief gestellte Steinplatten hinliefen. Die Bezeichnung als Apodyterien, d. h. Räume
zum Aus- und Ankleiden, dürfte mit Rücksicht auf ihre Lage und Beschaffenheit die
entsprechende sein.
Die nördlich anstossenden Gemächer, Tepidarien, besassen Hypokausten-
Heizung, von welcher auf dem jetzt 60 cm tiefer liegenden Boden noch ein Theil der
aus viereckigen Backsteinen aufgebauten Bodensäulchen stand, zwischen denen
Bruchstücke thönerner Wandheizröhren (solche auch an anderen Stellen im Schutt)
gefunden wurden. Die Feuerung geschah aus Praefurnien, welche in der Nordost-
resp. Nordwestecke noch vorhanden sind. 'Einige Fuss vom Feuerloch*, bemerkt der
Bericht von 1784, 'stand eine Backsteinmauer, welche die Flamme auf beiden Seiten
vertheilte und folglich die gleiche Circulation der Hitze über den ganzen Boden beförderte'.
Weiter haben beide Gemächer 'auf einem Gewölbe gestanden, das man mit Sand und
kleinen Steinen angefüllt fand'.
Am eindrucksvollsten in die Augen fallend sind die vier grossen Badesäle
mit ihren geräumigen Piscinen. Jede der letzteren umgibt ein 1,40 m breiter
Umgang ; auf ihren Ost- und Westseiten läuft (in den grösseren tiefer als in den kleineren)
eine Stufe zum Sitzen hin, während man von Norden und Süden auf drei Stufen in die
1,50 m betragende Tiefe gelangt. Die Wände der vier Säle sind wie die Trittstufen
und die Böden der Bassins mit einem 10 bis 12 cm dicken, aus mehreren Lagern
bestehenden, glatt abgeschliffenen Bewurf, zuerst von reinem Snndmörtel und darüber
mit beigemischtem Ziegelmehl und Back Steinstückchen bedeckt; darüber sind an den
Seitenwänden 60 cm hoch, dann auf den Umgängen, den abgerundeten Stufen und den
Böden der Piscinen viereckige, geschliffene, helle Kalkstein platten (nicht Marmor, wie die
älteren Berichte besagen) i;el^t-), welche dem Ganzen ein besonders reinliches, ein-
ladendes Ansehen geben, aber leider seither bis auf einen geringeren Theil abhanden
gekommen sind. An der obersten Stufe war gegen den Umgang hin ein erhöhter Rand
■) Bei weiterem Aufgraben fand man hier noch 7 Stücke mit den Buchstaben ITW, NM, MSE,
VS, OT, L; S-L-A, welche lu der Inschrift gehörten. Nicht weit davon süess man auf eine
1,50 m hohe Sanie von Kalkstein und auf ein kleines Kapital aus Sandstein. — Der Gmeün'sche Plan
gibt an der entsprechenden Stelle des ostlichen Vorhofs Spuren eines gleichen Postaments
an, deren Voi-luindimssin (Scriicvl Wstìii^t. Viullciciu jjeiiiinc cìur:lii 11 0i:i -:,-j:;r im Schutt gefundener
weiterer Inschriitstein, der tue Buchstaben DIA enthielt. Die Steine werden noch heute an Ort und
Stelle bewahrt.