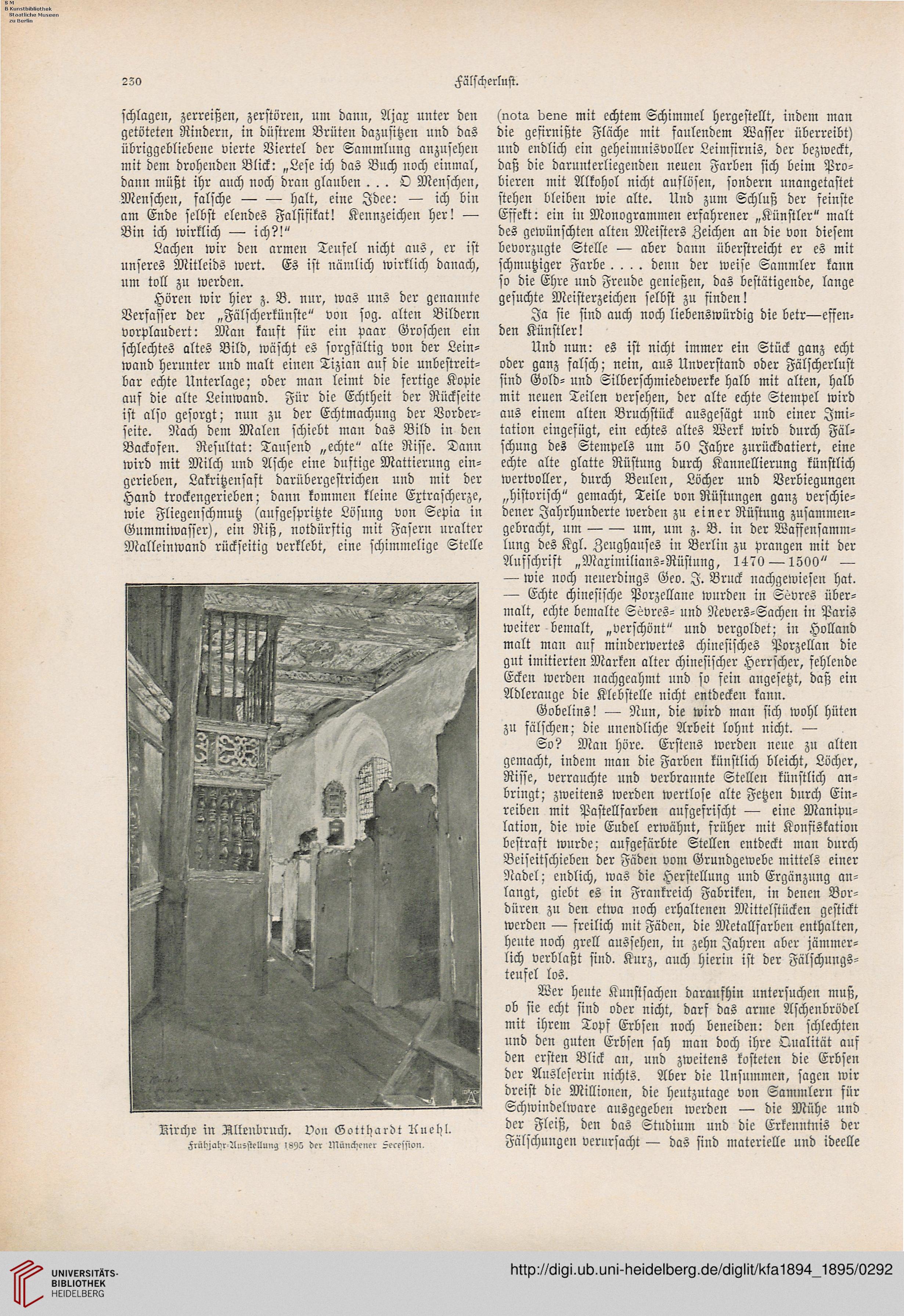230
Fälscherlust.
schlagen, zerreißen, zerstören, um dann, Ajax unter den
getöteten Rindern, in düstrem Brüten dazusitzen und das
übriggebliebene vierte Viertel der Sammlung anzusehen
mit dem drohenden Blick: „Lese ich das Buch noch einmal,
dann müßt ihr auch noch dran glauben . . . O Menschen,
Menschen, falsche-halt, eine Idee: — ich bin
am Ende selbst elendes Falsifikat! Kennzeichen her! —
Bin ich wirklich — ich?!"
Lachen wir den armen Teufel nicht aus, er ist
unseres Mitleids wert. Es ist nämlich wirklich danach,
um toll zu werden.
Hören wir hier z. B. nur, was uns der genannte
Verfasser der „Fälscherkünste" von sog. alten Bildern
vorplaudert: Man kauft für ein paar Groschen ein
schlechtes altes Bild, wäscht es sorgfältig von der Lein-
wand herunter und malt einen Tizian auf die unbestreit-
bar echte Unterlage; oder man leimt die fertige Kopie
ans die alte Leinwand. Für die Echtheit der Rückseite
ist also gesorgt; nun zu der Echtmachung der Vorder-
seite. Nach dem Malen schiebt man das Bild in den
Backofen. Resultat: Tausend „echte" alte Risse. Tann
wird mit Milch und Asche eine duftige Mattierung ein-
gcrieben, Lakritzensaft darübergestrichen und mit der
Hand trockengerieben; dann kommen kleine Extrascherze,
wie Fliegenschmutz (aufgespritzte Lösung von Sepia in
Gummiwasser), ein Riß, notdürftig mit Fasern uralter
Malleinwand rückseitig verklebt, eine schimmelige Stelle
Kirche in Mkenbruch. von Gotthardt Ruehl.
(nota dene mit echtem Schimmel hergestellt, indem man
die gefirnißte Fläche mit faulendem Wasser überreibt)
und endlich ein geheimnisvoller Leimfirnis, der bezweckt,
daß die darnnlerliegenden neuen Farben sich beim Pro-
bieren mit Alkohol nicht auflösen, sondern unangetastet
stehen bleiben wie alte. Und zum Schluß der feinste
Effekt: ein in Monogrammen erfahrener „Künstler" malt
des gewünschten alten Meisters Zeichen an die von diesem
bevorzugte Stelle — aber dann überstreicht er es mit
schmutziger Farbe.... denn der weise Sammler kann
so die Ehre und Freude genießen, das bestätigende, lange
gesuchte Meisterzeichen selbst zu finden!
Ja sie sind auch noch liebenswürdig die betr—essen-
den Künstler!
Und nun: es ist nicht immer ein Stück ganz echt
oder ganz falsch; nein, aus Unverstand oder Fälscherlust
sind Gold- und Silberschmiedewerke halb mit alten, halb
mit neuen Teilen versehen, der alte echte Stempel wird
aus einem alten Bruchstück ausgesägt und einer Imi-
tation eingefügt, ein echtes altes Werk wird durch Fäl-
schung des Stempels um 50 Jahre zurückdatiert, eine
echte alte glatte Rüstung durch Kannellierung künstlich
wertvoller, durch Beulen, Löcher und Verbiegungen
„historisch" gemacht, Teile von Rüstungen ganz verschie-
dener Jahrhunderte werden zu einer Rüstung zusammen-
gebracht, um-um, um z. B. in der Waffensamm-
lung des Kgl. Zeughauses in Berlin zu prangen mit der
Aufschrift „Maximilians-Rüstung, 1470 —1500" —
— wie noch neuerdings Geo. I. Bruck uachgewiesen hat.
— Echte chinesische Porzellane wurden in Sövres über-
malt, echte bemalte Sevres- und Nevers-Sachen in Paris
weiter bemalt, „verschönt" und vergoldet; in Holland
malt man auf minderwertes chinesisches Porzellan die
gut imitierten Marken alter chinesischer Herrscher, fehlende
Ecken werden nachgeahmt und so fein angesetzt, daß ein
Adlerauge die Klebstelle nicht entdecken kann.
Gobelins! — Nun, die wird man sich wohl hüten
zu fälschen; die unendliche Arbeit lohnt nicht. —
So? Man höre. Erstens werden neue zu alten
gemacht, indem man die Farben künstlich bleicht, Löcher,
Risse, verrauchte und verbrannte Stellen künstlich an-
bringt; zweitens werden wertlose alte Fetzen durch Ein-
reiben mit Pastellfarben aufgefrischt — eine Manipu-
lation, die wie Eudel erwähnt, früher mit Konfiskation
bestraft wurde; aufgefärbte Stellen entdeckt man durch
Beiseitschieben der Fäden vom Grundgewebe mittels einer
Nadel; endlich, was die Herstellung und Ergänzung an-
langt, giebt cs in Frankreich Fabriken, in denen Bor-
düren zu den etwa noch erhaltenen Mittelstücken gestickt
werden — freilich mit Fäden, die Metallfarben enthalten,
heute noch grell aussehen, in zehn Jahren aber jämmer-
lich verblaßt sind. Kurz, auch hierin ist der Fälschungs-
teufel los.
Wer heute Kunstsachen daraufhin untersuchen muß,
ob sie echt sind oder nicht, darf das arme Aschenbrödel
mit ihrem Topf Erbsen noch beneiden: den schlechten
und den guten Erbsen sah man doch ihre Qualität auf
den ersten Blick an, und zweitens kosteten die Erbsen
der Ausleserin nichts. Aber die Unsummen, sagen wir
dreist die Millionen, die heutzutage von Sammlern für
Schwindelware ausgegeben werden — die Mühe und
der Fleiß, den das Studium und die Erkenntnis der
Fälschungen verursacht — das sind materielle und ideelle
Fälscherlust.
schlagen, zerreißen, zerstören, um dann, Ajax unter den
getöteten Rindern, in düstrem Brüten dazusitzen und das
übriggebliebene vierte Viertel der Sammlung anzusehen
mit dem drohenden Blick: „Lese ich das Buch noch einmal,
dann müßt ihr auch noch dran glauben . . . O Menschen,
Menschen, falsche-halt, eine Idee: — ich bin
am Ende selbst elendes Falsifikat! Kennzeichen her! —
Bin ich wirklich — ich?!"
Lachen wir den armen Teufel nicht aus, er ist
unseres Mitleids wert. Es ist nämlich wirklich danach,
um toll zu werden.
Hören wir hier z. B. nur, was uns der genannte
Verfasser der „Fälscherkünste" von sog. alten Bildern
vorplaudert: Man kauft für ein paar Groschen ein
schlechtes altes Bild, wäscht es sorgfältig von der Lein-
wand herunter und malt einen Tizian auf die unbestreit-
bar echte Unterlage; oder man leimt die fertige Kopie
ans die alte Leinwand. Für die Echtheit der Rückseite
ist also gesorgt; nun zu der Echtmachung der Vorder-
seite. Nach dem Malen schiebt man das Bild in den
Backofen. Resultat: Tausend „echte" alte Risse. Tann
wird mit Milch und Asche eine duftige Mattierung ein-
gcrieben, Lakritzensaft darübergestrichen und mit der
Hand trockengerieben; dann kommen kleine Extrascherze,
wie Fliegenschmutz (aufgespritzte Lösung von Sepia in
Gummiwasser), ein Riß, notdürftig mit Fasern uralter
Malleinwand rückseitig verklebt, eine schimmelige Stelle
Kirche in Mkenbruch. von Gotthardt Ruehl.
(nota dene mit echtem Schimmel hergestellt, indem man
die gefirnißte Fläche mit faulendem Wasser überreibt)
und endlich ein geheimnisvoller Leimfirnis, der bezweckt,
daß die darnnlerliegenden neuen Farben sich beim Pro-
bieren mit Alkohol nicht auflösen, sondern unangetastet
stehen bleiben wie alte. Und zum Schluß der feinste
Effekt: ein in Monogrammen erfahrener „Künstler" malt
des gewünschten alten Meisters Zeichen an die von diesem
bevorzugte Stelle — aber dann überstreicht er es mit
schmutziger Farbe.... denn der weise Sammler kann
so die Ehre und Freude genießen, das bestätigende, lange
gesuchte Meisterzeichen selbst zu finden!
Ja sie sind auch noch liebenswürdig die betr—essen-
den Künstler!
Und nun: es ist nicht immer ein Stück ganz echt
oder ganz falsch; nein, aus Unverstand oder Fälscherlust
sind Gold- und Silberschmiedewerke halb mit alten, halb
mit neuen Teilen versehen, der alte echte Stempel wird
aus einem alten Bruchstück ausgesägt und einer Imi-
tation eingefügt, ein echtes altes Werk wird durch Fäl-
schung des Stempels um 50 Jahre zurückdatiert, eine
echte alte glatte Rüstung durch Kannellierung künstlich
wertvoller, durch Beulen, Löcher und Verbiegungen
„historisch" gemacht, Teile von Rüstungen ganz verschie-
dener Jahrhunderte werden zu einer Rüstung zusammen-
gebracht, um-um, um z. B. in der Waffensamm-
lung des Kgl. Zeughauses in Berlin zu prangen mit der
Aufschrift „Maximilians-Rüstung, 1470 —1500" —
— wie noch neuerdings Geo. I. Bruck uachgewiesen hat.
— Echte chinesische Porzellane wurden in Sövres über-
malt, echte bemalte Sevres- und Nevers-Sachen in Paris
weiter bemalt, „verschönt" und vergoldet; in Holland
malt man auf minderwertes chinesisches Porzellan die
gut imitierten Marken alter chinesischer Herrscher, fehlende
Ecken werden nachgeahmt und so fein angesetzt, daß ein
Adlerauge die Klebstelle nicht entdecken kann.
Gobelins! — Nun, die wird man sich wohl hüten
zu fälschen; die unendliche Arbeit lohnt nicht. —
So? Man höre. Erstens werden neue zu alten
gemacht, indem man die Farben künstlich bleicht, Löcher,
Risse, verrauchte und verbrannte Stellen künstlich an-
bringt; zweitens werden wertlose alte Fetzen durch Ein-
reiben mit Pastellfarben aufgefrischt — eine Manipu-
lation, die wie Eudel erwähnt, früher mit Konfiskation
bestraft wurde; aufgefärbte Stellen entdeckt man durch
Beiseitschieben der Fäden vom Grundgewebe mittels einer
Nadel; endlich, was die Herstellung und Ergänzung an-
langt, giebt cs in Frankreich Fabriken, in denen Bor-
düren zu den etwa noch erhaltenen Mittelstücken gestickt
werden — freilich mit Fäden, die Metallfarben enthalten,
heute noch grell aussehen, in zehn Jahren aber jämmer-
lich verblaßt sind. Kurz, auch hierin ist der Fälschungs-
teufel los.
Wer heute Kunstsachen daraufhin untersuchen muß,
ob sie echt sind oder nicht, darf das arme Aschenbrödel
mit ihrem Topf Erbsen noch beneiden: den schlechten
und den guten Erbsen sah man doch ihre Qualität auf
den ersten Blick an, und zweitens kosteten die Erbsen
der Ausleserin nichts. Aber die Unsummen, sagen wir
dreist die Millionen, die heutzutage von Sammlern für
Schwindelware ausgegeben werden — die Mühe und
der Fleiß, den das Studium und die Erkenntnis der
Fälschungen verursacht — das sind materielle und ideelle