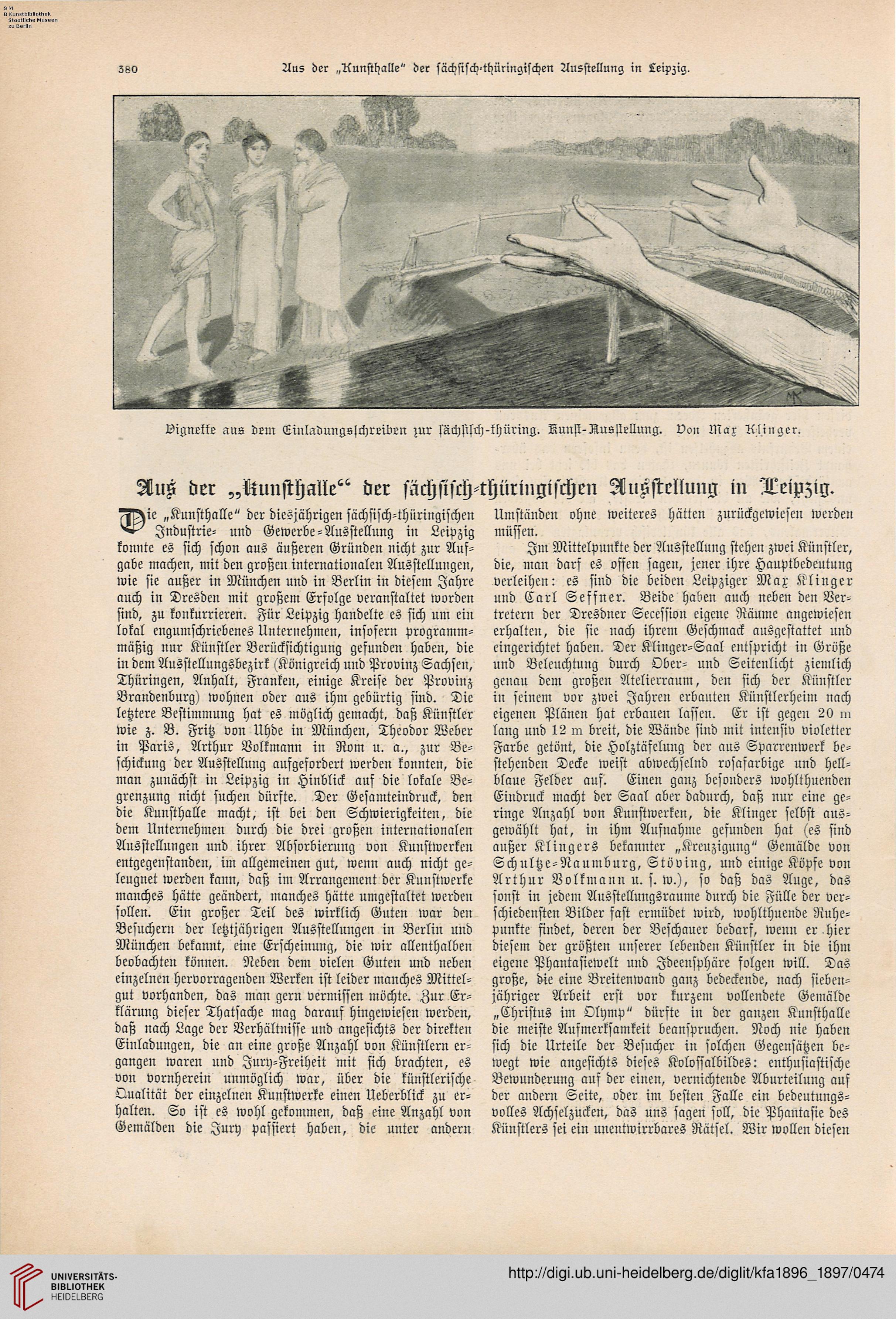Aus der „Kunsthalle" der sächsisch-thüringischen Ausstellung in Leipzig.
Z80
Vignette aus dem Einladungsschreiben zur sächsisch-lhüring. Kunst-Ausstellung, von Mar Klinger.
Auf der „Au,Malle" der sächsisch-thüringischen Aufstellung in Leipzig.
ie „Kunsthalle" der diesjährigen sächsisch-thüringischen
Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Leipzig
konnte es sich schon aus äußeren Gründen nicht zur Auf-
gabe machen, mit den großen internationalen Ausstellungen,
wie sie außer in München und in Berlin in diesem Jahre
auch in Dresden mit großem Erfolge veranstaltet worden
sind, zu konkurrieren. Für Leipzig handelte es sich um ein
lokal engumschriebenes Unternehmen, insofern programm-
mäßig nur Künstler Berücksichtigung gefunden haben, die
in dem Ausstellungsbezirk (Königreich und Provinz Sachsen,
Thüringen, Anhalt, Franken, einige Kreise der Provinz
Brandenburg) wohnen oder aus ihm gebürtig sind. Die
letztere Bestimmung hat es möglich gemacht, daß Künstler
wie z. B. Fritz von Uhde in München, Theodor Weber
in Paris, Arthur Volkmann in Rom u. a., zur Be-
schickung der Ausstellung aufgefordert werden konnten, die
man zunächst in Leipzig in Hinblick auf die lokale Be-
grenzung nicht suchen dürfte. Der Gesamteindruck, den
die Kunsthalle macht, ist bei den Schwierigkeiten, die
dem Unternehmen durch die drei großen internationalen
Ausstellungen und ihrer Absorbierung von Kunstwerken
entgegenstanden, im allgemeinen gut, wenn auch nicht ge-
leugnet werden kann, daß im Arrangement der Kunstwerke
manches hätte geändert, manches hätte umgestaltet werden
sollen. Ein großer Teil des wirklich Guten war den
Besuchern der letztjährigen Ausstellungen in Berlin und
München bekannt, eine Erscheinung, die wir allenthalben
beobachten können. Neben dem vielen Guten und neben
einzelnen hervorragenden Werken ist leider manches Mittel-
gut vorhanden, das man gern vermissen möchte. Zur Er-
klärung dieser Thatsache mag darauf hingewiesen werden,
daß nach Lage der Verhältnisse und angesichts der direkten
Einladungen, die an eine große Anzahl von Künstlern er-
gangen waren und Jury-Freiheit mit sich brachten, es
von vornherein unmöglich war, über die künstlerische
Qualität der einzelnen Kunstwerke einen Ueberblick zu er-
halten. So ist es wohl gekommen, daß eine Anzahl von
Gemälden die Jury passiert haben, die unter andern
Umständen ohne weiteres hätten zurückgewiesen werden
müssen.
Im Mittelpunkte der Ausstellung stehen zwei Künstler,
die, man darf es offen sagen, jener ihre Hauptbedeutung
verleihen: es sind die beiden Leipziger Max Klinger
und Carl Seffner. Beide haben auch neben den Ver-
tretern der Dresdner Secession eigene Räume angewiesen
erhalten, die sie nach ihrem Geschmack ausgestattet und
eingerichtet haben. Der Klinger-Saal entspricht in Größe
und Beleuchtung durch Ober- und Seitenlicht ziemlich
genau dem großen Atelicrraum, den sich der Künstler
in seinem vor zwei Jahren erbauten Künstlerheini nach
eigenen Plänen hat erbauen lassen. Er ist gegen 20 m
lang und 12m breit, die Wände sind mit intensiv violetter
Farbe getönt, die Holztäfelung der aus Sparrenwerk be-
stehenden Decke weist abwechselnd rosafarbige und hell-
blaue Felder auf. Einen ganz besonders wohlthuenden
Eindruck macht der Saal aber dadurch, daß nur eine ge-
ringe Anzahl von Kunstwerken, die Klinger selbst aus-
gewählt hat, in ihm Aufnahme gefunden hat (es sind
außer Klingers bekannter „Kreuzigung" Gemälde von
Schultze-Naumburg, Stöving, und einige Köpfe von
Arthur Volkmann u. s. w.), so daß das Auge, das
sonst in jedem Ausstellungsräume durch die Fülle der ver-
schiedensten Bilder fast ermüdet wird, wohlthuende Ruhe-
punkte findet, deren der Beschauer bedarf, wenn er hier
diesem der größten unserer lebenden Künstler in die ihm
eigene Phantasiewelt und Jdeensphäre folgen will. Das
große, die eine Breitenwand ganz bedeckende, nach sieben-
jähriger Arbeit erst vor kurzem vollendete Gemälde
„Christus im Olymp" dürfte in der ganzen Kunsthalle
die meiste Aufmerksamkeit beanspruchen. Noch nie haben
sich die Urteile der Besucher in solchen Gegensätzen be-
wegt wie angesichts dieses Kolossalbildes: enthusiastische
Bewunderung auf der einen, vernichtende Aburteilung auf
der andern Seite, oder im besten Falle ein bedeutungs-
volles Achselzucken, das uns sagen soll, die Phantasie des
Künstlers sei ein unentwirrbares Rätsel. Wir wollen diesen
Z80
Vignette aus dem Einladungsschreiben zur sächsisch-lhüring. Kunst-Ausstellung, von Mar Klinger.
Auf der „Au,Malle" der sächsisch-thüringischen Aufstellung in Leipzig.
ie „Kunsthalle" der diesjährigen sächsisch-thüringischen
Industrie- und Gewerbe-Ausstellung in Leipzig
konnte es sich schon aus äußeren Gründen nicht zur Auf-
gabe machen, mit den großen internationalen Ausstellungen,
wie sie außer in München und in Berlin in diesem Jahre
auch in Dresden mit großem Erfolge veranstaltet worden
sind, zu konkurrieren. Für Leipzig handelte es sich um ein
lokal engumschriebenes Unternehmen, insofern programm-
mäßig nur Künstler Berücksichtigung gefunden haben, die
in dem Ausstellungsbezirk (Königreich und Provinz Sachsen,
Thüringen, Anhalt, Franken, einige Kreise der Provinz
Brandenburg) wohnen oder aus ihm gebürtig sind. Die
letztere Bestimmung hat es möglich gemacht, daß Künstler
wie z. B. Fritz von Uhde in München, Theodor Weber
in Paris, Arthur Volkmann in Rom u. a., zur Be-
schickung der Ausstellung aufgefordert werden konnten, die
man zunächst in Leipzig in Hinblick auf die lokale Be-
grenzung nicht suchen dürfte. Der Gesamteindruck, den
die Kunsthalle macht, ist bei den Schwierigkeiten, die
dem Unternehmen durch die drei großen internationalen
Ausstellungen und ihrer Absorbierung von Kunstwerken
entgegenstanden, im allgemeinen gut, wenn auch nicht ge-
leugnet werden kann, daß im Arrangement der Kunstwerke
manches hätte geändert, manches hätte umgestaltet werden
sollen. Ein großer Teil des wirklich Guten war den
Besuchern der letztjährigen Ausstellungen in Berlin und
München bekannt, eine Erscheinung, die wir allenthalben
beobachten können. Neben dem vielen Guten und neben
einzelnen hervorragenden Werken ist leider manches Mittel-
gut vorhanden, das man gern vermissen möchte. Zur Er-
klärung dieser Thatsache mag darauf hingewiesen werden,
daß nach Lage der Verhältnisse und angesichts der direkten
Einladungen, die an eine große Anzahl von Künstlern er-
gangen waren und Jury-Freiheit mit sich brachten, es
von vornherein unmöglich war, über die künstlerische
Qualität der einzelnen Kunstwerke einen Ueberblick zu er-
halten. So ist es wohl gekommen, daß eine Anzahl von
Gemälden die Jury passiert haben, die unter andern
Umständen ohne weiteres hätten zurückgewiesen werden
müssen.
Im Mittelpunkte der Ausstellung stehen zwei Künstler,
die, man darf es offen sagen, jener ihre Hauptbedeutung
verleihen: es sind die beiden Leipziger Max Klinger
und Carl Seffner. Beide haben auch neben den Ver-
tretern der Dresdner Secession eigene Räume angewiesen
erhalten, die sie nach ihrem Geschmack ausgestattet und
eingerichtet haben. Der Klinger-Saal entspricht in Größe
und Beleuchtung durch Ober- und Seitenlicht ziemlich
genau dem großen Atelicrraum, den sich der Künstler
in seinem vor zwei Jahren erbauten Künstlerheini nach
eigenen Plänen hat erbauen lassen. Er ist gegen 20 m
lang und 12m breit, die Wände sind mit intensiv violetter
Farbe getönt, die Holztäfelung der aus Sparrenwerk be-
stehenden Decke weist abwechselnd rosafarbige und hell-
blaue Felder auf. Einen ganz besonders wohlthuenden
Eindruck macht der Saal aber dadurch, daß nur eine ge-
ringe Anzahl von Kunstwerken, die Klinger selbst aus-
gewählt hat, in ihm Aufnahme gefunden hat (es sind
außer Klingers bekannter „Kreuzigung" Gemälde von
Schultze-Naumburg, Stöving, und einige Köpfe von
Arthur Volkmann u. s. w.), so daß das Auge, das
sonst in jedem Ausstellungsräume durch die Fülle der ver-
schiedensten Bilder fast ermüdet wird, wohlthuende Ruhe-
punkte findet, deren der Beschauer bedarf, wenn er hier
diesem der größten unserer lebenden Künstler in die ihm
eigene Phantasiewelt und Jdeensphäre folgen will. Das
große, die eine Breitenwand ganz bedeckende, nach sieben-
jähriger Arbeit erst vor kurzem vollendete Gemälde
„Christus im Olymp" dürfte in der ganzen Kunsthalle
die meiste Aufmerksamkeit beanspruchen. Noch nie haben
sich die Urteile der Besucher in solchen Gegensätzen be-
wegt wie angesichts dieses Kolossalbildes: enthusiastische
Bewunderung auf der einen, vernichtende Aburteilung auf
der andern Seite, oder im besten Falle ein bedeutungs-
volles Achselzucken, das uns sagen soll, die Phantasie des
Künstlers sei ein unentwirrbares Rätsel. Wir wollen diesen